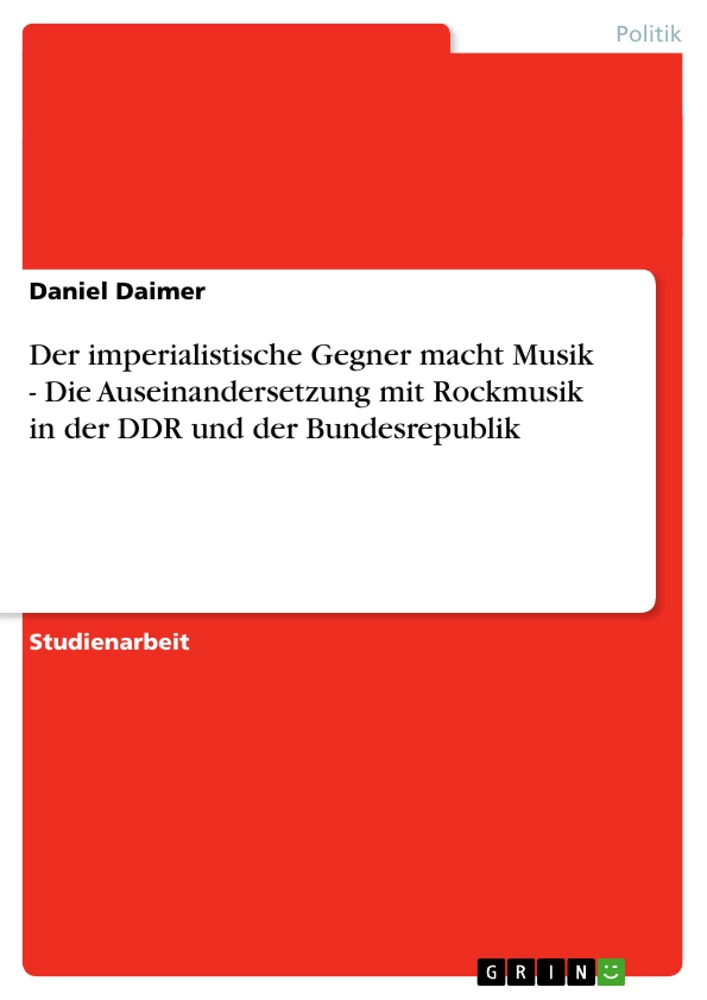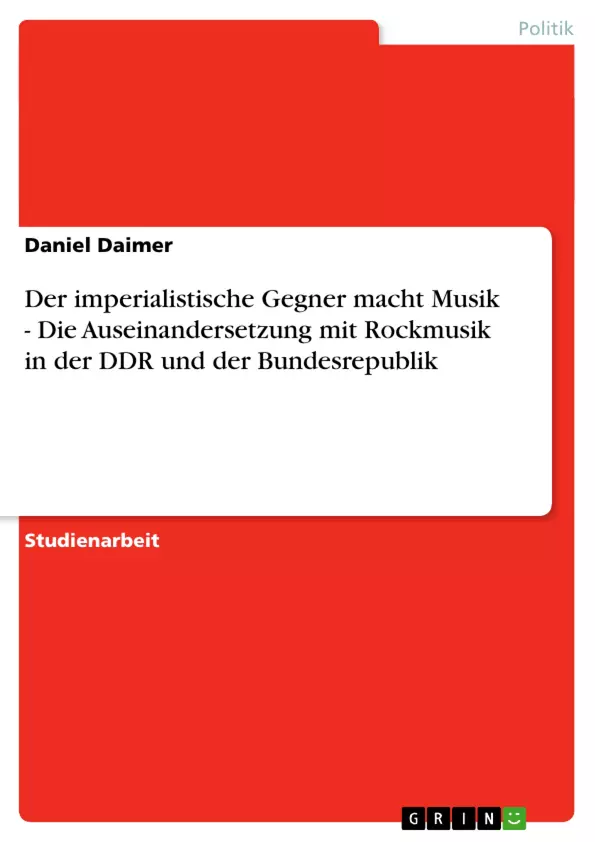Amerikanische Kultureinflüsse wurden in Deutschland seit der Weimarer Republik äußerst kontrovers diskutiert. Nach 1945 nahmen Tendenzen einer kulturellen Amerikanisierung durch amerikanische Soldaten, die Öffnung des westdeutschen Marktes und über das Radio auch in der SBZ und der späteren DDR zu. Im Rahmen dieser Arbeit werden die Reaktionen der DDR-Führung auf die Verbreitung populärer Musik amerikanischen Vorbilds (Rock’n’Roll, Beat, Rock, im folgenden als Rockmusik bezeichnet) mit Schwerpunkt auf die Fünfziger und Sechziger Jahre untersucht. Dabei sind die parallelen Entwicklungen in der Bundesrepublik einzubeziehen, muss die Geschichte der populären Musik in der DDR doch als „eine Geschichte der Kapitulation vor der Übermacht westlicher Entwicklungen“ (Rauhut 1997) beschrieben werden. Anhand dieser vergleichenden Untersuchung des Umgangs mit Rockmusik werden gezielte Identitätsbildungsprozesse in beiden deutschen Staaten herausgearbeitet. Zunächst trug die Ablehnung, die Eltern, Erzieher und Politiker der Rockmusik (bzw. dem Konsum amerikanischer Kulturimporte durch Jugendliche) in den Fünfziger Jahren entgegenbrachten, in beiden deutschen Staaten ähnliche Züge. Im Westen wurde der Konsum nach amerikanischem Vorbild aber spätestens mit der großen Koalition immer mehr Teil einer bundesrepublikanischen Identität, was die Möglichkeit zu einer Enpolitisierung der Rockmusik brachte (Poiger 2000). Demgegenüber wurde im Osten unbeirrt an kulturpolitischen Grundsätzen festgehalten: Rockmusik galt als klares Zeichen für den Verfall der Sitten unter dem Kapitalismus und fiel unter den Verdacht der „ideologischen Diversion“. Beim entschlossenen Versuch, gesellschaftliche Phänomene unter obrigkeitsstaatliche Kontrolle zu bringen tritt an diesem Untersuchungsgegenstand die wachsende Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit besonders deutlich hervor: „Ungeachtet aller deklarativen Zielvorgaben (…) siegte mit den Jahren das Krisenmanagement.“ In der Immobilität äußeren Einflüssen gegenüber gefangen, rannte man den Entwicklungen, wie sie der Alltag diktierte hinterher. (Rauhut 1997)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Entwicklung im Westen
- Die Entwicklung der westdeutschen Jugend nach dem zweiten Weltkrieg
- Von der Jugendnot zum Jugendschutz: Jugendpolitik in der Ära Adenauer
- Vom Kriegskind zum Konsumkind
- Amerikanisierung als Generationserfahrung: Die subkulturellen Jugendlichen der fünfziger Jahre
- Vom,rocken' und,rollen': Die rebellischen „,Halbstarken“
- Subkulturelle Stilelemente - Rock'n'Roll
- Krawalle und Randale
- Reaktionen auf „Halbstarke“ und Rock'n'Roll
- Darstellung in den Medien
- Stellungnahmen politischer Vertretern
- Reaktionen der staatlichen Ordnungsbehörden
- Deutung der Reaktionen
- Von den Halbstarken\" zu den Teenagern
- Rock'n'Roll und „,Halbstarke“ in der DDR bis zum Mauerbau
- Konstitutive Phase der ideologischen Auseinandersetzung
- Kulturpolitik dient der Umgestaltung der Gesellschaft
- Sozialistische Tanz- und Unterhaltungsmusik
- Jugendbild und Jugendpolitik der SED
- Die Rolle der FDJ
- Das Jugendkommuniqué von 1961
- ,,Halbstarke“ und „Eckensteher“
- Jugendsubkultur und Symbole der Provokation
- Vorkommnisse und Meldungen
- Die Darstellung von Rock'n'Roll in den DDR-Medien
- Westlich orientierte Jugendsubkultur und dreifache ideologische Ablehnung
- Kurze Deutung der fünfziger Jahre
- Beat, Rock und Teenager in der DDR nach dem Mauerbau
- Vom Mauerbau zum Jugendkommuniqué
- Die zweite Staatsgründung und Repressionskurs
- Jugendpolitischer Reformwille vor dem Hintergrund des NÖSPL
- „Der Jugend Vertrauen und Verantwortung“ - Das Jugendkommuniqué von 1963
- Auf Kurs gegen die Gammler
- „Tachchen, Tachchen“ - DT 64 und Beatlesmania
- Vorlauf zum Kahlschlag
- Das 11. Plenum des ZK der SED
- Resignation und Wellen der weiteren Politisierung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Reaktionen der DDR-Führung auf die Verbreitung populärer Musik amerikanischen Vorbilds und die tatsächlichen oder befürchteten Auswirkungen auf Jugendliche in den fünfziger und sechziger Jahren. Dabei werden die parallelen Entwicklungen in der Bundesrepublik vergleichend einbezogen, da diese über die Massenmedien jederzeit präsent waren und die Geschichte der populären Musik in der DDR als „eine Geschichte der Kapitulation vor der Übermacht westlicher Entwicklungen“4 beschrieben werden muss.
- Die Auseinandersetzung mit amerikanischer Rockmusik in der DDR und der Bundesrepublik
- Die Rolle der Jugendpolitik in der DDR und der Bundesrepublik
- Die Verwendung von Rockmusik als Mittel der ideologischen Auseinandersetzung
- Die Entwicklung von Jugendsubkulturen in der DDR und der Bundesrepublik
- Die Auswirkungen der Musik auf die Entwicklung der deutschen Gesellschaften
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert den methodischen Ansatz. Es wird der Vergleich der Reaktionen der DDR und der Bundesrepublik auf die Verbreitung amerikanischer Rockmusik im Kontext der „gemeinsamen Problemlage“ beider deutscher Staaten untersucht.
- Die Entwicklung im Westen: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung der westdeutschen Jugend nach dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere die Entstehung von Jugendsubkulturen und die Reaktion der Gesellschaft auf diese Entwicklung. Es werden die verschiedenen Phasen der Jugendpolitik in der Bundesrepublik und die Auswirkungen der Amerikanisierung auf die westdeutsche Jugend dargestellt.
- Rock'n'Roll und „,Halbstarke“ in der DDR bis zum Mauerbau: Dieses Kapitel behandelt die Reaktionen der DDR-Führung auf Rock'n'Roll und die Entstehung von Jugendsubkulturen in der DDR bis zum Mauerbau. Es werden die politischen, kulturellen und ideologischen Aspekte der Auseinandersetzung mit amerikanischer Musik in der DDR dargestellt.
- Beat, Rock und Teenager in der DDR nach dem Mauerbau: Dieses Kapitel setzt die Untersuchung der Entwicklungen in der DDR nach dem Mauerbau fort, fokussiert auf die Verbreitung von Beat- und Rockmusik und die damit verbundenen Reaktionen der DDR-Führung. Es werden die politischen und ideologischen Spannungen in der DDR und die Entwicklung der Jugendpolitik in diesem Kontext beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet die deutsche Teilungsgeschichte, insbesondere die Auseinandersetzung mit amerikanischer Rockmusik in der DDR und der Bundesrepublik. Dabei werden die Themen Jugendkultur, Jugendpolitik, Kulturpolitik, Ideologie, Massenkultur, Amerikanisierung und die Rolle der Medien behandelt. Die Arbeit veranschaulicht den Einfluss von amerikanischen Kultureinflüssen auf die Entwicklung der deutschen Gesellschaften und die Reaktionen auf diese Einflüsse in der DDR und der Bundesrepublik.
Häufig gestellte Fragen zur Rockmusik in der DDR und BRD
Wie reagierte die DDR-Führung auf Rock'n'Roll?
Sie sah darin ein Zeichen für den Verfall der Sitten im Kapitalismus und stufte die Musik als „ideologische Diversion“ ein.
Was waren die "Halbstarken"?
Jugendsubkulturen der 50er Jahre, die durch Rock'n'Roll, Provokation und teils Krawalle auffielen und in beiden deutschen Staaten auf Ablehnung stießen.
Warum entpolitisierte sich Rockmusik in der Bundesrepublik schneller?
Spätestens ab den 60er Jahren wurde der Konsum amerikanischer Kultur Teil einer westdeutschen Identität und eines modernen Lebensstils.
Was passierte beim 11. Plenum des ZK der SED?
Es kam zu einem „Kahlschlag“ in der Kulturpolitik, bei dem Beatmusik und westliche Einflüsse massiv unterdrückt wurden.
Welche Rolle spielte der Sender DT 64?
DT 64 war ein Jugendradio in der DDR, das versuchte, den Spagat zwischen staatlicher Kontrolle und der Beliebtheit westlicher Musik (wie den Beatles) zu meistern.
- Citation du texte
- Daniel Daimer (Auteur), 2005, Der imperialistische Gegner macht Musik - Die Auseinandersetzung mit Rockmusik in der DDR und der Bundesrepublik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49127