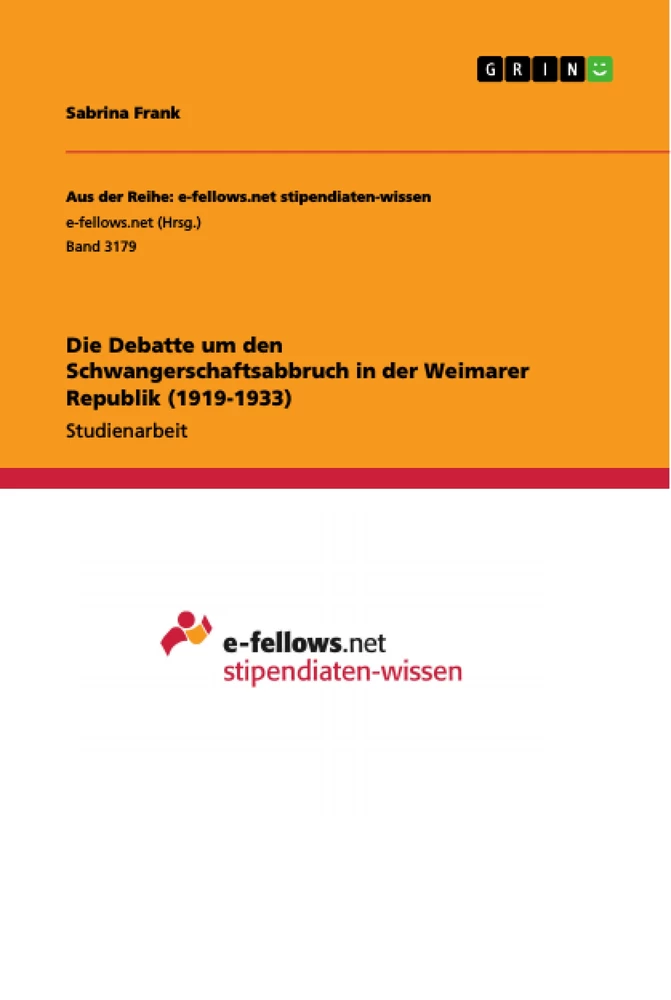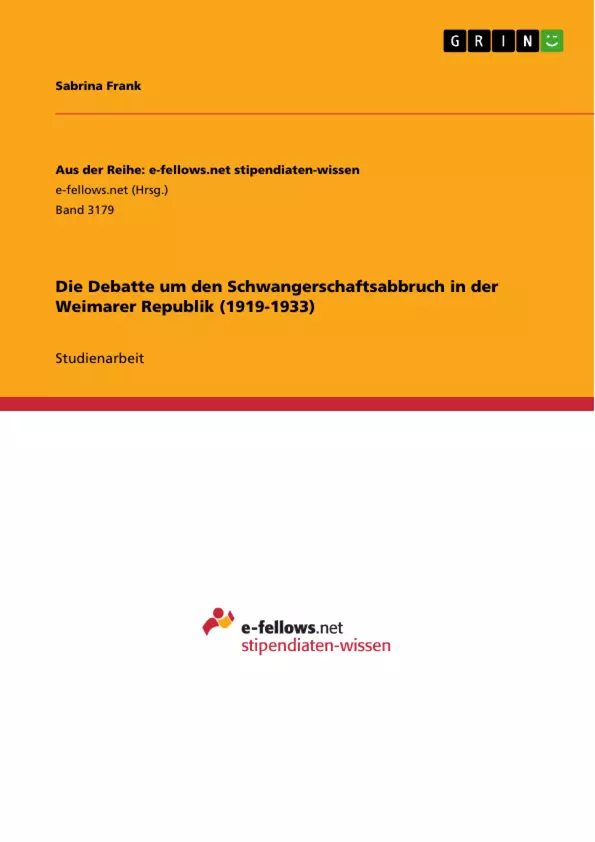Die Geschichte des Reproduktionsrechts des weiblichen Geschlechts ist in summa geprägt durch die Unterdrückung der Frau seitens des Mannes, was an vielen Orten der Welt auch heute noch Alltag ist. Diese Unfreiheit manifestierte sich in jedem denkbaren Ausmaß und den verschiedensten Formen, unter anderem dem Paragraphen 218 Strafgesetzbuch, eingeführt im Jahre 1872. Das Abtreibungsverbot in Deutschland hat sich bis dato in veränderter Form gehalten und schränkt weiterhin die Entscheidungsfreiheit von Schwangeren ein. Einige, wie etwa Petra Bläss, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, setzten sich in unserer Gegenwart dafür ein, diesen Paragraphen abzuschaffen und damit die Selbstbestimmung der Frau auf einer von vielen Ebenen einzuführen. So gibt es, seit Repression existiert, auch Betroffene, die sich diesen Umständen nicht unterordnen; sei es nun passiver oder aktiver Widerstand, in Form von Gesetzesbruch oder Organisation von politischen Gruppierungen. Zu der Zeit der Weimarer Republik war es der Abort, der dem Verstoß gegen die Gesetzeslage ein Gesicht gab. Dieser begleitete die, schon damals heftig diskutierte und heute immer noch aktuelle, Fragestellung, ob das oben genannte, gesetzliche Abortverbot abgeschafft werden sollte.
Inhaltsverzeichnis
- Die Geschichte des Reproduktionsrechts des weiblichen Geschlechts
- Die Debatte um den Schwangerschaftsabbruch in der Weimarer Republik (1919-1933)
- Charakterisierung der Zustände vor und während der Weimarer Republik
- Die Argumentationen der involvierten Parteien
- Die Reformgegner
- Die Reformbefürworter
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Seminarpapier befasst sich mit der Debatte um den Schwangerschaftsabbruch in der Weimarer Republik. Es analysiert die Argumente der involvierten Parteien sowie die Veränderung des Paragraphen 218 Strafgesetzbuch im Licht dieser Auseinandersetzung.
- Die Geschichte des Reproduktionsrechts in Deutschland
- Der Paragraph 218 Strafgesetzbuch und seine Auswirkungen
- Die Argumentationsstrukturen der Reformgegner und Reformbefürworter
- Die Rolle der Kirche und des Deutschen Ärztevereinsbundes (DÄVB)
- Die Bedeutung der sozialen und politischen Rahmenbedingungen der Weimarer Republik
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel beleuchtet die Geschichte des Reproduktionsrechts des weiblichen Geschlechts und zeigt die Unterdrückung der Frau durch den Mann auf, die sich in Form von Gesetzen wie dem Paragraphen 218 manifestierte.
- Das zweite Kapitel widmet sich der Debatte um den Schwangerschaftsabbruch in der Weimarer Republik und erläutert den historischen Hintergrund des Paragraphen 218.
- Das dritte Kapitel zeichnet die sozialen und politischen Rahmenbedingungen der Weimarer Republik nach, die die Debatte um den Schwangerschaftsabbruch beeinflussten.
- Das vierte Kapitel analysiert die Argumentationen der Reformgegner, die sich für den Erhalt des Paragraphen 218 einsetzten.
- Das fünfte Kapitel untersucht die Argumente der Reformbefürworter, die eine Abschaffung oder Liberalisierung des Paragraphen 218 forderten.
Schlüsselwörter
Schwangerschaftsabbruch, Abtreibung, Paragraph 218 Strafgesetzbuch, Weimarer Republik, Reproduktionsrecht, Frauenrechte, Moral, Kirche, Deutscher Ärztevereinsbund (DÄVB), Pronatalismus, Geburtenrate, Engelmacherinnen, medizinische Indikation, Selbstbestimmung.
Häufig gestellte Fragen
Wie sah die Rechtslage zum Schwangerschaftsabbruch in der Weimarer Republik aus?
Der 1872 eingeführte Paragraph 218 stellte den Schwangerschaftsabbruch unter Strafe. In der Weimarer Republik wurde er heftig diskutiert, blieb aber trotz Reformbemühungen in weiten Teilen bestehen.
Wer waren die Befürworter einer Reform des Paragraphen 218?
Reformbefürworter waren vor allem Frauenrechtsorganisationen, linke politische Gruppierungen und Teile der Ärzteschaft, die die Selbstbestimmung der Frau und soziale Notlagen betonten.
Warum lehnten die Reformgegner eine Liberalisierung ab?
Gegner, oft aus dem kirchlichen und konservativen Spektrum, argumentierten mit moralischen Werten, dem Schutz des ungeborenen Lebens und bevölkerungspolitischen Zielen (Pronatalismus).
Was bedeutete die "medizinische Indikation" damals?
Die medizinische Indikation erlaubte Straffreiheit, wenn das Leben oder die Gesundheit der Mutter in Gefahr war. Dies war einer der zentralen Diskussionspunkte zwischen Ärzten und Gesetzgebern.
Welche Rolle spielten die "Engelmacherinnen"?
Aufgrund des Verbots griffen viele Frauen zu illegalen und oft lebensgefährlichen Methoden bei sogenannten Engelmacherinnen, was die soziale Brisanz der Debatte in der Weimarer Republik verschärfte.
- Quote paper
- Sabrina Frank (Author), 2016, Die Debatte um den Schwangerschaftsabbruch in der Weimarer Republik (1919-1933), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/491311