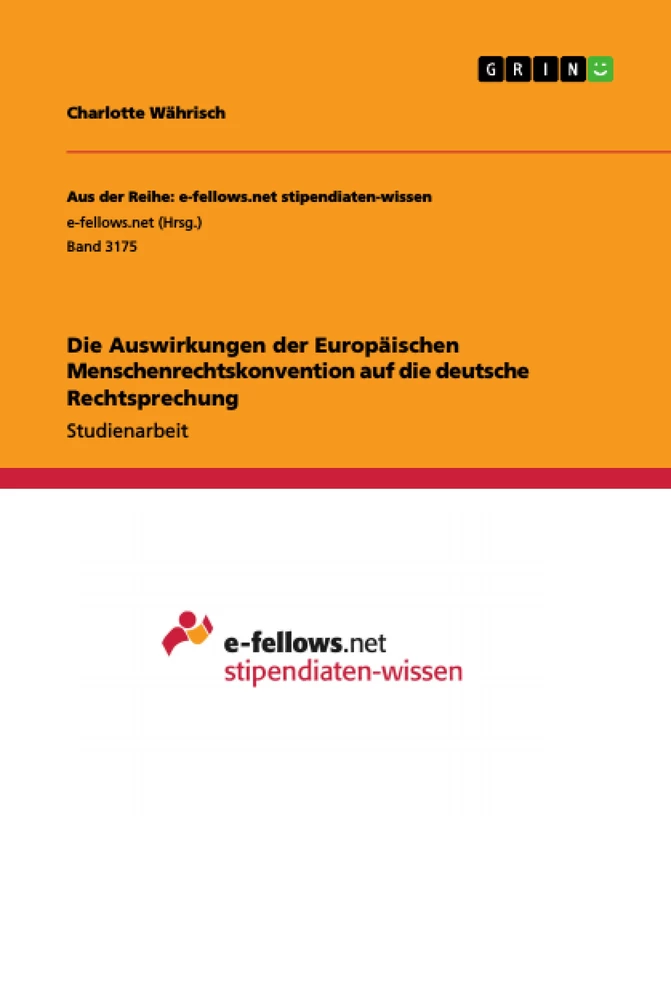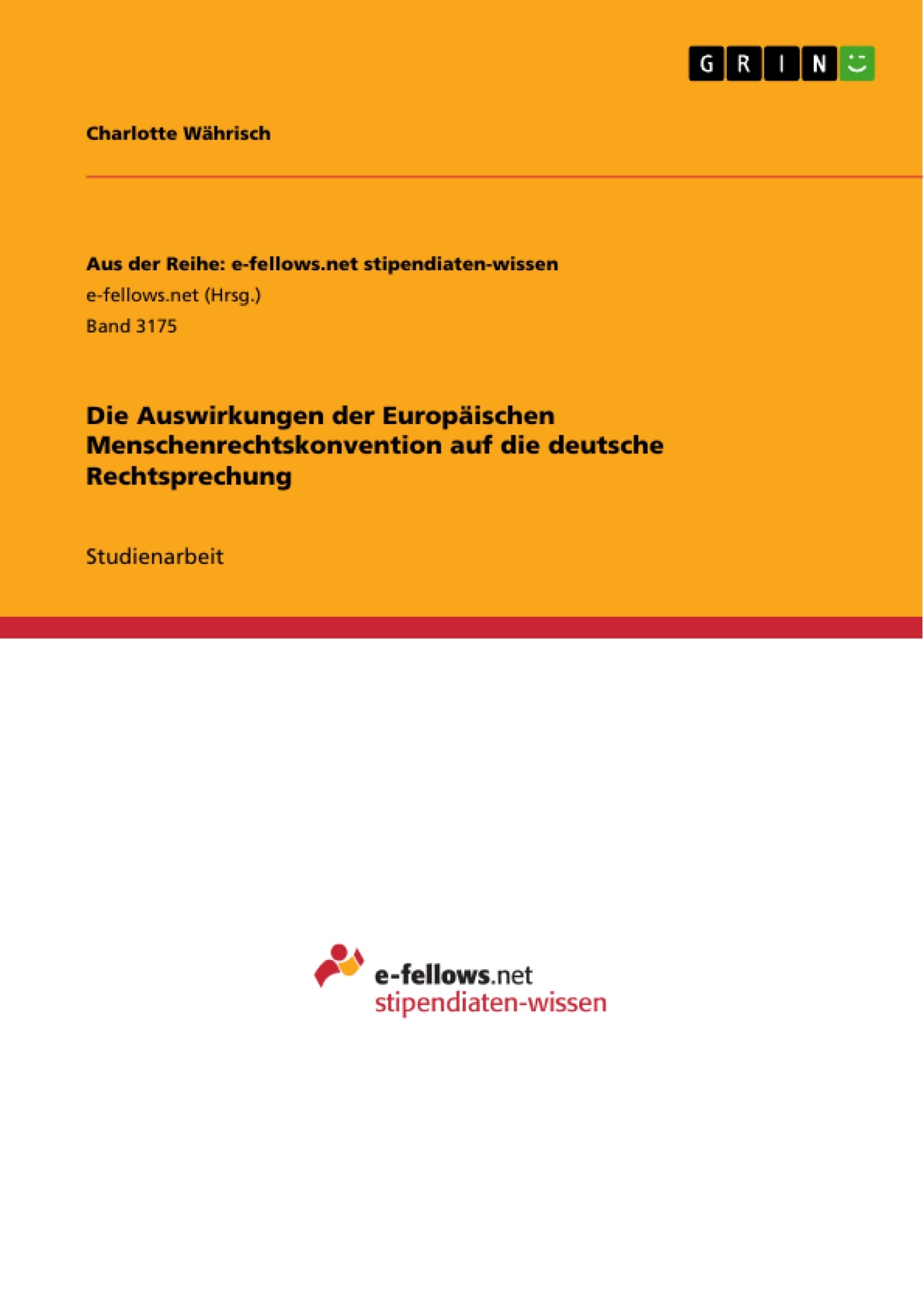Diese Arbeit geht der Frage nach, welchen Einfluss die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) auf die deutsche Rechtssprechung hat. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur EMRK und der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR). Kritisch wird insbesondere diskutiert, ob der aktuelle Stand der Praxis in Deutschland der heutigen Bedeutung der EMRK auf völkerrechtlicher Ebene gerecht wird und welche Schritte auf den verschiedenen Ebenen zur Lösung von Problemen ergriffen werden könnten.
Geprägt von den Ereignissen des zweiten Weltkrieges versuchten die Mitgliedstaaten des Europarats mit der Europäischen Menschenrechtskonvention einen Grundsatz an individuellen Rechten festzuschreiben, der ihren gemeinsamen Werte- und Rechtsvorstellungen entsprach. Das Ziel, einen Mindeststandard an Menschenrechtsschutz in Europa zu etablieren, ist gut gelungen. Durch die Konvention und die Rechtsprechung des EGMR wird Grundrechtschutz im europäischen Raum effektiv durchgesetzt und aktiv weiterentwickelt.
Allerdings führt das Nebeneinander zwischen den nationalen Rechtsordnungen und der EMRK auch zu Problemen. Welchen Rang belegt die Konvention im nationalen Recht? Welche Bedeutung haben die Urteile des EGMR für die innerstaatliche Rechtsprechung und den Gesetzgeber? In welchem Verhältnis stehen die Garantien der EMRK zu den nationalen Grundrechten? Wie kann man als Bürger im Inland seine Rechte aus der EMRK geltend machen? Und was geschieht, wenn es zu einem Konflikt zwischen dem Recht der EMRK oder einem Urteil des EGMR und dem nationalen Recht kommt?
All diese Fragen sollen im Folgenden in Bezug auf Deutschland erörtert werden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Völkerrechtliche Ausgangslage
- 1. Rechtsnatur der EMRK
- 2. Verpflichtung der Konventionsstaaten
- 3. Besonderheiten der EMRK
- III. Die EMRK im deutschen Recht
- 1. Inkorporation
- 2. Übergesetzesrang der EMRK
- a) Die EMRK als Grundrechtsverfassung i.V.m. Art. 1 II, III GG
- b) Die EMRK als Teil des Wesensgehalts von Art. 2 I GG
- c) Die EMRK als Völkergewohnheitsrecht nach Art. 25 GG
- d) Die EMRK als zwischenstaatliche Einrichtung i.S.v. Art. 24 I GG
- e) Ergebnis
- 3. Die Lösung des Bundesverfassungsgerichts
- 4. Ergebnis
- IV. Die Urteile des EGMR im deutschen Recht
- 1. Allgemeines
- 2. Rechtskraftwirkung
- 3. Orientierungswirkung
- 4. Die Lösung des Bundesverfassungsgerichts
- 5. Umsetzung
- a) Verwaltung
- b) Gerichtsurteil
- c) Gesetze
- 6. Ergebnis
- V. Problembereich: Mehrpolige Grundrechtsverhältnisse
- VI. Die EMRK für den Bürger
- 1. Einklagbarkeit in Deutschland
- 2. Individualbeschwerde vor dem EGMR
- 3. Ergebnis
- VII. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit „Die Wirkung der EMRK in Deutschland“ beschäftigt sich mit der Rezeption und Anwendung der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) im deutschen Rechtssystem. Ziel der Arbeit ist es, die unterschiedlichen Rechtswirkungen der EMRK im deutschen Kontext zu beleuchten und zu analysieren, wie das Bundesverfassungsgericht und andere deutsche Gerichte mit der EMRK umgehen.
- Rechtsnatur der EMRK im deutschen Recht
- Übergesetzesrang und Verfassungsrang der EMRK
- Die Rolle des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) in Deutschland
- Spannungsverhältnis zwischen EMRK und deutschem Grundgesetz
- Die Bedeutung der EMRK für den Bürger in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
- I. Einleitung: Diese Einleitung bietet eine kurze Einführung in das Thema der Seminararbeit und stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor.
- II. Völkerrechtliche Ausgangslage: Dieses Kapitel untersucht die Rechtsnatur der EMRK und die Verpflichtungen, die sich aus ihr für die Konventionsstaaten ergeben. Besonderheiten der EMRK werden ebenfalls erläutert.
- III. Die EMRK im deutschen Recht: Dieses Kapitel befasst sich mit der Inkorporation der EMRK in das deutsche Rechtssystem und analysiert den Übergesetzesrang der EMRK im Verhältnis zum Grundgesetz. Es werden verschiedene Interpretationen und Argumente dazu beleuchtet, wie die EMRK als Grundrechtsverfassung und Völkergewohnheitsrecht im deutschen Recht zu verstehen ist. Das Kapitel diskutiert die Lösung des Bundesverfassungsgerichts zur Einordnung der EMRK.
- IV. Die Urteile des EGMR im deutschen Recht: Dieses Kapitel befasst sich mit der Rechtskraftwirkung und der Orientierungswirkung von EGMR-Urteilen im deutschen Recht. Es analysiert die Lösung des Bundesverfassungsgerichts zur Berücksichtigung von EGMR-Urteilen und behandelt die verschiedenen Formen der Umsetzung von EGMR-Urteilen in Verwaltung, Gerichtsurteilen und Gesetzen.
- V. Problembereich: Mehrpolige Grundrechtsverhältnisse: Dieses Kapitel befasst sich mit den Herausforderungen, die sich aus der Koexistenz verschiedener Grundrechtsordnungen (deutsches Grundgesetz und EMRK) ergeben.
- VI. Die EMRK für den Bürger: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung der EMRK für den Bürger in Deutschland. Es erklärt die Möglichkeiten der Einklagbarkeit von EMRK-Rechten in Deutschland und die Möglichkeit der Individualbeschwerde vor dem EGMR.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) im deutschen Recht. Dazu zählen: Rechtsnatur der EMRK, Übergesetzesrang, Verfassungsrang, Bundesverfassungsgericht, Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), Individualbeschwerde, Grundrechte, Völkerrecht, Mehrpolige Grundrechtsverhältnisse, Rechtswirkung, Orientierungswirkung, Umsetzung.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Rang hat die EMRK im deutschen Recht?
In Deutschland hat die Europäische Menschenrechtskonvention den Rang eines einfachen Bundesgesetzes, muss aber völkerrechtsfreundlich ausgelegt werden.
Wie binden Urteile des EGMR deutsche Gerichte?
Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte haben eine Orientierungs- und Rechtskraftwirkung, die vom Bundesverfassungsgericht berücksichtigt werden muss.
Kann ein Bürger die EMRK direkt in Deutschland einklagen?
Ja, da sie in deutsches Recht inkorporiert wurde, können sich Bürger vor nationalen Gerichten direkt auf die Garantien der Konvention berufen.
Was passiert bei einem Konflikt zwischen Grundgesetz und EMRK?
Das Bundesverfassungsgericht strebt eine Harmonisierung an, wobei das Grundgesetz die letzte Instanz bleibt, die EMRK jedoch als Auslegungshilfe dient.
Was ist eine Individualbeschwerde beim EGMR?
Nach Erschöpfung des nationalen Rechtsweges kann jeder Einzelne eine Beschwerde in Straßburg einlegen, wenn er seine Konventionsrechte verletzt sieht.
- Citar trabajo
- Charlotte Währisch (Autor), 2018, Die Auswirkungen der Europäischen Menschenrechtskonvention auf die deutsche Rechtsprechung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/491367