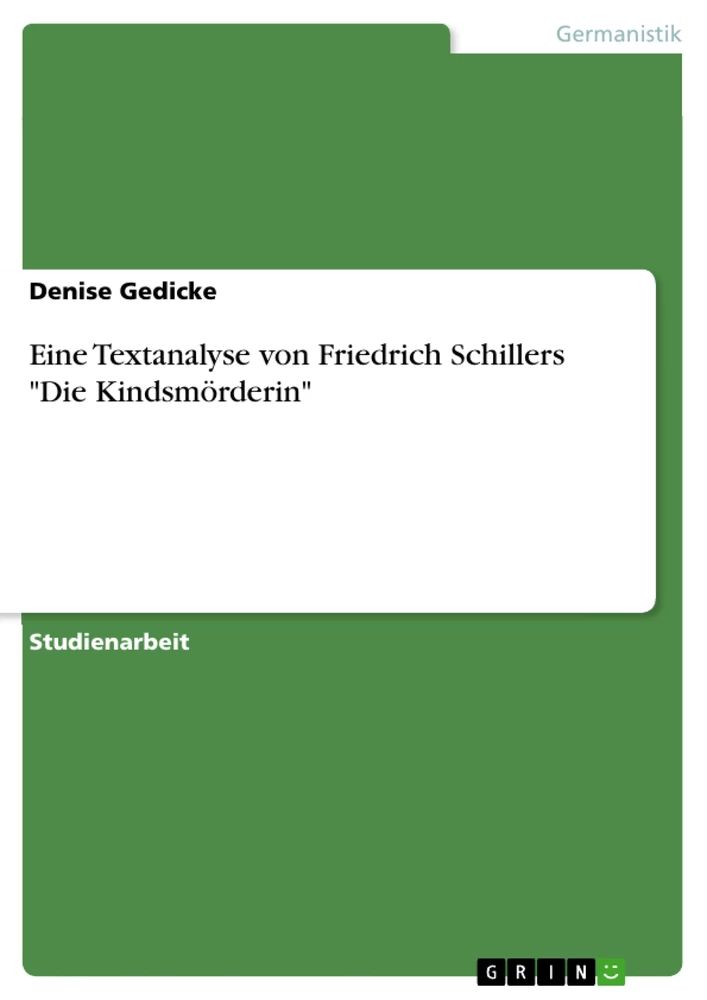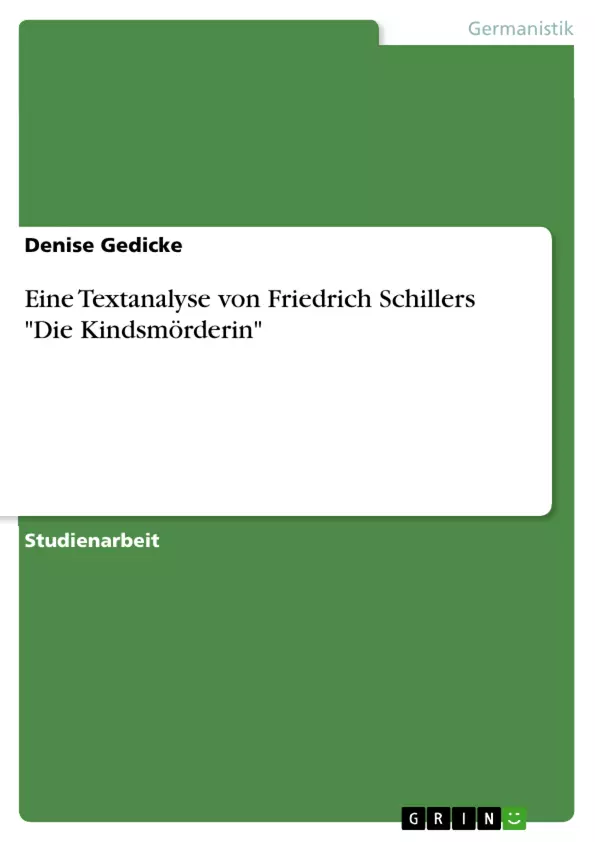Schon in der Antike beschäftigten sich viele Philosophen und Literaten mit dem Thema Kindsmord. Platon selbst befürwortete sogar die Tötung von missgestalteten Neugeborenen. In vielen Teilen der Welt war es damals üblich, Neugeborene, die nicht normal oder zu schwach waren, einfach auszusetzen.
Im Laufe der Geschichte änderten sich die Motive der Kindstötungen, jedoch blieb der Tatbestand bestehen. Im Mittelalter töteten viele Eltern ihre Kinder, da sie sie nicht hätten ernähren können.
Im 18. Jahrhundert nahmen die Kindstötungen gerade von außerehelichen Geburten zu. Dies taten die Mütter, die Kindsmörderinnen, da sie den gesellschaftlichen Abstieg und den Pranger fürchteten. Denn zu dieser Zeit war ein Leben als alleinerziehende ledige Mutter nicht denkbar. Diese Frauen wurden daraufhin zum Tode verurteilt, egal welche Motive sie gehabt haben oder wie die Schwangerschaft zustande gekommen ist. In den Augen der Gesellschaft war eine Mutter, die ihr eigenes Kind tötete ein Monster, das nur mit dem Tode bestraft werden konnte.
Der Kindsmord war in der Politik und Literatur nie so brisant, wie im 18. Jahrhundert. So befassten sich viele Schriftsteller, wie Goethe, Schiller und Wagner mit diesem Thema.
Diese Arbeit analysiert das Gedicht von Friedrich Schiller „Die Kindsmörderin“, die erste Fassung bevor diese für sein Werk „Anthologie auf das Jahr 1782“ nochmals überarbeitet wurde. Sie soll zeigen, dass Schiller seine Kindsmörderin nicht als Monster darstellt, sondern versucht, die Motive zu erklären und die Menschlichkeit aufzuzeigen, die auch in dieser Täterin noch vorhanden ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Gedicht
- 3. Aufbau und Form
- 4. Interpretation und Motivanalyse
- 4.1. Interpretation
- 4.2. Motivanalyse
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Schillers Gedicht „Die Kindsmörderin“ in seiner ersten Fassung vor der Überarbeitung für die „Anthologie auf das Jahr 1782“. Ziel ist es, Schillers Darstellung der Kindsmörderin zu untersuchen und aufzuzeigen, dass er sie nicht als Monster darstellt, sondern versucht, ihre Motive zu erklären und ihre verbleibende Menschlichkeit hervorzuheben.
- Schillers Darstellung der Kindsmörderin
- Motivanalyse des Kindsmordes im 18. Jahrhundert
- Die gesellschaftlichen Umstände und ihre Auswirkungen auf die Protagonistin
- Die Rolle der Emotionen und Empfindungen im Gedicht
- Das Verhältnis von Schuld und Vergebung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet den historischen Kontext des Kindsmordes, beginnend mit der Antike und reichend bis ins 18. Jahrhundert. Sie zeigt die sich verändernden Motive für Kindstötungen auf, von der Unfähigkeit zur Versorgung bis hin zur gesellschaftlichen Stigmatisierung unehelicher Mutterschaft. Der Fokus liegt auf der Brisanz des Themas im 18. Jahrhundert und der Auseinandersetzung damit in der Literatur, wobei Schillers Gedicht als zentraler Untersuchungsgegenstand vorgestellt wird. Die Einleitung betont das Ziel der Arbeit: die Darstellung der Kindsmörderin nicht als monströses Wesen, sondern als Person mit nachvollziehbaren Motiven und verbleibender Menschlichkeit.
2. Gedicht: Dieses Kapitel präsentiert den vollständigen Text von Schillers Gedicht „Die Kindsmörderin“. Die lyrische Qualität des Textes und die sprachliche Gestaltung werden hier nicht weiter analysiert, sondern lediglich der Text selbst zur Verfügung gestellt, um die Grundlage für die nachfolgende Interpretation zu schaffen. Die emotionale Intensität des Gedichts wird durch die direkte Präsentation des Textes unmittelbar erfahrbar gemacht, wodurch der Leser auf die folgenden Kapitel vorbereitet wird.
3. Aufbau und Form: [An dieser Stelle müsste eine Zusammenfassung des Kapitels "Aufbau und Form" eingefügt werden. Da der Text diesen Abschnitt nicht enthält, kann hier keine Zusammenfassung erstellt werden.]
4. Interpretation und Motivanalyse: Dieses Kapitel bietet eine tiefgehende Interpretation und Motivanalyse des Gedichts. Es analysiert die Motive der Kindsmörderin, ihre gesellschaftliche Situation und die emotionalen Konflikte, die zu ihrer Tat geführt haben. Die Interpretation berücksichtigt die sprachlichen Bilder und Metaphern des Gedichts, um Schillers Intentionen zu verstehen und die vielschichtige Darstellung der Protagonistin zu beleuchten. Die Motivanalyse geht über eine reine Inhaltsangabe hinaus und untersucht die zugrundeliegenden psychologischen und gesellschaftlichen Faktoren, die zum Kindsmord beigetragen haben. Dabei wird die Ambivalenz der Darstellung thematisiert und die Menschlichkeit der Figur hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Friedrich Schiller, Die Kindsmörderin, Kindsmord, 18. Jahrhundert, uneheliche Mutterschaft, gesellschaftliche Stigmatisierung, Motivanalyse, Menschlichkeit, Emotionen, Schuld, Vergebung, Lyrik, Gedichtanalyse.
Häufig gestellte Fragen zu Schillers "Die Kindsmörderin"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Friedrich Schillers Gedicht "Die Kindsmörderin" (erste Fassung vor der Überarbeitung für die „Anthologie auf das Jahr 1782“). Der Fokus liegt auf der Darstellung der Kindsmörderin, wobei gezeigt werden soll, dass Schiller sie nicht als Monster, sondern als Person mit nachvollziehbaren Motiven und verbleibender Menschlichkeit darstellt. Die Analyse umfasst den historischen Kontext des Kindsmordes, den Aufbau und die Form des Gedichts, eine detaillierte Interpretation und Motivanalyse, sowie eine Betrachtung der gesellschaftlichen Umstände und der Rolle von Emotionen, Schuld und Vergebung.
Welche Themen werden in der Analyse behandelt?
Die Analyse behandelt folgende Themen: Schillers Darstellung der Kindsmörderin; Motivanalyse des Kindsmordes im 18. Jahrhundert; die gesellschaftlichen Umstände und ihre Auswirkungen auf die Protagonistin; die Rolle der Emotionen und Empfindungen im Gedicht; und das Verhältnis von Schuld und Vergebung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einleitung (historischer Kontext des Kindsmordes, Zielsetzung der Arbeit); 2. Gedicht (vollständiger Text des Gedichts); 3. Aufbau und Form (Analyse des Gedicht-Aufbaus und der Form – der Text enthält keine Zusammenfassung dieses Kapitels); 4. Interpretation und Motivanalyse (tiefgehende Interpretation und Motivanalyse des Gedichts, Berücksichtigung sprachlicher Bilder, Metaphern, psychologische und gesellschaftliche Faktoren); 5. Fazit (nicht im bereitgestellten Text enthalten).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Friedrich Schiller, Die Kindsmörderin, Kindsmord, 18. Jahrhundert, uneheliche Mutterschaft, gesellschaftliche Stigmatisierung, Motivanalyse, Menschlichkeit, Emotionen, Schuld, Vergebung, Lyrik, Gedichtanalyse.
Wo finde ich den vollständigen Text des Gedichts?
Der vollständige Text von Schillers Gedicht "Die Kindsmörderin" ist im zweiten Kapitel der Arbeit enthalten.
Was ist das Hauptziel der Analyse?
Das Hauptziel ist es, Schillers Darstellung der Kindsmörderin zu untersuchen und aufzuzeigen, dass er sie nicht als monströses Wesen, sondern als Person mit nachvollziehbaren Motiven und verbleibender Menschlichkeit darstellt.
Welche Aspekte des historischen Kontextes werden beleuchtet?
Die Einleitung beleuchtet den historischen Kontext des Kindsmordes von der Antike bis ins 18. Jahrhundert, zeigt die sich verändernden Motive für Kindstötungen auf (von Unfähigkeit zur Versorgung bis zur gesellschaftlichen Stigmatisierung unehelicher Mutterschaft) und betont die Brisanz des Themas im 18. Jahrhundert und die Auseinandersetzung damit in der Literatur.
- Citation du texte
- Denise Gedicke (Auteur), 2017, Eine Textanalyse von Friedrich Schillers "Die Kindsmörderin", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/491448