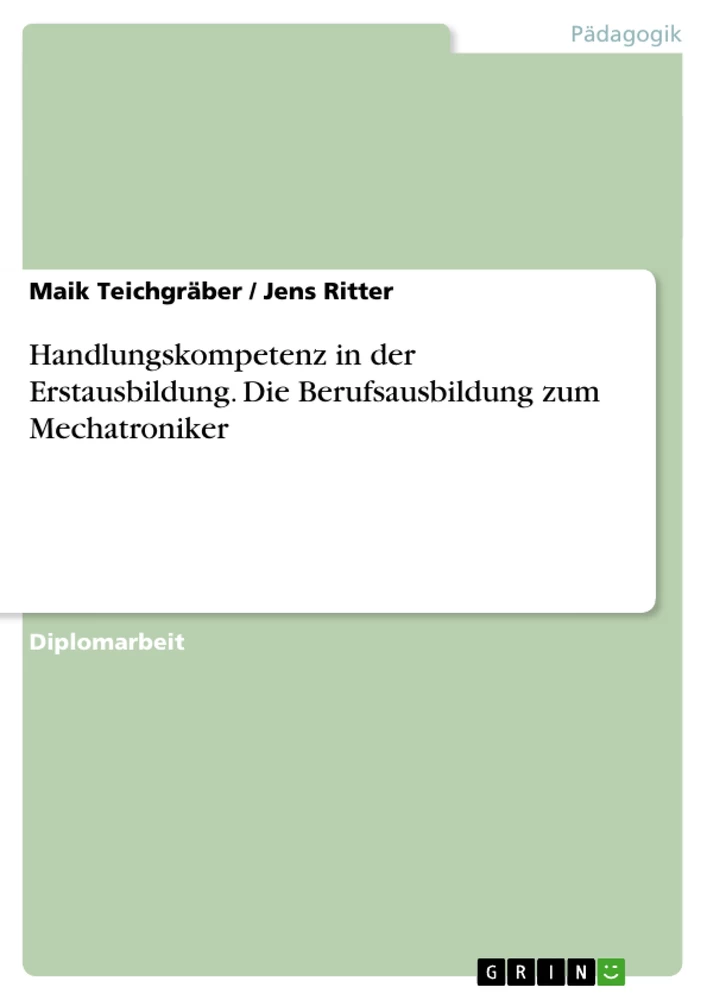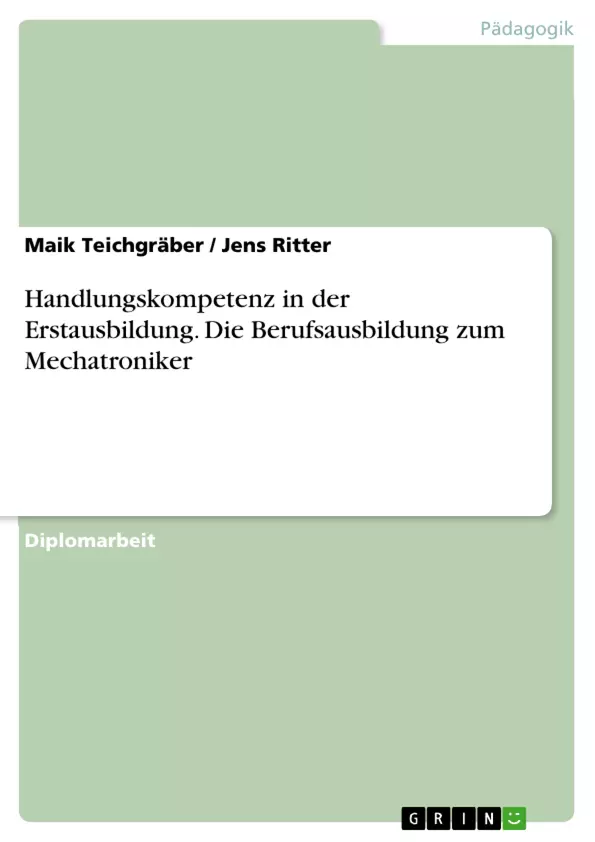„Praktische und theoretische, allgemeine und spezielle Fachinhalte handlungsorientiert zu vermitteln und damit zugleich Handlungskompetenz und die Entwicklung von Schlüsselqualifikationen zu fördern, ist das Grundprinzip aller modernen Lern- und Bildungskonzepte.“ (Bulmahn 1998) Dieses, von der Bundesministerin für Bildung und Forschung in einer Rede vor dem Deutschen Bundestag am 2.Dezember 1998 erklärte „Grundprinzip“, hat Eingang in die Ausbildungsverordnungen gefunden - und zwar schon ein Jahrzehnt zuvor bei der Neuordnung der Metall- und Elektroberufe 1987. Dennoch ist diese Forderung heute vielgenannt und Thema in der aktuellen Diskussion über die berufliche Erstausbildung im Dualen System. Eine gewichtige Frage dabei ist die, wie und ob eine berufliche Erstausbildung im Rahmen des Dualen Systems dem genannten Grundprinzip gerecht werden kann und es möglich ist, Handlungskompetenz zu vermitteln. Die Handlungskompetenz soll den jungen Auszubildenden so vermittelt werden, dass sie befähigt werden, im sich stetig wandelnden Berufsleben und in der modernen Gesellschaft zu bestehen. Die Berufsausbildung nimmt dabei eine Schlüsselrolle ein, starten doch mehr als zwei Drittel aller jungen Menschen eines Jahrgangs eine Ausbildung im dualen System der Berufsausbildung. Dabei sollen sie Qualifikationen erwerben, die sie auf die Herausforderungen der modernen Zeit vorbereiten. Doch wie soll das in der praktischen Ausgestaltung umgesetzt und erreicht werden? Die in der beruflichen Erstausbildung zum Einsatz kommenden Methoden werden in der berufs-und betriebspädagogischen Diskussion fortwährend danach beurteilt und in Forschungsprojekten untersucht. Handlungsorientierte Ausbildungskonzepte und Methoden gibt es viele: Gruppenarbeit, Lerninsel, Projektmethode bzw. -orientierung, Selbstlernübungen - diese Auflistung ließe sich noch fortführen. Aber welche dieser Methoden werden in der berufsschulischen und betrieblichen Erstausbildung angewendet und in welchem Maße vermitteln sie überhaupt Handlungskompetenz? Diese Arbeit soll versuchen der Beantwortung dieser Frage näher zu kommen, indem im Rahmen des empirischen Teils die an der Ausbildung Beteiligten zu diesem Thema Stellung beziehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Zum Thema
- 1.1 Ziel der Arbeit
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2 Das Konzept der beruflichen Handlungskompetenz
- 2.1 Das Paradigma „Kompetenz“
- 2.2 Die Herleitung des Kompetenzbegriffes und Arbeitsdefinition
- 2.3 Kompetenzaspekte
- 2.3.1 Fachkompetenz
- 2.3.2 Personalkompetenz
- 2.3.3 Sozialkompetenz
- 2.3.4 Methodenkompetenz
- 2.3.5 Weitere Kompetenzaspekte
- 2.3.5.1 Kommunikative Kompetenz
- 2.3.5.2 Selbstkompetenz
- 2.3.5.3 Medienkompetenz
- 2.4 Berufliche Handlungskompetenz
- 2.4.1 Begriffsbestimmung und Modelle in der pädagogischen Praxis
- 2.4.1.1 Handlungskompetenz-Modell nach Faix/Laier
- 2.4.1.2 Handlungskompetenz-Modell nach Hülshoff
- 2.4.1.3 Das Handlungskompetenz-Modell nach Münch
- 2.4.1.4 Das Handlungskompetenz-Modell nach Zimmer
- 2.4.1.5 Zusammenfassung der Handlungskompetenz-Modelle
- 2.4.2 Methoden zur Vermittlung von Handlungskompetenz
- 2.4.2.1 Traditionelle Unterrichtungsmethoden
- 2.4.2.2 Die Leittext-Methode
- 2.4.2.3 Die Projektmethode
- 2.4.2.4 Die Gruppenarbeit
- 2.4.2.5 Die Lerninsel
- 2.5 Fazit
- 3 Die Berufsausbildung zum/zur Mechatroniker/-in im Dualen System
- 3.1 Das duale System der Berufsausbildung
- 3.1.1 Charakteristika des Dualen Systems
- 3.1.1.1 Historische Entwicklung
- 3.1.1.2 Die gesetzlichen Grundlagen der Berufsausbildung
- 3.1.1.3 Funktionen des Dualen Systems
- 3.1.1.4 Dualitäten des dualen Berufsbildungssystems
- 3.1.2 Lernorte im Dualen System
- 3.1.2.1 Der Lernort Berufsschule
- 3.1.2.2 Der Lernort Betrieb
- 3.1.2.3 Lernortkooperation
- 3.2 Die Neuordnung der Berufsausbildung zum/zur Mechatroniker/-in – Abgrenzung zu herkömmlichen Berufsbildern
- 3.2.1 Die Entwicklung zum neuen Ausbildungsberuf
- 3.2.2 Abgrenzung und qualitative Veränderungen
- 3.2.2.1 Industriemechaniker
- 3.2.2.2 Industrieelektroniker
- 3.2.2.3 Fachinformatiker
- 3.2.3 Lernfeldkonzeption
- 3.3 Fazit
- 4 Konzeption und Ausbildungssituation in Betrieb und Berufsschule und deren Entwicklung seit Ausbildungsbeginn 1998
- 4.1 Das Ausbildungsprofil der Berufsausbildung zum/zur Mechatroniker/-in
- 4.2 Die Verordnung über die Berufsausbildung zum/zur Mechatroniker/-in
- 4.3 Der Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Mechatroniker/ Mechatronikerin
- 4.4 Die Entwicklung der Berufsausbildung zum/zur Mechatroniker/-in seit 1998 in der Bundesrepublik Deutschland
- 4.5 Fazit
- 5 Umsetzung in der Praxis – eine empirische Erhebung zur Vermittlung von Handlungskompetenz in Schule und Betrieb
- 5.1 Methodik und Vorgehensweise
- 5.2 Fragestellungen und Untersuchungsdesign
- 5.2.1 Forschungsansatz und Erhebungsmethoden
- 5.2.2 Die Fragebogengestaltung
- 5.3 Fazit
- 6 Zentrale Ergebnisse der empirischen Befragung
- 6.1 Beschreibung der Stichproben
- 6.2 Ergebnisse der Untersuchung
- 6.2.1 Die Vermittlung von Handlungskompetenz in der betrieblichen Erstausbildung zum/zur Mechatroniker/-in
- 6.2.2 Die Vermittlung von Handlungskompetenz in der berufsschulischen Ausbildung zum/zur Mechatroniker/-in
- 6.2.3 Gestaltung von Ausbildungssituationen in Betrieb und Berufsschule
- 6.2.4 Verteilung der Handlungskompetenz auf die Lernorte
- 7 Resümee der Arbeit und Forderungen an die Praxis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Umsetzung der Forderung nach der Vermittlung von Handlungskompetenz in der Berufsausbildung zum Mechatroniker. Sie analysiert die Unterschiede zwischen traditioneller und handlungsorientierter Ausbildung und bewertet die Effektivität verschiedener Methoden.
- Analyse des Kompetenzbegriffes und verschiedener Kompetenzmodelle
- Untersuchung der Methoden zur Vermittlung von Handlungskompetenz
- Bewertung der Ausbildungssituation in Betrieb und Berufsschule
- Empirische Erhebung zur Handlungskompetenzvermittlung bei Mechatronikern
- Formulierung von Forderungen zur Verbesserung der Ausbildungspraxis
Zusammenfassung der Kapitel
1 Zum Thema: Dieses Kapitel führt in das Thema ein und beschreibt das Ziel der Arbeit: die Untersuchung der Vermittlung von Handlungskompetenz in der Ausbildung zum Mechatroniker. Es wird die Bedeutung von Handlungskompetenz im Kontext des sich verändernden Arbeitsmarktes hervorgehoben und der Aufbau der Arbeit skizziert.
2 Das Konzept der beruflichen Handlungskompetenz: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Kompetenz“ und differenziert ihn von verwandten Begriffen wie Qualifikation. Es werden verschiedene Kompetenzmodelle vorgestellt, die den multidimensionalen Charakter von Handlungskompetenz aufzeigen. Die Bedeutung von Fach-, Methoden-, Sozial- und Personalkompetenz wird detailliert erläutert, gefolgt von einer Diskussion verschiedener Methoden zur Vermittlung dieser Kompetenzen.
3 Die Berufsausbildung zum/zur Mechatroniker/-in im Dualen System: Dieses Kapitel beschreibt das duale System der Berufsausbildung in Deutschland, seine historische Entwicklung und seine aktuellen Herausforderungen. Es analysiert die Rolle von Betrieb und Berufsschule als Lernorte und die Bedeutung der Lernortkooperation. Die Neuordnung der Berufsausbildung zum Mechatroniker wird im Kontext der traditionellen Berufe Industriemechaniker, Industrieelektroniker und Fachinformatiker dargestellt.
4 Konzeption und Ausbildungssituation in Betrieb und Berufsschule und deren Entwicklung seit Ausbildungsbeginn 1998: Dieses Kapitel beschreibt detailliert das Ausbildungsprofil des Mechatronikers, die Ausbildungsordnung und den Rahmenlehrplan. Es analysiert die Entwicklung der Ausbildungszahlen seit 1998 und bewertet den Erfolg des neuen Berufsbildes. Die Lernfeldkonzeption wird im Detail erläutert und ihre Bedeutung für die Vermittlung von Handlungskompetenz hervorgehoben.
5 Umsetzung in der Praxis – eine empirische Erhebung zur Vermittlung von Handlungskompetenz in Schule und Betrieb: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik und Vorgehensweise der empirischen Erhebung, die mittels eines teilstandardisierten Fragebogens durchgeführt wurde. Es erläutert den Forschungsansatz und die verwendeten Erhebungsmethoden (qualitative und quantitative Ansätze), sowie die Gestaltung des Fragebogens.
6 Zentrale Ergebnisse der empirischen Befragung: Dieses Kapitel präsentiert und interpretiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Es analysiert die Einschätzungen von Ausbildern, Auszubildenden, Lehrern und Schülern zur Vermittlung von Handlungskompetenz in Betrieb und Berufsschule, sowie die angewendeten Methoden und die Gestaltung der Ausbildungssituationen.
Schlüsselwörter
Handlungskompetenz, Kompetenzmodelle, duale Berufsausbildung, Mechatroniker, Lernortkooperation, Ausbildungsmethoden, empirische Untersuchung, Lernfeldkonzeption, Betrieb, Berufsschule, Qualitätsmanagement, selbständiges Lernen, Praxisbezug.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Handlungskompetenz in der Mechatroniker-Ausbildung
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Vermittlung von Handlungskompetenz in der Berufsausbildung zum Mechatroniker. Sie analysiert die Unterschiede zwischen traditioneller und handlungsorientierter Ausbildung und bewertet die Effektivität verschiedener Methoden. Ein Schwerpunkt liegt auf der empirischen Erhebung der Handlungskompetenzvermittlung in Betrieb und Berufsschule.
Welche Kompetenzmodelle werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt und vergleicht verschiedene Kompetenzmodelle (z.B. Faix/Laier, Hülshoff, Münch, Zimmer), um den multidimensionalen Charakter von Handlungskompetenz aufzuzeigen. Die Bedeutung von Fach-, Methoden-, Sozial- und Personalkompetenz wird detailliert erläutert.
Welche Methoden zur Vermittlung von Handlungskompetenz werden untersucht?
Die Arbeit untersucht sowohl traditionelle Unterrichstmethoden als auch handlungsorientierte Ansätze wie die Leittext-Methode, die Projektmethode, die Gruppenarbeit und die Lerninsel. Die Effektivität dieser Methoden wird im Kontext der Mechatroniker-Ausbildung analysiert.
Wie ist das duale System der Berufsausbildung dargestellt?
Die Arbeit beschreibt das duale System der Berufsausbildung in Deutschland, seine historische Entwicklung, seine gesetzlichen Grundlagen und seine Funktionen. Die Rolle von Betrieb und Berufsschule als Lernorte und die Bedeutung der Lernortkooperation werden ausführlich behandelt.
Wie wird die Berufsausbildung zum Mechatroniker im Detail beschrieben?
Die Arbeit analysiert die Neuordnung der Berufsausbildung zum Mechatroniker, setzt sie in Relation zu traditionellen Berufen (Industriemechaniker, Industrieelektroniker, Fachinformatiker) und beschreibt das Ausbildungsprofil, die Ausbildungsordnung, den Rahmenlehrplan und die Lernfeldkonzeption.
Welche empirische Methode wurde verwendet?
Die Arbeit basiert auf einer empirischen Erhebung mittels eines teilstandardisierten Fragebogens. Es wurden qualitative und quantitative Ansätze kombiniert, um die Einschätzungen von Ausbildern, Auszubildenden, Lehrern und Schülern zur Handlungskompetenzvermittlung zu erfassen.
Welche Ergebnisse liefert die empirische Untersuchung?
Die Ergebnisse der Befragung analysieren die Vermittlung von Handlungskompetenz in Betrieb und Berufsschule, die angewendeten Methoden und die Gestaltung der Ausbildungssituationen. Die Verteilung der Handlungskompetenz auf die Lernorte wird ebenfalls untersucht.
Welche Schlussfolgerungen und Forderungen werden formuliert?
Die Arbeit schließt mit einem Resümee und formuliert Forderungen an die Praxis zur Verbesserung der Handlungskompetenzvermittlung in der Mechatroniker-Ausbildung. Diese basieren auf den Ergebnissen der empirischen Untersuchung und der theoretischen Analyse.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Handlungskompetenz, Kompetenzmodelle, duale Berufsausbildung, Mechatroniker, Lernortkooperation, Ausbildungsmethoden, empirische Untersuchung, Lernfeldkonzeption, Betrieb, Berufsschule, Qualitätsmanagement, selbständiges Lernen, Praxisbezug.
- Citar trabajo
- Maik Teichgräber (Autor), Jens Ritter (Autor), 2005, Handlungskompetenz in der Erstausbildung. Die Berufsausbildung zum Mechatroniker, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49146