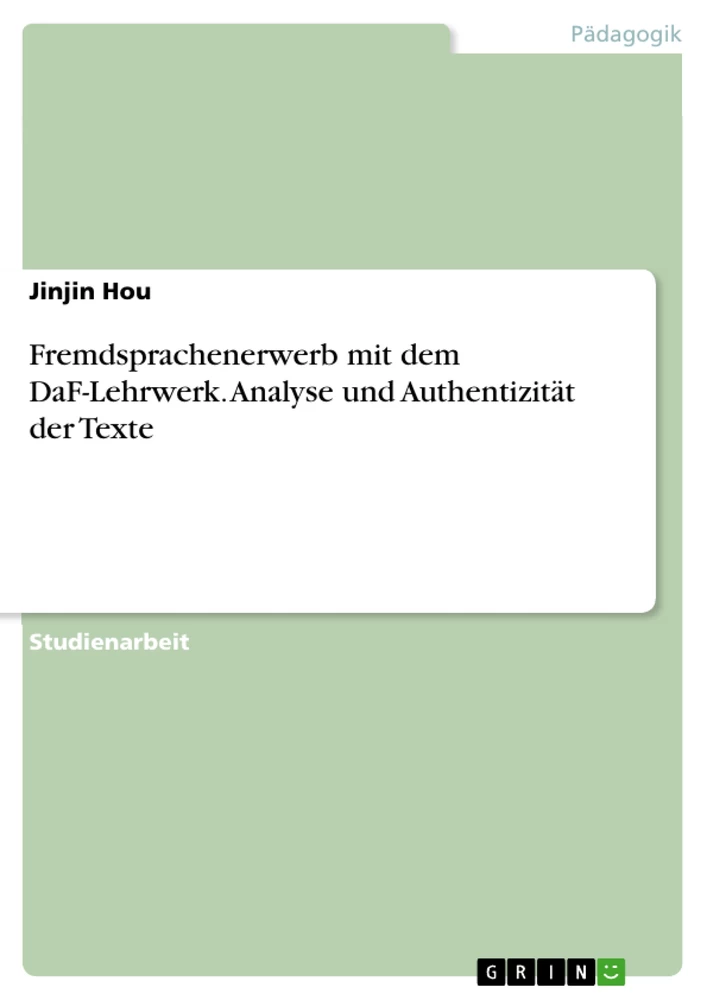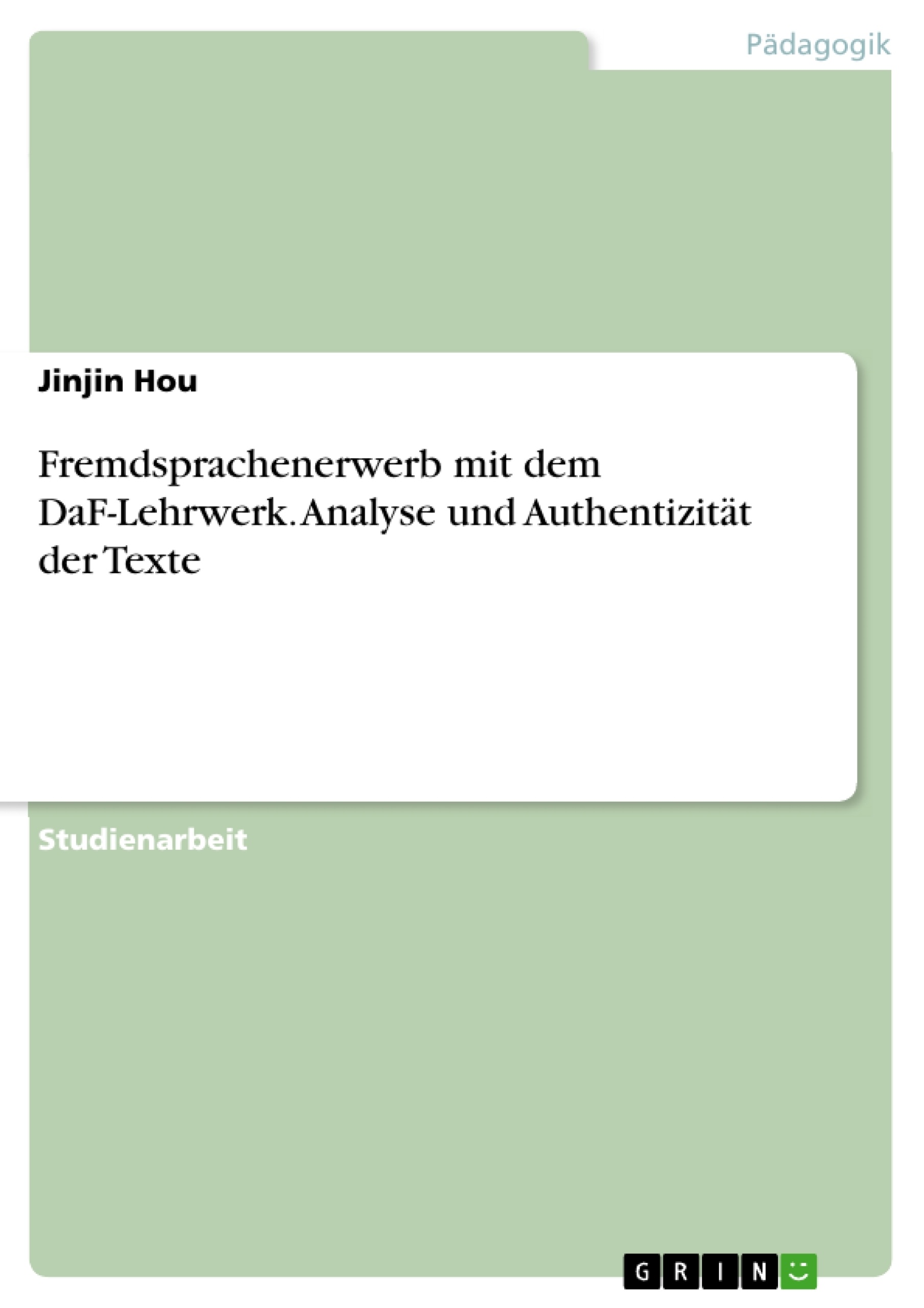In der Arbeit werden zunächst die Grundbegriffen Text und Textsorte definiert. Anschließend wird das analysierte Lehrwerk "DaF kompakt B1" vorgestellt. Der Schwerpunkt wird auf die Textsorten und die dazugehörigen Lernziele, die Übungen nach dem vierstufigen Verfahren der Übungstypologie, die Authentizität nach den Kriterien von Edelhoff und die steile, lineare und grammatische Progression gelegt.
Text ist eine der fundamentalen Größen sprachlicher Kommunikation. Der Sprachunterricht wird aus linguistischer Sicht als ein inter-textuelles Phänomen interpretiert, das sich in verschiedenen Ausprägungen darstellt. Der Lehr- und Lernprozess hat im engeren Sinne einen großen Zusammenhang mit dem Input von Texten und Textprodukten. Deshalb soll die Arbeit mit Texten eine zentrale Rolle beim Fremdsprachenerwerb spielen. In einem Lehrwerk gelten die Texte als das elementare und anschauliche Material, welche Informationen vom Zielland liefern, sprachliche Mittel wie Wortschatz und Grammatik präsentieren und Fertigkeiten entwickeln. Mithilfe von Texten kann man sich unter anderem auch eigene Gedanken machen, kommunikative Kompetenzen trainieren, ästhetisch lernen und die eigene Persönlichkeit sowie Charakter bilden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Bestimmung der Grundbegriffe
- 2.1. Text und Textsorten
- 2.1.1. Text
- 2.1.2. Textsorten
- 2.2. Aufgaben und Übungen zu Texten in DaF-Lehrwerken
- 2.3. Authentizität und Progression
- 2.3.1. Authentizität
- 2.3.2. Progression
- 2.1. Text und Textsorten
- 3. DaF kompakt B1
- 3.1. Vorstellung des ausgewählten Lehrwerks
- 3.2. Analyse der Didaktisierung von Lesetexten
- 3.2.1. Allgemeine Analyse zu Texten und Textsorten
- 3.2.2. Analyse von Aufgaben und Übungen
- 3.2.3. Analyse von Authentizität und Progression
- 3.2.3.1. Analyse von Authentizität
- 3.2.3.2. Analyse von Progression
- 4. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Texte und Übungen im DaF-Lehrwerk „DaF kompakt B1“. Ziel ist es, die didaktische Gestaltung der Lesetexte hinsichtlich Textsorten, Aufgaben, Authentizität und Progression zu untersuchen und deren Eignung für Lerner auf B1-Niveau zu bewerten.
- Analyse verschiedener Textdefinitionen und Textsorten im Kontext des DaF-Unterrichts
- Untersuchung der didaktischen Gestaltung von Aufgaben und Übungen zu Lesetexten
- Bewertung der Authentizität der im Lehrwerk verwendeten Texte
- Analyse der Progression der Texte im Lehrwerk hinsichtlich Schwierigkeit und Komplexität
- Bewertung der Gesamtkonzeption des Lehrwerks im Hinblick auf die Förderung des Leseverstehens
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Textanalyse im DaF-Unterricht ein und begründet die Wahl des Lehrwerks „DaF kompakt B1“ für die Analyse. Sie betont die zentrale Rolle von Texten im Fremdsprachenerwerb und skizziert den Aufbau der Arbeit.
2. Bestimmung der Grundbegriffe: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Analyse. Es definiert den Begriff „Text“ aus verschiedenen linguistischen und didaktischen Perspektiven und beleuchtet die Bedeutung von Textsorten im DaF-Unterricht. Es werden unterschiedliche Definitionen von "Text" aus der Linguistik und der Deutsch als Fremdsprache Didaktik vorgestellt, und die verschiedenen Kriterien zur Einordnung von Texten werden diskutiert. Die Bedeutung von Textsorten und ihre Rolle im Fremdsprachunterricht wird ebenfalls ausführlich behandelt, mit Beispielen für verschiedene Textsorten, sowohl schriftlich als auch mündlich. Der Kapitel schließt mit einer Diskussion über die Verknüpfung von verschiedenen Textsorten und Lernzielen im Unterricht.
Häufig gestellte Fragen zu "DaF kompakt B1" - Textanalyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das DaF-Lehrwerk „DaF kompakt B1“, insbesondere die didaktische Gestaltung der Lesetexte. Im Fokus stehen Textsorten, Aufgaben, Authentizität und Progression der Texte und deren Eignung für Lerner auf B1-Niveau.
Welche Aspekte der Lesetexte werden untersucht?
Die Analyse umfasst verschiedene Textdefinitionen und Textsorten, die didaktische Gestaltung der dazugehörigen Aufgaben und Übungen, die Authentizität der verwendeten Texte und die Progression der Texte hinsichtlich Schwierigkeit und Komplexität. Die Gesamtkonzeption des Lehrwerks im Hinblick auf die Förderung des Leseverstehens wird ebenfalls bewertet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zur Bestimmung der Grundbegriffe (Text, Textsorten, Authentizität, Progression), ein Kapitel zur Analyse von „DaF kompakt B1“ (inkl. detaillierter Analyse der Lesetexte und Aufgaben) und eine Zusammenfassung. Jedes Kapitel beinhaltet Unterkapitel, die die einzelnen Aspekte der Analyse vertiefen.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Kapitel 2 legt die theoretischen Grundlagen der Analyse dar. Es werden verschiedene linguistische und didaktische Perspektiven auf den Begriff „Text“ und die Bedeutung von Textsorten im DaF-Unterricht beleuchtet. Unterschiedliche Definitionen von "Text" und Kriterien zur Einordnung von Texten werden diskutiert, ebenso die Rolle von Textsorten im Fremdsprachunterricht mit Beispielen für verschiedene Textsorten.
Wie wird die Authentizität der Texte bewertet?
Die Arbeit analysiert die Authentizität der in „DaF kompakt B1“ verwendeten Texte als einen wichtigen Aspekt der didaktischen Gestaltung. Die Bewertungskriterien werden im Laufe der Analyse erläutert und angewendet.
Wie wird die Progression der Texte analysiert?
Die Analyse der Progression untersucht die Steigerung der Schwierigkeit und Komplexität der Texte im Lehrwerk. Es werden Kriterien vorgestellt, anhand derer die Progression der Texte im Lehrwerk bewertet wird.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die didaktische Gestaltung der Lesetexte in „DaF kompakt B1“ zu untersuchen und deren Eignung für Lerner auf B1-Niveau zu bewerten. Die Analyse soll Erkenntnisse darüber liefern, wie effektiv das Lehrwerk das Leseverstehen fördert.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden angeboten?
Die Arbeit bietet Zusammenfassungen für jedes Kapitel, beginnend mit der Einleitung, welche das Thema einführt und die Wahl des Lehrwerks begründet. Kapitel 2 beschreibt die theoretischen Grundlagen, Kapitel 3 präsentiert die Analyse von "DaF kompakt B1", und Kapitel 4 bietet eine abschließende Zusammenfassung der Ergebnisse.
- Citation du texte
- Jinjin Hou (Auteur), 2019, Fremdsprachenerwerb mit dem DaF-Lehrwerk. Analyse und Authentizität der Texte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/491636