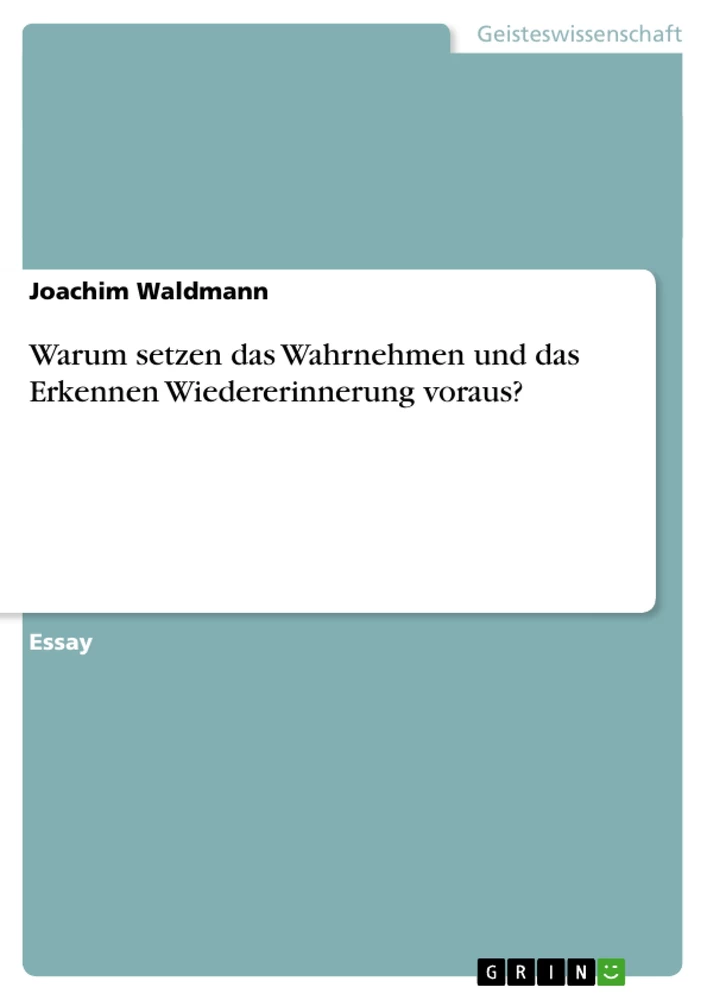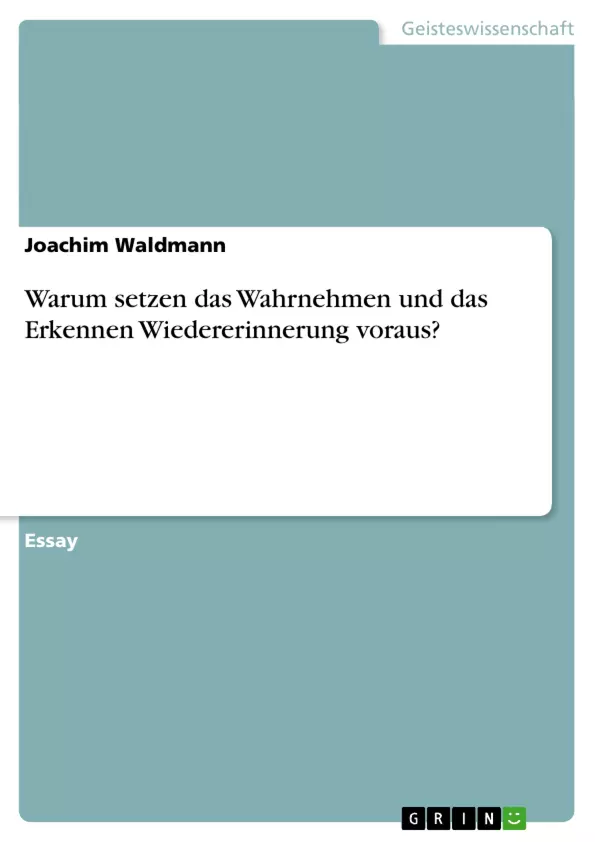„Lernen [ist] nichts anderes […]als Wiedererinnerung“. Diese These – von Kebes vorgetragen, der damit aber nur eine von Sokrates häufig geäußerte Ansicht wiedergibt – leitet den zweiten Beweis für die Unsterblichkeit der Seele im 'Phaidon' ein.
Der Begriff des Lernens lässt sich definieren als die Aneignung von Kenntnissen und Fähigkeiten, als die Änderung von Denken, Einstellungen und Verhaltensweisen aufgrund von Einsicht oder Erfahrung. Bedingung der Möglichkeit zu lernen ist somit zuallererst die Wahrnehmung der Umwelt. Darauf folgen muss ein Verknüpfen mit Bekanntem (Erfahrung) und das Erkennen von Regelmäßigkeiten. Wahrnehmen und Erkennen sind zwei Aspekte des Lernens.
Warum aber setzen das Wahrnehmen und das Erkennen und somit das Lernen Wiedererinnerung voraus?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der zweite Beweis für die Unsterblichkeit der Seele (72e-76d)
- Zwischenbemerkung
- Zwischenbemerkungen
- Schlussbemerkung – Kritische Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay befasst sich mit der Frage, warum Wahrnehmen und Erkennen Wiedererinnerung voraussetzen, und beleuchtet dies anhand des zweiten Beweises für die Unsterblichkeit der Seele im Phaidon.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs "Lernen" im Kontext von Wahrnehmen und Erkennen
- Analyse des zweiten Beweises für die Unsterblichkeit der Seele im Phaidon, insbesondere die Rolle der Wiedererinnerung
- Untersuchung des Verhältnisses von Ähnlichkeit und Unähnlichkeit im Prozess der Wiedererinnerung
- Die Verbindung zwischen Wiedererinnerung und der platonischen Ideenlehre, insbesondere das Verhältnis von Weltding und Idee
- Der Beweis für die seelische Präexistenz und die Rolle der sinnlichen Wahrnehmung im Wiedererinnerungsprozess
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Der Essay beginnt mit der Darstellung von Kebes' These, dass Lernen nichts anderes sei als Wiedererinnerung. Diese These bildet den Ausgangspunkt für den zweiten Beweis für die Unsterblichkeit der Seele im Phaidon.
Der zweite Beweis für die Unsterblichkeit der Seele (72e-76d)
Sokrates legt dar, dass die Wahrnehmung eines Gegenstandes, die neben der durch die Wahrnehmung entstandenen Vorstellung eine weitere, nicht identische Vorstellung hervorruft, als Erinnerung zu betrachten ist. Die Erinnerung entsteht durch die Beziehung von Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit zwischen den Wahrgenommenen und den Erinnerten.
Zwischenbemerkung
Der Autor äußert Kritik an Platons Argumentation, dass sich die Erinnerung auf Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit stützt. Die Kritik bezieht sich auf die Behauptung, dass sich die Erinnerung aus der Unähnlichkeit zwischen den Gegenständen ergibt, ohne dass die Ursache für die Assoziation berücksichtigt wird.
Zwischenbemerkungen
Der Autor analysiert die Argumentation Platons, dass die Erkenntnis von Ideen durch die Wahrnehmung gleichender Weltliches Ding erfolgt. Es stellt sich die Frage, ob man durch empirische Beobachtungen Ideen „erhält“, was die seelische Präexistenz in Frage stellen würde. Alternativ wird vorgeschlagen, dass die Ideen schon in der Seele lagern, sich aber außerhalb des Bewusstseins befinden, und durch die Wahrnehmung sinnlicher Gegenstände wieder ins Bewusstsein gerufen werden.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen und Begriffe dieses Essays umfassen: Lernen, Wahrnehmen, Erkennen, Wiedererinnerung, Seele, Unsterblichkeit, Platon, Phaidon, Ideenlehre, Ähnlichkeit, Unähnlichkeit, Weltliches Ding, Idee, seelische Präexistenz, sinnliche Wahrnehmung.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt Platons These "Lernen ist Wiedererinnerung"?
Platon argumentiert im 'Phaidon', dass die Seele bereits vor der Geburt Wissen über die Ideen besaß und dass das, was wir als Lernen bezeichnen, das Wiedererinnern (Anamnesis) dieses vergessenen Wissens ist.
Warum ist die sinnliche Wahrnehmung laut Platon wichtig?
Die sinnliche Wahrnehmung von unvollkommenen Gegenständen in der Welt dient als Auslöser, um die Seele an die vollkommenen Ideen zu erinnern, denen diese Gegenstände ähneln.
Was ist der Unterschied zwischen Ähnlichkeit und Unähnlichkeit beim Erinnern?
Erinnerung kann durch Ähnlichkeit (ein Bild erinnert an die Person) oder Unähnlichkeit (ein Gegenstand erinnert an seinen Besitzer) entstehen. Platon nutzt dies, um den Übergang vom Weltding zur Idee zu erklären.
Wie beweist die Wiedererinnerung die Unsterblichkeit der Seele?
Wenn wir Wissen besitzen, das wir nicht in diesem Leben erworben haben können (wie die Idee des "Gleichen an sich"), muss die Seele bereits vor der Geburt existiert haben.
Was ist ein "Scheinproblem" im Kontext des Lernens?
Die Arbeit diskutiert kritisch, ob wir Ideen durch Erfahrung "erhalten" oder ob sie bereits latent in der Seele vorhanden sind, was die Frage nach der seelischen Präexistenz aufwirft.
Welche Rolle spielt die Ideenlehre in diesem Essay?
Die Ideenlehre ist das Fundament: Nur weil es absolute, unveränderliche Ideen gibt, kann die Seele durch die Wahrnehmung veränderlicher Dinge zu wahrem Wissen zurückfinden.
- Citation du texte
- Joachim Waldmann (Auteur), 2005, Warum setzen das Wahrnehmen und das Erkennen Wiedererinnerung voraus?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49192