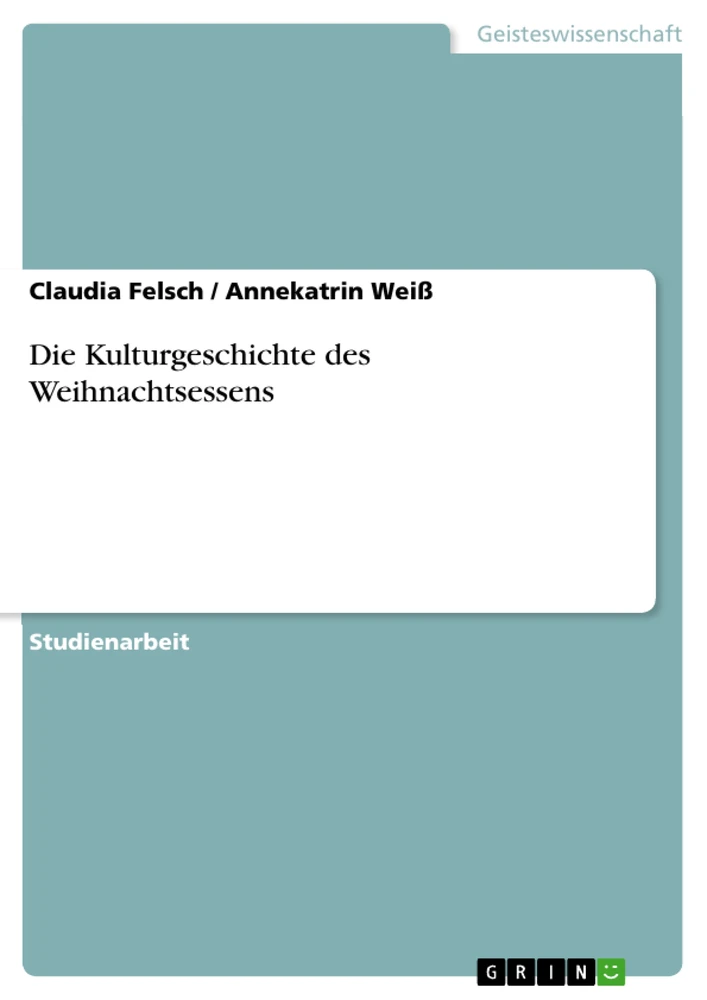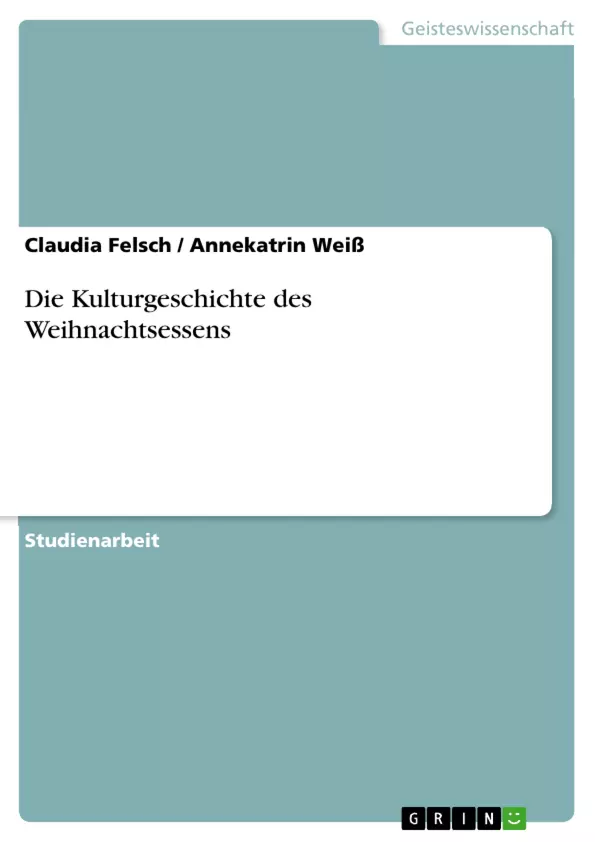Mit dem Begriff Fest assoziiert man im alltäglichen Sinne etwas Besonderes, ein positiver Anlass, gemeinsam mit Bekannten und Freunden zusammen zu sein. Aufgrund von individuellen Erfahrungen verbindet jeder Mensch verschiedene Vorstellungen mit einem Fest. Eines jedoch darf selten fehlen: das Festmahl, wie Helga Maria Wolf kurz und bündig schreibt: „Kein Fest ohne Mahl.“ In diesem Zusammenhang stellt Ingeborg Weber-Kellermann ein Paradebeispiel heraus:
„Wenn man von Weihnachten spricht, dann erwacht für viele als erstes die Assoziation zu gutem Essen. Es riecht zugleich nach Gänsebraten und Pfefferkuchen. Tatsächlich ist das gemeinsame gute Essen und Trinken wohl das älteste soziale Element jeder großen Festzeit.“ Ebenso widmet sich Nina Gockerell dieser Thematik und scheint Weber-Kellermanns Annahmen in ihrer Abhandlung „Weihnachtszeit. Feste zwischen Advent und Neujahr in Süddeutschland und Österreich 1840-1940“ zu bestätigen: „Da von allen Kulturgütern die eßbaren am vergänglichsten sind, kommt derlei Materialien – neben Rezepten und schriftlich erinnerten Genüssen – eine wichtige Rolle als Zeugnis dieses unvegeßlichen Anteils am weihnachtlichen Geschehen zu.“
Das Festtagsmahl und dessen Zutaten - Welche Bedeutung hatte es in früheren Zeiten? Findet man Parallelen zur heutigen Symbolik der festlichen Speisen? Ändert sich im Strom der Geschichte auch der weihnachtliche Speiseplan? Oder findet man Indizien für Überlieferung und Traditionsbewusstsein? Was ist von der ursprünglichen Bedeutung dieser Genüsse heute noch erkennbar?
Zur Klärung dieser Fragen soll die vorliegende Arbeit einen Einblick in die Kulturgeschichte des Weihnachtsessens geben, wobei hierfür Personen zum selbigen Thema befragt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Empirischer Zugang
- Forschungsgegenstand
- Forschungsfragen
- Methodisches Vorgehen
- Weihnachtsessen
- Ministudie
- Auswertung
- Gebildegebäcke
- Lebkuchen
- Stollen
- Spekulatius
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Kulturgeschichte des weihnachtlichen Essens in Deutschland. Ziel ist es, die Bedeutung und Symbolik des Weihnachtsessens im Wandel der Zeit zu beleuchten und traditionelle Aspekte mit modernen Praktiken zu vergleichen. Dazu werden sowohl literarische Quellen als auch empirische Daten aus einer kleinen Studie herangezogen.
- Die Entwicklung des weihnachtlichen Speiseplans im Laufe der Geschichte.
- Die Bedeutung und Symbolik von traditionellen Weihnachtsgerichten.
- Der Vergleich traditioneller und moderner weihnachtlicher Essgewohnheiten.
- Die Rolle der Weihnachtsbäckerei im Kontext des Weihnachtsfestes.
- Die Ergebnisse einer kleinen empirischen Studie zum weihnachtlichen Essverhalten.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentrale Frage nach der Bedeutung des Essens im Kontext des Weihnachtsfestes. Sie verweist auf die Relevanz des Festmahls als integraler Bestandteil von Festlichkeiten und zitiert verschiedene Autorinnen, die die starke Assoziation zwischen Weihnachten und gutem Essen betonen. Die Arbeit kündigt eine kulturgeschichtliche Analyse des Weihnachtsessens an, die auf Literaturrecherche und empirischen Daten basiert.
Empirischer Zugang: Dieses Kapitel beschreibt die methodischen Grundlagen der Arbeit. Es definiert den Forschungsgegenstand (Weihnachtsessen in Deutschland) und die Forschungsfragen (Gibt es ein typisches Weihnachtsessen? Welche Bedeutung hat das Weihnachtsgebäck?). Das methodische Vorgehen basiert auf Interviews, wobei die Autoren die Limitationen der kleinen Stichprobengröße im Hinblick auf die Generalisierbarkeit der Ergebnisse betonen.
Weihnachtsessen: Dieses Kapitel behandelt theoretische Grundlagen des weihnachtlichen Essens. Es bezieht sich auf die historische Tradition, ein besonders üppiges Essen an hohen Festtagen zu servieren, und diskutiert die Frage, warum der Heiligabend in manchen Familien nicht als Teil des zentralen Festessens betrachtet wird. Das Kapitel legt den Grundstein für die anschließende Auswertung der empirischen Daten.
Auswertung: Dieses Kapitel analysiert die Ergebnisse der durchgeführten Ministudie und konzentriert sich auf verschiedene Arten von weihnachtlichem Gebäck (Gebildegebäcke, Lebkuchen, Stollen, Spekulatius). Es untersucht die Bedeutung dieser Backwaren im Kontext des Weihnachtsfestes und setzt diese im Kontext der zuvor etablierten theoretischen Grundlagen. Die Analyse der empirischen Daten erfolgt im Lichte der Literaturrecherche.
Schlüsselwörter
Weihnachtsessen, Weihnachtskultur, Festmahl, Tradition, Kulturgeschichte, Weihnachtsbäckerei, Empirische Studie, Deutschland, Symbole, Brauchtum.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Weihnachtliches Essen in Deutschland"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Kulturgeschichte des weihnachtlichen Essens in Deutschland. Sie beleuchtet die Bedeutung und Symbolik des Weihnachtsessens im Wandel der Zeit und vergleicht traditionelle Aspekte mit modernen Praktiken.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Entwicklung des weihnachtlichen Speiseplans im Laufe der Geschichte zu analysieren, die Bedeutung traditioneller Weihnachtsgerichte zu untersuchen, traditionelle und moderne Essgewohnheiten zu vergleichen, die Rolle der Weihnachtsbäckerei zu betrachten und die Ergebnisse einer kleinen empirischen Studie zum weihnachtlichen Essverhalten auszuwerten.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit basiert auf einer Literaturrecherche und einer kleinen empirischen Studie. Die empirische Untersuchung stützt sich auf Interviews, wobei die Autoren die Limitationen der kleinen Stichprobengröße im Hinblick auf die Generalisierbarkeit der Ergebnisse betonen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des weihnachtlichen Speiseplans, die Symbolik traditioneller Gerichte, den Vergleich traditioneller und moderner Essgewohnheiten, die Bedeutung der Weihnachtsbäckerei (Gebildegebäcke, Lebkuchen, Stollen, Spekulatius) und die Auswertung einer Ministudie zum weihnachtlichen Essverhalten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum empirischen Zugang (Forschungsgegenstand, Forschungsfragen, methodisches Vorgehen), ein Kapitel zum Weihnachtsessen, ein Kapitel zur Auswertung der Ministudie und ein Fazit.
Welche Ergebnisse liefert die Auswertung der Ministudie?
Die Auswertung konzentriert sich auf verschiedene Arten von weihnachtlichem Gebäck (Gebildegebäcke, Lebkuchen, Stollen, Spekulatius) und untersucht deren Bedeutung im Kontext des Weihnachtsfestes. Die Analyse der empirischen Daten erfolgt im Lichte der Literaturrecherche.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Weihnachtsessen, Weihnachtskultur, Festmahl, Tradition, Kulturgeschichte, Weihnachtsbäckerei, Empirische Studie, Deutschland, Symbole, Brauchtum.
Wo finde ich einen Überblick über den Inhalt?
Das Dokument enthält ein Inhaltsverzeichnis, das die einzelnen Kapitel und Unterkapitel auflistet. Zusätzlich werden die Zielsetzung und Themenschwerpunkte sowie Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel bereitgestellt.
Welche Einschränkungen weist die empirische Studie auf?
Die Autoren betonen die Limitationen der kleinen Stichprobengröße der empirischen Studie im Hinblick auf die Generalisierbarkeit der Ergebnisse.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf literarische Quellen und empirische Daten aus einer kleinen Studie. Die genauen Quellen sind im vollständigen Text der Arbeit aufgeführt (nicht in diesem Preview).
- Citation du texte
- Claudia Felsch (Auteur), Annekatrin Weiß (Auteur), 2005, Die Kulturgeschichte des Weihnachtsessens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49210