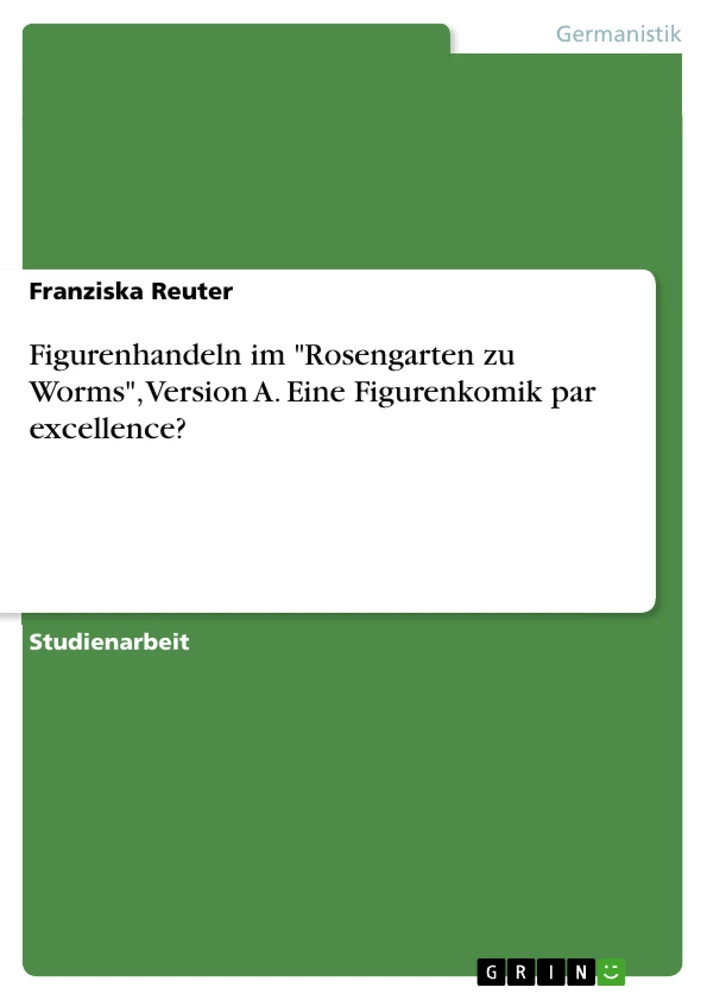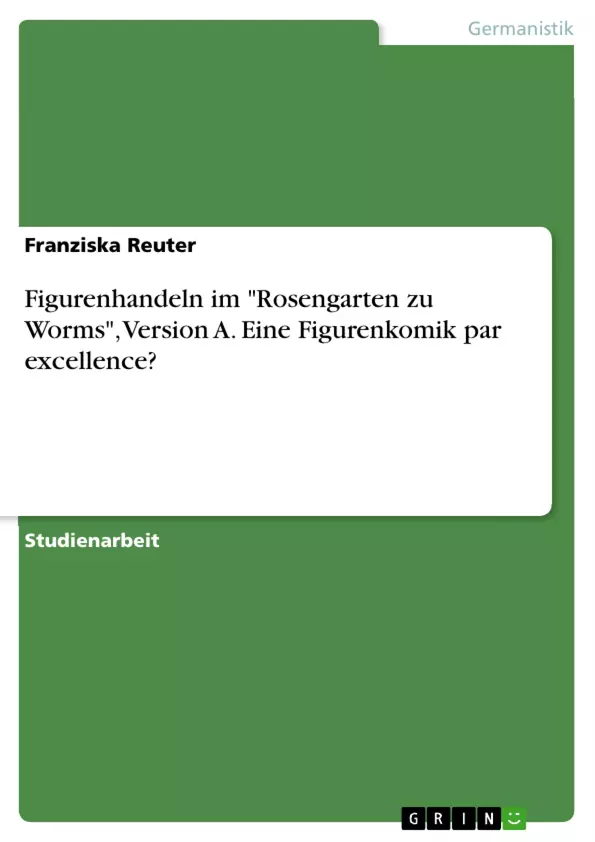Ich möchte in dieser Hausarbeit das Figurenhandeln im "Rosengarten" A mit dem Fokus auf der Figurenkomik ausgewählter Figuren analysieren.
Unter aventiurehafter Dietrichepik ist eine schriftliterarische Gattung zu Zeiten des Mittelalters zu verstehen. Gegenstand dieser Gattung sind die Aventiuren Dietrichs von Bern, die meist Kämpfe gegen Zwerge, Riesen und anderen Helden beinhalten. Der "Rosengarten", oder auch "Rosengarten zu Worms" stellt einen Sonderfall innerhalb der aventiurehaften Dietrichepik dar. Überliefert ist der "Rosengarten" ab Anfang des 14. Jahrhunderts bis circa 1500. Der Verfasser blieb anonym. Der "Rosengarten" ist in 21 Handschriften und in sechs Auflagen des ‚Gedruckten Heldenbuchs’ tradiert.
Es werden grob vier Versionen des "Rosengarten" unterschieden: die Version A, mit der ich mich in dieser Arbeit näher beschäftigen möchte, Version DP, F und die Mischversion C. Heinzle zählt sogar noch eine fünfte, die Version der Handschrift R13, als eine eigene Fassung. Der "Rosengarten" ist im Hildebrandston verfasst. Der "Dresdner Rosengarten" bildet eine Variante dessen mit Zäsurreimen (Heunenweise) ab. Im „Rosengarten“ A kämpft Dietrich nicht gegen übernatürliche Gegner (Drachen oder Zwerge), sondern es geht hier um sogenannte Reihenkämpfe zwischen den Berner Helden, unter der Führung Dietrichs, und den Recken aus Worms, unter ihnen Kriemhilds Verlobter Siegfried. So treffen im "Rosengarten" erstmals die "beiden größten Helden der deutschsprachigen heroischen Überlieferung" aufeinander.
Aventiurehafte Dietrichepik geht auf eine mündliche Überlieferung zurück. Dies kann man auch dadurch bestätigt sehen, dass es viele verschiedene Fassungen des "Rosengarten" gibt, die jeweils für sich alleine stehen. Daraus resultiert die Erkenntnis, dass das Erzählen der Texte durchaus wichtig und verbreitet war und somit auch eine gewisse Unterhaltungsfunktion des Werkes nahe liegt. Aus der Annahme, dass es sich beim "Rosengarten" A um Unterhaltungsliteratur handele, resultiert mein Beobachtungsschwerpunkt sich mit dem Handeln der Figuren näher zu beschäftigen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinitionen
- Komik und Komiktheorien
- Textimmanente Merkmale des Komischen
- Figurenhandeln im „Rosengarten“ A
- Kriemhild zwischen Frauendienst und Blutgier
- Ilsân als Mönchsheld
- Dietrich als Zauderer und Kritiker
- Zusammenfassung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Figurenhandeln im „Rosengarten“ A und analysiert die Figurenkomik ausgewählter Figuren. Dabei wird der Frage nachgegangen, ob die Figurenkomik im „Rosengarten“ A als „par excellence“ betrachtet werden kann.
- Definition und Analyse der Komiktheorien
- Untersuchung der textimmanenten Merkmale des Komischen
- Exemplarische Analyse der Figurenkomik von Kriemhild, Ilsân und Dietrich
- Zusammenfassung der Analyseergebnisse
- Abschließendes Fazit zur Figurenkomik im „Rosengarten“ A
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Arbeit stellt den „Rosengarten zu Worms“ als Sonderfall innerhalb der aventiurehaften Dietrichepik vor und erläutert die Besonderheiten der Version A. Die Einleitung fokussiert auf den Hintergrund der Dietrichepik, die verschiedenen Versionen des „Rosengarten“ und die Bedeutung der Unterhaltungsfunktion des Werkes. Die Arbeit setzt den Fokus auf die Figurenkomik, die durch die Analyse des Figurenhandelns im „Rosengarten“ A beleuchtet werden soll.
Begriffsdefinitionen
Dieses Kapitel definiert den Begriff der Komik und erläutert die drei wichtigsten Komiktheorien: die Überlegenheitstheorie, die Entlastungstheorie und die Inkongruenztheorie. Des Weiteren werden allgemeine intertextuelle Merkmale von Komik aufgezeigt.
Figurenhandeln im „Rosengarten“ A
Dieses Kapitel befasst sich mit der Analyse des Figurenhandelns im „Rosengarten“ A. Es werden die Figuren Kriemhild, Ilsân und Dietrich im Hinblick auf ihre komische Handlungsweise beleuchtet. Die Analyse konzentriert sich auf die Figurenkomik, die durch die Anwendung der zuvor definierten Komiktheorien und Merkmale des Komischen ergründet wird.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: aventiurehafte Dietrichepik, „Rosengarten zu Worms“, Figurenkomik, Komiktheorien, Überlegenheitstheorie, Entlastungstheorie, Inkongruenztheorie, Kriemhild, Ilsân, Dietrich. Die Arbeit untersucht die Figurenkomik im „Rosengarten“ A und analysiert das Figurenhandeln anhand der vorgestellten Komiktheorien.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der „Rosengarten zu Worms“?
Es handelt sich um ein anonymes Werk der aventiurehaften Dietrichepik aus dem 14. Jahrhundert, das Kämpfe zwischen Dietrich von Bern und den Wormser Recken (wie Siegfried) beschreibt.
Welche Rolle spielt die Komik in diesem mittelalterlichen Text?
Die Arbeit analysiert das Figurenhandeln im Hinblick auf Figurenkomik, da das Werk stark auf Unterhaltung und mündliche Erzähltradition ausgelegt war.
Welche Komiktheorien werden zur Analyse herangezogen?
Es werden die Überlegenheitstheorie, die Entlastungstheorie und die Inkongruenztheorie verwendet, um die komischen Effekte der Handlung zu erklären.
Warum wird der Mönch Ilsân als komische Figur betrachtet?
Ilsân wird als „Mönchsheld“ analysiert, dessen Verhalten oft im Widerspruch zu seinem geistlichen Stand steht, was zu komischen Situationen führt.
Wie wird Kriemhild im „Rosengarten“ A dargestellt?
Die Analyse beleuchtet Kriemhild im Spannungsfeld zwischen traditionellem Frauendienst und einer fast grotesken Blutgier während der Kämpfe.
Was unterscheidet die Version A von anderen Fassungen?
In der Version A kämpft Dietrich nicht gegen Drachen oder Riesen, sondern gegen menschliche Helden, was den Fokus auf die Interaktion und Komik zwischen den Figuren verschiebt.
- Citar trabajo
- Franziska Reuter (Autor), 2017, Figurenhandeln im "Rosengarten zu Worms", Version A. Eine Figurenkomik par excellence?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/492169