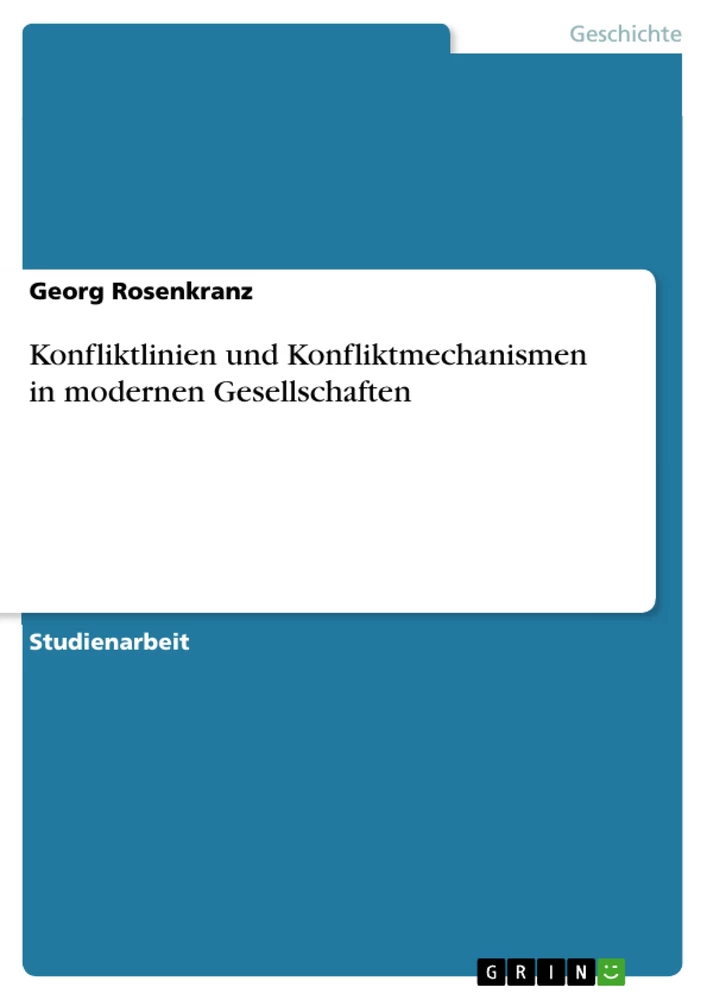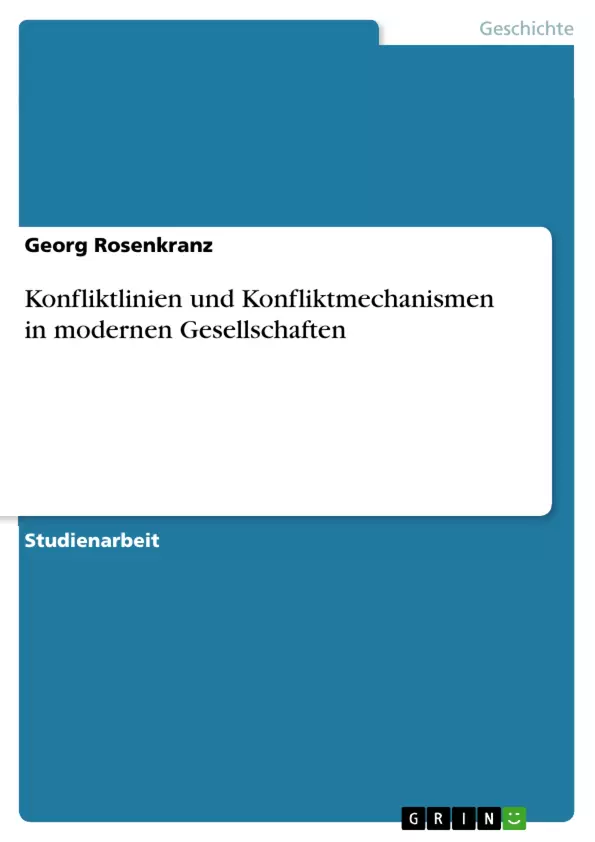Dieser Essay soll mithilfe ausgesuchter terroristischer Ereignisse und Gruppierungen aus dem Deutschland des 19. und 20. Jahrhunderts dazu beitragen, den Begriff näher zu erläutern. Als ausgewählte Beispiele dienen in diesem Zusammenhang das Attentat am Niederwalddenkmal auf Kaiser Wilhelm I. durch eine Gruppe um August Reinsdorf, der sogenannte ‚Hitler-Putsch‘ sowie die Taten der zweiten Generation (1975 bis 1977) der Gruppierung ‚Rote Armee Fraktion‘ (RAF). Anhand dieser drei Ereignisse sollen dem Leser die Komplexität und Breite des Terrorismusbegriffes sowie eventuelle Gemeinsamkeiten näher gebracht werden. In einem ersten Teil soll zunächst mithilfe der gewählten Beispiele geklärt werden, was für Arten von Terrorismus existieren und welche Voraussetzungen dafür gegeben sein müssen. In einem zweiten Teil soll das terroristische Ziel der Musterbeispiele beleuchtet sowie die eingesetzten Mittel der terroristischen Gruppierungen dargestellt werden.
Der Versuch, den Begriff ‚Terrorismus‘ zu definieren, führt zu einer nahezu unüberschaubaren Anzahl von Meinungen. Insbesondere seit den Anschlägen vom 11. September 2001 auf das New Yorker World Trade Center hat sich diese Zahl erheblich erhöht. Dieser Essay soll mithilfe ausgesuchter terroristischer Ereignisse und Gruppierungen aus dem Deutschland des 19. und 20. Jahrhunderts dazu beitragen, den Begriff näher zu erläutern. Als ausgewählte Beispiele dienen in diesem Zusammenhang das Attentat am Niederwalddenkmal auf Kaiser Wilhelm I. durch eine Gruppe um August Reinsdorf, der sogenannte ‚Hitler-Putsch‘ sowie die Taten der zweiten Generation (1975 bis 1977) der Gruppierung ‚Rote Armee Fraktion‘ (RAF). Anhand dieser drei Ereignisse sollen dem Leser die Komplexität und Breite des Terrorismusbegriffes sowie eventuelle Gemeinsamkeiten näher gebracht werden. In einem ersten Teil soll zunächst mithilfe der gewählten Beispiele geklärt werden, was für Arten von Terrorismus existieren und welche Voraussetzungen dafür gegeben sein müssen. In einem zweiten Teil soll das terroristische Ziel der Musterbeispiele beleuchtet sowie die eingesetzten Mittel der terroristischen Gruppierungen dargestellt werden.
Der Terminus ‚Terror‘ (lateinisch terror, ‚Furcht‘, ‚Schrecken‘) wurde erstmals im 18. Jahrhundert im Zuge der Französischen Revolution zur Bezeichnung einer gewaltsamen Regierungsmaßnahme verwendet („Terror des Konvents – 1793–1764“). Ab 1795 fand der Terrorismusbegriff, der zunächst als Synonym für die Schreckensherrschaft der Jakobiner in Frankreich herangezogen wurde, schließlich Eingang in den deutschen Sprachgebrauch. Während der Begriff in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts fast gänzlich an Bedeutung verlor, rückte er durch das stalinistische Regime in der UdSSR wieder in die öffentliche Wahrnehmung und erreichte mit dem Anschlag auf das World Trade Center seinen Höhepunkt.1 Eine erste Annäherung an den Begriff ‚Terrorismus‘ und die gleichzeitige Distanzierung von anderer politischer Gewalt (z. B. Bürgerkrieg, Revolution oder Machtkampf) bietet die Terrorismusdefinition aus dem Brockhaus:
„ Politisch motivierte Gewaltanwendung v. a. durch revolutionäre oder extremistische Gruppen oder Einzelpersonen, die aufgrund ihrer zahlenmäßigen Unterlegenheit gegenüber dem herrschenden Staatsapparat mit [...] meist grausamen direkten Aktionen die Hilflosigkeit des Regierungs- und Polizeiapparats gegen solche Aktionen Herrschenden abziehen und Angst und Schrecken verbreiten wollen.“ 2
Nichtstaatlicher Terrorismus zielt folglich auf eine öffentliche Auseinandersetzung in Bezug auf die Legitimität der bestehenden Staats- und Herrschaftsform und auf eine öffentliche Debatte darüber, welche politischen Partizipationsrechte den Angehörigen eines Gemeinwesens im Umgang mit dem eigenen und fremden Herrschaftssystemen zustehen.3 Darüber hinaus bedarf es an einigen Voraussetzungen, bevor von Terrorismus gesprochen werden kann. Dazu zählt zum einen eine Regierungsform, in der sich Herrschaft durch wie auch immer herzustellende staatstragende Mehrheiten legitimiert und in der das Gewaltmonopol vom Staat beansprucht wird. Zuletzt sollten die bürgerliche Öffentlichkeit und die dazu notwendigen unabhängigen Medien genannt werden, die sich mit der Legitimität der Herrschaftsform, der Rechtmäßigkeit etwaiger Angriffe auf das System und der Berechtigung der Akteure auseinandersetzen.4 Nachdem nun eine mögliche Definition genannt worden ist (jene aus der Vorlesung), sollen im folgenden Schritt die drei ausgewählten Beispiele auf diese überprüft werden. Dabei bietet es sich an, die vorher dargelegte Terrorismusdefinition in drei Punkte zu differenzieren:
– Politisch motivierte Gewalt,
– nichtstaatliche Gruppierung,
– Tätigkeit im Untergrund.
Es ist zu erwähnen, dass aus Gründen der limitierten Länge dieser Arbeit darauf verzichtet wird, die einzelnen Beispiele auf die oben genannten Voraussetzungen zu überprüfen. Diese werden bei allen drei Fällen als gegeben betrachtet. Beim Attentat auf Kaiser Wilhelm I. handelte es sich klar um eine politisch motivierte Gewalttat, da die Verantwortlichen rund um August Reindorf allesamt überzeugte Anarchisten waren. Als ihre Ziele galten die Abschaffung des Staates und des Privateigentums sowie die Neuorganisation der Gesellschaft und das Prinzip des freien Zusammenschlusses. Vor gewaltsamen Übergriffen schreckten die Anarchisten nicht zurück, da sie darin die Möglichkeit der Durchsetzung ihrer Ideen sahen. Der am 09. November 1923 in München gescheiterte Putschversuch von Adolf Hitler basierte ebenso auf der Grundlage des Einsatzes von Gewalt, um die Etablierung der eigenen politischen Ideale zu erzwingen. Während das Nachkriegsdeutschland im Jahr 1923 u. a. durch eine starke Hyperinflation und eine Bevölkerung, die zunehmend das Vertrauen in die Politiker der Weimarer Republik verlor, schier im Chaos versank, konnten die Kommunisten und völkischen Nationalisten große Zulauf verbuchen. Das Ziel des von der NSDAP mit ihrem damaligen Vorsitzenden Adolf Hitler intendierten Putsches war mit der Ausrufung einer nationalen Revolution nicht nur die Absetzung der bayrischen Regierung und der Reichsregierung, sondern auch die Etablierung einer Diktatur in Deutschland.5 Bei den Taten der Rote Armee Fraktion handelte es sich auch um politisch motivierte Gewalt, die darauf abzielte, den Mythos der Unangreifbarkeit des Staates zu zerstören, das staatliche Gewaltmonopol infrage zu stellen und an internationale Guerillakämpfe anzuknüpfen. Das Merkmal ‚nichtstaatliche Gruppe‘ bringt zum einen zum Ausdruck, dass Terrorismus ausschließlich das nichtstaatliche Handeln umfasst. Des Weiteren wird mittels dieses Aspekts verdeutlicht, dass Terrorismus eine Gruppenaktivität ist.6 In Bezug auf die genannten Beispiele lässt sich feststellen, dass es sich um nichtstaatliche Gruppen handelte, die diesen zum Sturz bringen wollten. Auch das Charakteristikum der Gruppenaktivität trifft auf alle drei Darlegungen zu: Das Attentat auf Kaiser Wilhelm I. planten mindestens drei Täter, während des Hitler-Putsches leisteten sich hunderte Putschisten einen Kampf mit der Polizei und auch die zweite Generation der RAF bestand aus einer festen Gruppe. Der letzte Punkt der Terrorismusdefinition, das sogenannte ‚Handeln aus dem Untergrund‘, ist teilweise feststellbar, da die terroristischen Gruppen aufgrund ihrer objektiven Schwäche einer offenen Konfrontation mit dem politischen Gegner nicht gewachsen waren und diese daher bewusst vermieden. Ihre Aktionen planten sie lange und geheim im Voraus und behielten somit den Faktor der Überraschung auf ihrer Seite.
Neben den Terroristen ist das terroristische Ziel von Belang. Dieses kann zwar verschiedenartig sein, ist aber immer zwingend auf die Veränderung der bestehenden Gesellschaftsordnung gerichtet. Vor diesem Hintergrund lässt sich diese Form der politischen Gewaltanwendung in die Richtungen sozial-revolutionärer, ethnisch-nationaler, religiöser sowie Rechtsterrorismus untergliedern.7 Der sozial-revolutionäre Terrorismus hat die Errichtung einer klassen- bzw. herrschaftslosen Gesellschaftsordnung als politisches Ziel. In diese Kategorie fallen zwei der drei zuvor beschriebenen Beispiele: das Attentat auf Kaiser Wilhelm I. sowie die Aktivitäten der RAF. Diese Untergliederung des Terrorismus bezieht sich auf den orthodoxen Marxismus, wobei aber eine objektive revolutionäre Situation nicht erst abgewartet, sondern mit Gewalt geschaffen werden soll. Hinzu kommt, dass nach dieser marxistischen Denkweise Krieg und Gewalt im Kapitalismus unvermeidlich sind und erst durch die Etablierung des Sozialismus beide Problematiken wegfallen. Aus diesem Grund ist im Rahmen eines Klassenkampfes und einer Revolution Gewaltanwendung erlaubt bzw. teilweise erwünscht. Stand bei der russischen Narodnaja Volja in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts der Kampf gegen die zaristische Autokratie im Zentrum, war zum selben Zeitpunkt in Westeuropa der Anarchismus das angestrebte Ziel der sozial-revolutionären Terroristen. Diese verfolgten ein politisches Ziel, das darauf ausgerichtet war, jede Herrschaft von Menschen über Menschen, jede gesetzliche Zwangsordnung – besonders den Staat –, zu beseitigen und ein autoritäts- und herrschaftsloses Zusammenleben herbeizuführen. Dieses Ziel sollte hauptsächlich durch Attentate auf herrschende Würdenträger und andere herrschende Würdenträger erreicht werden. Dieser voluntaristische Geist reaktivierte sich bei den linksradikalen Gruppen, die in den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts aufkamen: Action Directe (Frankreich), Brigate Rosse (Italien) oder die Rote Armee Fraktion (BRD).8 Der Hitler-Putsch hingegen ist unter dem Begriff ‚Rechtsterrorismus‘ anzusiedeln, der ebenso wie der sozial-revolutionäre Terrorismus geplante und durchgeführte Sprengstoffanschläge, Morde oder andere Formen terroristischer Gewalt anwendet, um seine Ziele zu verwirklichen. Der Rechtsterrorismus strebt dabei mithilfe von Gewalt die Schaffung eines nationalistisch, völkisch ausgerichteten Staates an. Im Falle des Hitler-Putsches formierten sich im Jahr 1923 der ehemalige Stabschef der Obersten Heeresleitung, Erich Ludendorff, und der Vorsitzende der NSDAP, Adolf Hitler, im September desselben Jahres zum sogenannten ‚Deutschen Kampfbund‘. Dessen politisches Programm zielte darauf ab, eine nationale Diktatur zur inneren Reinigung Deutschlands und der Wiederherstellung alter Weltmachtstellung zu errichten. Dafür stürmten am Abend des 8. November 1923 Anhänger der NSDAP eine geplante Kundgebung des nationalistischen und monarchistischen Generalsstaatskommissars Gustav von Kahrs im Münchner Bürgerbräukeller. Adolf Hitler verkündete daraufhin die Absetzung der deutschen Reichsregierung sowie eine nationale Revolution. Mit dem sogenannten ‚Marsch auf die Münchner Feldherrnhalle‘ wollte Hitler die Staatsgewalt an sich reißen und seinen bis dahin isoliert gebliebenen Aufstand wiederbeleben. Schlussendlich endete der Aufstand in einem Kugelhagel, bei dem vier Polizisten und 16 Demonstranten ums Leben kamen.9
[...]
1 Schraut, Sylvia, Terrorismus und Geschlecht, in: Christine Künzel (Hg.), Täterinnen und/oder Opfer? Frauen in Gewaltstrukturen (= Gender-Diskussion, Bd. 4), Hamburg, 2007, S. 105.
2 Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG, 2004 (CD-Version).
3 Schraut, Sylvia, Terrorismus und Geschichtswissenschaft, in: Alexander Spencer u. a. (Hg.), Terrorismusforschung in Deutschland. [Sonderheft 01/2011 der Zeitschrift für Außen- und Sicherheitspolitik] (= Sonderheft der Zeitschrift für Außen- und Sicherheitspolitik), Wiesbaden, 2011, S. 110.
4 Ebd., S. 110f.
5 https://www.dhm.de/lemo/kapitel/weimarer-republik/innenpolitik/hitler-putsch-1923.html (Stand: 08.03.2018).
6 Schulte, Philipp H., Terrorismus- und Anti-Terrorismus-Gesetzgebung. Eine rechtssoziologische Analyse. Zugl.: Münster (Westfalen), Univ., Diss, 2007 (= Kriminologie und Kriminalsoziologie, Bd. 6), Münster, 2008, S. 42.
7 Schulte, Philipp H., Terrorismus- und Anti-Terrorismus-Gesetzgebung. Eine rechtssoziologische Analyse. Zugl.: Münster (Westfalen), Univ., Diss, 2007 (= Kriminologie und Kriminalsoziologie, Bd. 6), Münster, 2008, S. 28.
8 Ebd., S. 28f.
9 https://www.lpb-bw.de/hitlerputsch.html (Stand: 08.03.2018).
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Terrorismus im Brockhaus definiert?
Als politisch motivierte Gewaltanwendung durch extremistische Gruppen oder Einzelpersonen, die Angst und Schrecken verbreiten wollen, um die Hilflosigkeit des Staates aufzuzeigen.
Was sind die drei Kernmerkmale von Terrorismus?
Dazu gehören: 1. Politisch motivierte Gewalt, 2. Handeln durch nichtstaatliche Gruppierungen und 3. Agieren aus dem Untergrund.
Was ist sozial-revolutionärer Terrorismus?
Diese Form zielt auf den Sturz der bestehenden Gesellschaftsordnung ab, um eine klassenlose Gesellschaft zu errichten (Beispiele: RAF, Anarchisten des 19. Jhd.).
In welche Kategorie fällt der Hitler-Putsch von 1923?
Der Hitler-Putsch wird dem Rechtsterrorismus zugeordnet, da er die gewaltsame Errichtung eines nationalistischen, völkisch ausgerichteten Staates zum Ziel hatte.
Welche Rolle spielen Medien für den Terrorismus?
Terrorismus ist auf eine öffentliche Resonanz angewiesen; unabhängige Medien dienen oft ungewollt als Multiplikatoren für die Verbreitung von Angst und die Botschaften der Täter.
Was war das Ziel der RAF?
Die RAF wollte das staatliche Gewaltmonopol infrage stellen, den Mythos der Unangreifbarkeit des Staates zerstören und an internationale revolutionäre Kämpfe anknüpfen.
- Citar trabajo
- Georg Rosenkranz (Autor), 2018, Konfliktlinien und Konfliktmechanismen in modernen Gesellschaften, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/492381