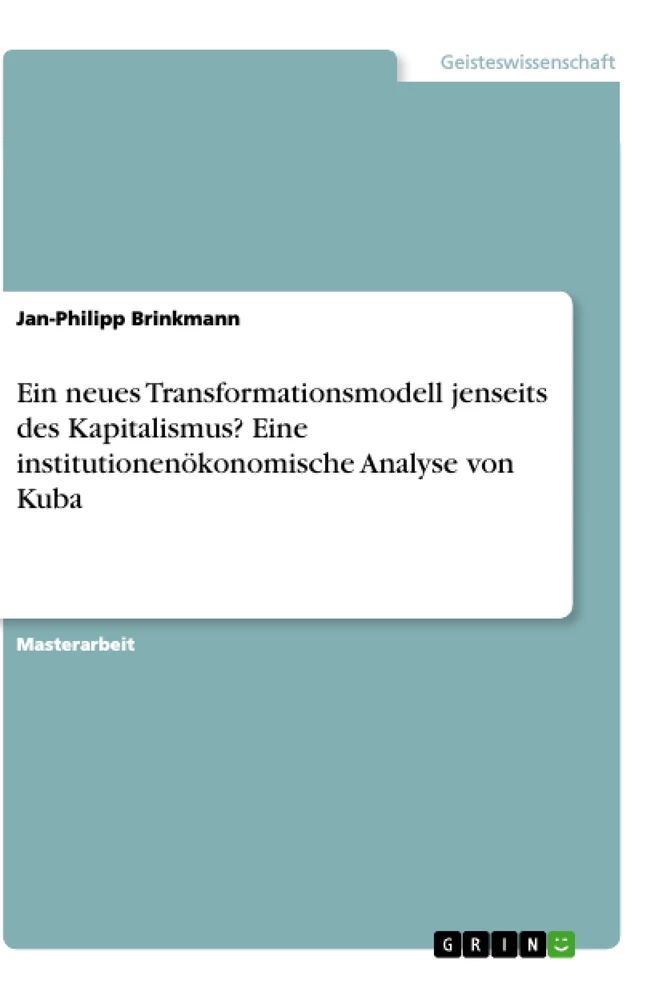Kein anderes Land der Karibik hat weltweit so viel Aufsehen erregt wie Kuba. Der kleine karibische Inselstaat stand im Verlauf seiner polarisierenden Geschichte des Öfteren im Fokus der globalen Medien. Die gar nicht so weit zurückliegende Kolonialgeschichte, das karibische Klima, die eigene Kultur und der sozialistische Fler der Revolution haben immer schon Menschen auf diese besondere Insel gezogen. Immer mehr Touristen strömen heutzutage auf die Insel. Dies liegt auf der einen Seite daran, dass die Infrastruktur für den Pauschal-und Massentourismus in den letzten Jahrzehnten immer weiter ausgebaut wurde und nun auch Menschen ohne politische Motivation auf die Insel kommen, um Strandurlaub zu machen. Auf der anderen Seite existiert in westlichen Teilen der Welt der Mythos, dass Kuba, die letzte sozialistische Bastion des 21. Jahrhunderts, sich nun auch in Richtung Kapitalismus aufmacht. Herauszufinden ob man dem Mythos glauben schenken darf oder nicht, soll eine zentrale Aufgabe dieser Arbeit sein.
Fragt man die Kubaner heute auf der Straße, dann können sie nicht oft genug betonen, wie schnell sich alles aktuell auf der kubanischen Insel verändert. Im zweiten Atemzug bekommt man dann ganz schnell erklärt, dass es dem Land wirtschaftlich nicht gut geht. Um sich dies bestätigen zu lassen, braucht man nur einen Blick in die negative Handelsbilanz, die wachsenden Nahrungsmittelimporte und die geringen Wachtsumsraten des vergangenen Jahrzehnts anschauen. Dass diese Resultate, trotz der massiven Einschränkungen durch das US-Wirtschaftsembargo, auch auf die Ineffizienzen der zentralen Planung der kubanischen Wirtschaftsleitung zurückzuführen sind, wird mittlerweile auch parteiintern hier und da anerkannt.
Nach dem Rücktritt Fidel Castros haben die institutionellen Reformen unter Raúl Castro eine neue Schlagzahl angenommen, die letzlich einen wirtschaftlichen und sozialen Wandel in Gang gebracht haben, der zwar nicht schockartig daherkommt, aber beständig scheint. Eine weitere Hypothese dieser Arbeit ist, dass sich das kubanische Wirtschaftssystem aktuell in einer institutionellen Transitionsphase befindet, wobei noch nicht eindeutig geklärt ist, ob es sich hierbei um Reformen innerhalb des sozialistischen Ordnungsgefüges handelt oder ob sich sogar eine Annäherung an eine kapitalistische Marktwirtschaft vollzieht. Die aktuellen Entwicklungen auf diesem organisationellen Spektrum einzuordnen, soll ein Ziel dieser Arbeit sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Institutionenökonomische Theorie
- Institutionen als Regeln im Gleichgewicht
- Evolutionär-institutionelle Ökonomik
- Grundlegendes
- Ontologisches Verständnis der EIÖ
- Soziale Eingebettetheit
- Zeremenielle und instrumentelle Werte, Technologie und Wissensbestände. Institutioneller Wandel nach der EIÖ
- North'sche Institutionentheorie
- Ontologisches Verständnis der NIÖ
- Transaktionskosten und Wirtschaftsleistung
- Formgebundene Institutionen und die Veränderung der relativen Preise. Institutioneller Wandel nach der NIÖ
- Zusammenfassung: EIÖ und NIÖ im Vergleich
- Institutionelle Ausgestaltung von Wirtschaftsordnungen
- Transformationsökonomie
- Transformationstheorie
- Postsozialistische Transformationsökonomien
- ,,Graduelle Therapie“ oder „Schocktherapie\"?
- Quantitative Messmethoden der Transformation
- Der Privatisierungsprozess russischer Großunternehmen in der Transformation und die Gefahr der Monopolbildung
- Ein Beispiel ökonomischer Selbstorganisation. Die Transformation der jugoslawischen Genossenschaften
- Transformationsblaupause Vietnam? Der Erfolg der kleinen und mittelständischen Familien und Landwirtschaftsbetriebe in Vietnam
- Die Bedeutung der informellen Institutionen im chinesischen Transformationsprozess. Soziale Eingebettheit, Korruption und Güterallokation
- Kubas Wirtschaftstransformation
- Kubanische Wirtschaftsgeschichte
- Reformen der Período Especial en Tiempos de Paz
- Der kubanische Doi Moi. Institutioneller Wandel unter Raúl Castro
- Zentrale Probleme Wirtschaft und Transformationsdruck
- Weichenstellung für den Wandel. Institutioneller Wandel der sozialen und wirtschaftlichen Ordnung ab 2007
- Die neuen Leitlinien von 2011/2016
- Der graduelle Weg
- Denzentralisierung oder Reorganisation? Die staatlichen Großunternehmen und Joint-Ventures
- Nichtstaatliche Formen der Unternehmensorganisation. Privatisierung der kleinen und mittelständischen Unternehmen
- Genossenschaftliche Organisationsformen und ihre institutionelle Entwicklung im kubanischen Wirtschaftsmodell
- Landwirtschaftliche Genossenschaften. Tradition, Lehren und institutionelle Innovationen
- Genossenschaften anderer Wirtschaftssektoren. Experiment oder Hoffnungsträger?
- Cuentapropistas. Privatisierung mit Hindernissen
- Informelle Institutionen im Wandel und die Blackbox der informellen Wirtschaft
- Das Internet als Zündholz des progressiven institurionellen Wandels
- Ein alternatives Transformationsmodell für Kuba?
- Der bittere Beigeschmack des asiatischen Weges
- Das Modell der Gemeinwohl-Ökonomie
- Die Gemeinwohlökonomie als alternatives Entwicklungsziel für Kuba?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit befasst sich mit der Frage, ob Kuba ein neues Transformationsmodell jenseits des Kapitalismus entwickeln kann. Dabei wird eine institutionsökonomische Analyse durchgeführt, die auf die Evolutionär-Institutionelle Ökonomik (EIÖ) und die North'sche Institutionenökonomik (NIÖ) fokussiert. Die Arbeit beleuchtet die wirtschaftliche Entwicklung Kubas im Kontext der postsozialistischen Transformationsökonomien und untersucht die Reformen der Período Especial en Tiempos de Paz sowie die des Doi Moi unter Raúl Castro.
- Die Rolle von Institutionen im Transformationsprozess Kubas
- Analyse der verschiedenen Reformen und ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft
- Die Entwicklung von Genossenschaften und anderen Formen der Unternehmensorganisation
- Die Bedeutung der informellen Wirtschaft und der digitalen Transformation
- Bewertung der Möglichkeiten und Herausforderungen eines alternativen Transformationsmodells
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung
Dieses Kapitel führt in die Thematik der Arbeit ein, indem es die Relevanz von Kuba als Fallstudie für die Analyse von Transformationsmodellen hervorhebt. Die Forschungsfrage und die Methodik der Arbeit werden vorgestellt.
Kapitel 2: Institutionenökonomische Theorie
Dieses Kapitel stellt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es beleuchtet die EIÖ und die NIÖ und analysiert die Konzepte von Institutionen, Transaktionskosten und Wirtschaftsleistung. Es werden die verschiedenen institutionellen Ausgestaltungen von Wirtschaftsordnungen erläutert.
Kapitel 3: Transformationsökonomie
Dieses Kapitel beleuchtet die Transformationsökonomie im Allgemeinen und analysiert die spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten postsozialistischer Transformationsökonomien. Es werden verschiedene Transformationsmodelle und ihre Erfolgsfaktoren diskutiert.
Kapitel 4: Kubas Wirtschaftstransformation
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die wirtschaftliche Entwicklung Kubas. Es betrachtet die kubanische Wirtschaftsgeschichte, die Reformen der Período Especial en Tiempos de Paz und des Doi Moi unter Raúl Castro. Es untersucht die Rolle staatlicher und nichtstaatlicher Unternehmen, die Bedeutung von Genossenschaften und die Auswirkungen der informellen Wirtschaft.
Kapitel 5: Ein alternatives Transformationsmodell für Kuba?
Dieses Kapitel diskutiert verschiedene alternative Transformationsmodelle für Kuba. Es analysiert den asiatischen Weg und stellt die Gemeinwohl-Ökonomie als alternatives Entwicklungsziel vor.
Schlüsselwörter
Kuba, Transformation, Institutionenökonomik, Evolutionär-Institutionelle Ökonomik, North'sche Institutionenökonomik, Transformationsökonomie, Postsozialismus, Período Especial en Tiempos de Paz, Doi Moi, Genossenschaften, informelle Wirtschaft, Internet, Gemeinwohlökonomie.
Häufig gestellte Fragen
Befindet sich Kuba auf dem Weg zum Kapitalismus?
Kuba befindet sich in einer Transitionsphase mit institutionellen Reformen, wobei noch unklar ist, ob dies eine Annäherung an die Marktwirtschaft oder eine Reform innerhalb des Sozialismus darstellt.
Was sind „Cuentapropistas“?
Cuentapropistas sind Kleingewerbetreibende oder Selbstständige in Kuba, die einen wachsenden Teil des nichtstaatlichen Sektors ausmachen.
Welche Rolle spielen Genossenschaften in der kubanischen Wirtschaft?
Genossenschaften, besonders in der Landwirtschaft, gelten als Hoffnungsträger für eine Dezentralisierung und Effizienzsteigerung der Wirtschaft.
Was war die „Período Especial en Tiempos de Paz“?
Es war eine schwere Wirtschaftskrise in den 1990er Jahren nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, die Kuba zu ersten marktwirtschaftlichen Öffnungen zwang.
Was ist das Modell der Gemeinwohl-Ökonomie?
Es ist ein alternatives Wirtschaftsmodell, das auf Werten wie Kooperation und Solidarität statt reinem Gewinnstreben basiert und als mögliches Ziel für Kuba diskutiert wird.
Wie beeinflusst das Internet den Wandel in Kuba?
Das Internet wirkt als Katalysator für den institutionellen Wandel, da es den Zugang zu Informationen und die Vernetzung der Bürger verbessert.
- Arbeit zitieren
- Jan-Philipp Brinkmann (Autor:in), 2018, Ein neues Transformationsmodell jenseits des Kapitalismus? Eine institutionenökonomische Analyse von Kuba, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/493696