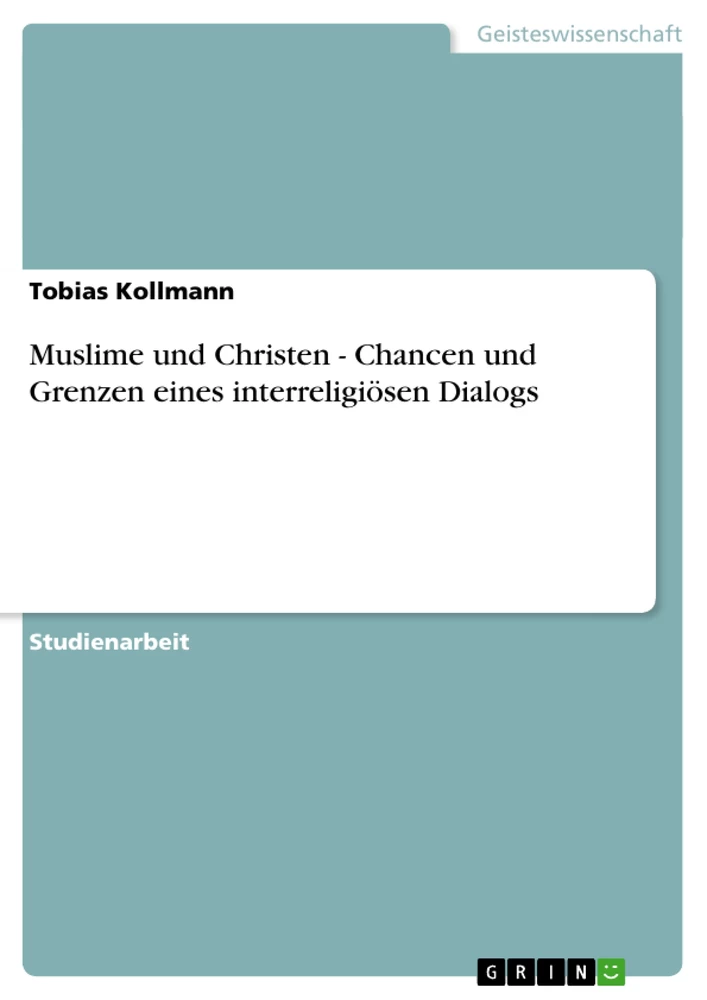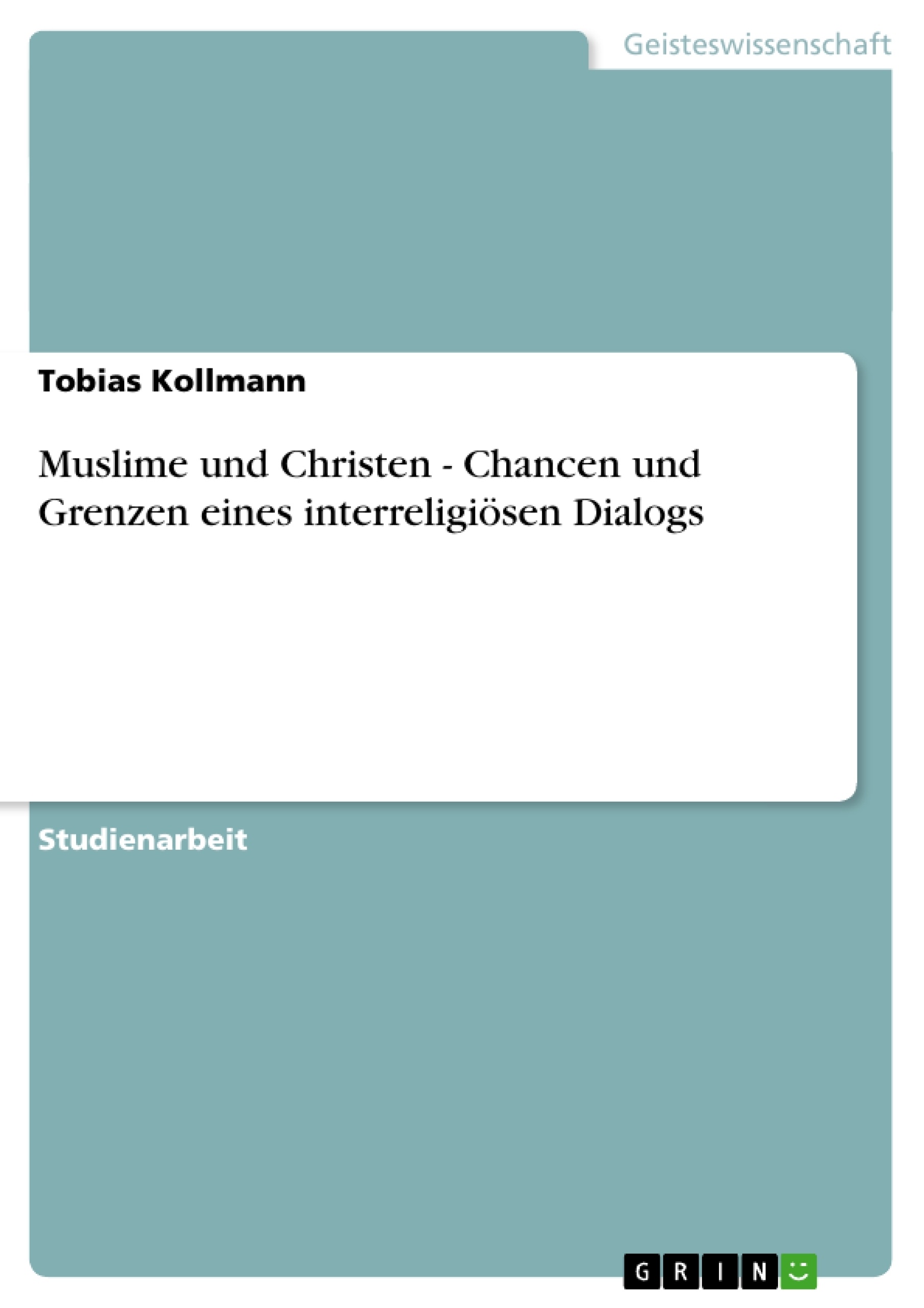Angesichts des sich verändernden Gesellschaftsbildes, was zunehmend multikultureller und multireligiöser wird, ist für Christen eine Auseinandersetzung mit anderen Religionen unumgänglich geworden. Dabei spielen vor allem Muslime eine große Rolle, die nach den Christen die zweitgrößte Religionsgruppe in Deutschland darstellt. Im Integrationsprozess gehören Aufeinandertreffen aber auch Konfrontationen zum täglichen Leben dazu. Daher kann man getrost schon von einem Zwang zum Dialog auf kultureller und religiöser Ebene sprechen. Vor allem der Islam ist dabei nicht mehr als eine weit entfernte Größe einzuordnen, sondern spielt im täglichen Miteinander eine gewichtige Rolle.
Aufgrund der genannten Entwicklungen ist das Ziel der vorliegenden Arbeit nun die Untersuchung dieses interreligiösen Dialogs. Die Fragestellung muss dabei lauten, welche Chancen und Möglichkeiten, aber auch welche Grenzen und Risiken er für beide Seiten bereithält. Um diese zu beleuchten, müssen zunächst Voraussetzungen deutlich gemacht und Wege der Annäherung beschrieben werden. Dies beginnt schon beim eigenen Selbst- und Fremdverständnis der Dialogpartner. Dabei müssen vorhandene Ressentiments, die oft aus der jahrhundertelangen, konfliktreichen Historie der beiden großen Weltreligionen entstammen, abgebaut werden.
Weiterhin müssen dann offizielle Positionen auf beiden Seiten untersucht und geprüft werden, um so die Grundsteine für den Dialog zu legen. Daraufhin sollte man zunächst auf die Schnittmenge zwischen Christentum und Islam schauen, aber auch signifikante Unterschiede wahrnehmen, um so Chancen und Grenzen besser auszuloten zu können.
Bei der Untersuchung dieser Fragestellung fällt vor allem ins Auge, dass zwischen Muslimen und Christen schon aufgrund der monotheistischen Tradition und der gemeinsamen abrahameischen Abstammung zahlreiche Verbindungslinien bestehen. Somit ist die Grundlage für den Dialog bereits gelegt. Jedoch müssen auch einige scheinbar unüberbrückbare Differenzen betrachtet werden, die manchen Dialogversuch ungeheuer erschweren können. Insgesamt kann dennoch festgehalten werden, dass die Anzahl der Chancen und Gemeinsamkeiten die der Risiken und Unterschiede klar übertrifft.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Steine auf dem Weg zum Dialog: Christliche Ressentiments gegenüber dem Islam und muslimische Vorurteile gegenüber dem Christentum
- III. Was ist Islam? Plurale Islamverständnisse in Geschichte und Gegenwart als Horizont für den kulturellen und religiösen Dialog
- IV. Offizielle Grundhaltungen zum Dialog: Kirchliche Positionen und Begegnungsfelder mit dem Islam
- V. Vorbedingungen als Grundlage für den Dialog
- VI. Sackgassen des Dialogs: Über den Umgang mit scheinbar unüberbrückbaren Differenzen
- VII. Fruchtbarer Boden für den Dialog: Betonung der Gemeinsamkeiten und Berührungspunkte
- VIII. Abschließende Zusammenfassung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den interreligiösen Dialog zwischen Christen und Muslimen, der im Zuge der zunehmenden Multikulturalität und Multireligiosität in der Gesellschaft immer wichtiger wird. Ziel ist es, Chancen und Möglichkeiten, aber auch Grenzen und Risiken des Dialogs für beide Seiten aufzuzeigen.
- Ressentiments und Vorurteile zwischen Christen und Muslimen aus der Geschichte
- Pluralität und Vielfältigkeit im Islamverständnis
- Offizielle Positionen und Begegnungsfelder von Kirche und Islam
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Christentum und Islam
- Möglichkeiten und Herausforderungen für einen fruchtbaren Dialog
Zusammenfassung der Kapitel
- I. Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des interreligiösen Dialogs zwischen Christen und Muslimen im Kontext der sich verändernden Gesellschaft dar und erläutert die Zielsetzung der Arbeit.
- II. Steine auf dem Weg zum Dialog: Dieses Kapitel beleuchtet die historisch gewachsenen Vorurteile und Ressentiments, die den Dialog zwischen Christen und Muslimen erschweren. Es werden sowohl christliche Vorbehalte gegenüber dem Islam als auch muslimische Vorurteile gegenüber dem Christentum thematisiert.
- III. Was ist Islam?: Das Kapitel beschäftigt sich mit der Pluralität des Islamverständnisses in Geschichte und Gegenwart. Es stellt die Entwicklung des Islambildes im Wandel der Zeit dar und zeigt, wie diese historischen Perzeptionen die heutigen Beziehungen zwischen Christen und Muslimen prägen.
- IV. Offizielle Grundhaltungen zum Dialog: Dieses Kapitel analysiert die offiziellen Positionen und Begegnungsfelder von Kirche und Islam. Es werden die Ansätze beider Religionen im Hinblick auf den interreligiösen Dialog untersucht.
- V. Vorbedingungen als Grundlage für den Dialog: Dieses Kapitel identifiziert die grundlegenden Voraussetzungen, die für einen erfolgreichen Dialog zwischen Christen und Muslimen notwendig sind.
- VI. Sackgassen des Dialogs: Das Kapitel thematisiert die scheinbar unüberbrückbaren Differenzen zwischen Christen und Muslimen, die den Dialog erschweren können. Es wird untersucht, wie mit diesen Herausforderungen umgegangen werden kann.
- VII. Fruchtbarer Boden für den Dialog: Das Kapitel konzentriert sich auf die Gemeinsamkeiten und Berührungspunkte zwischen Christen und Muslimen, die eine Grundlage für einen fruchtbaren Dialog bieten.
Schlüsselwörter
Interreligiöser Dialog, Christentum, Islam, Vorurteile, Ressentiments, Pluralität, Islamverständnis, Begegnungsfelder, Gemeinsamkeiten, Unterschiede, Chancen, Grenzen.
Häufig gestellte Fragen
Welche Gemeinsamkeiten verbinden Christen und Muslime?
Beide Religionen teilen die monotheistische Tradition, die abrahameische Abstammung und viele ethische Grundwerte.
Was sind die größten Hindernisse im interreligiösen Dialog?
Historisch gewachsene Ressentiments, gegenseitige Vorurteile und tiefgreifende theologische Differenzen (z.B. das Verständnis von Jesus Christus) erschweren die Annäherung.
Warum ist der Dialog in Deutschland heute ein "Zwang"?
Durch die wachsende multireligiöse Gesellschaft und den hohen Anteil an Muslimen ist ein friedliches Miteinander ohne kulturellen und religiösen Austausch kaum möglich.
Welche offiziellen Positionen vertreten die Kirchen zum Islam?
Die Arbeit analysiert kirchliche Dokumente und Begegnungsfelder, die den Dialog fördern und eine Basis für gegenseitigen Respekt schaffen sollen.
Wie kann mit "unüberbrückbaren Differenzen" umgegangen werden?
Ein erfolgreicher Dialog erfordert, diese Differenzen wahrzunehmen, ohne sie sofort harmonisieren zu wollen, und sich stattdessen auf die praktische Kooperation zu konzentrieren.
- Citar trabajo
- Tobias Kollmann (Autor), 2005, Muslime und Christen - Chancen und Grenzen eines interreligiösen Dialogs, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49371