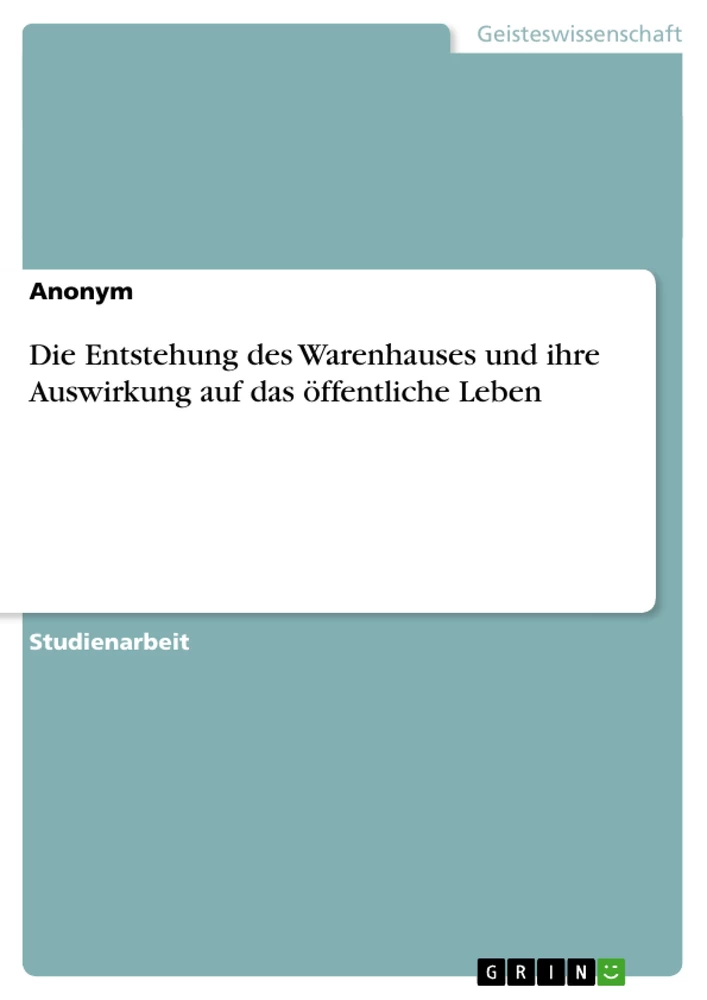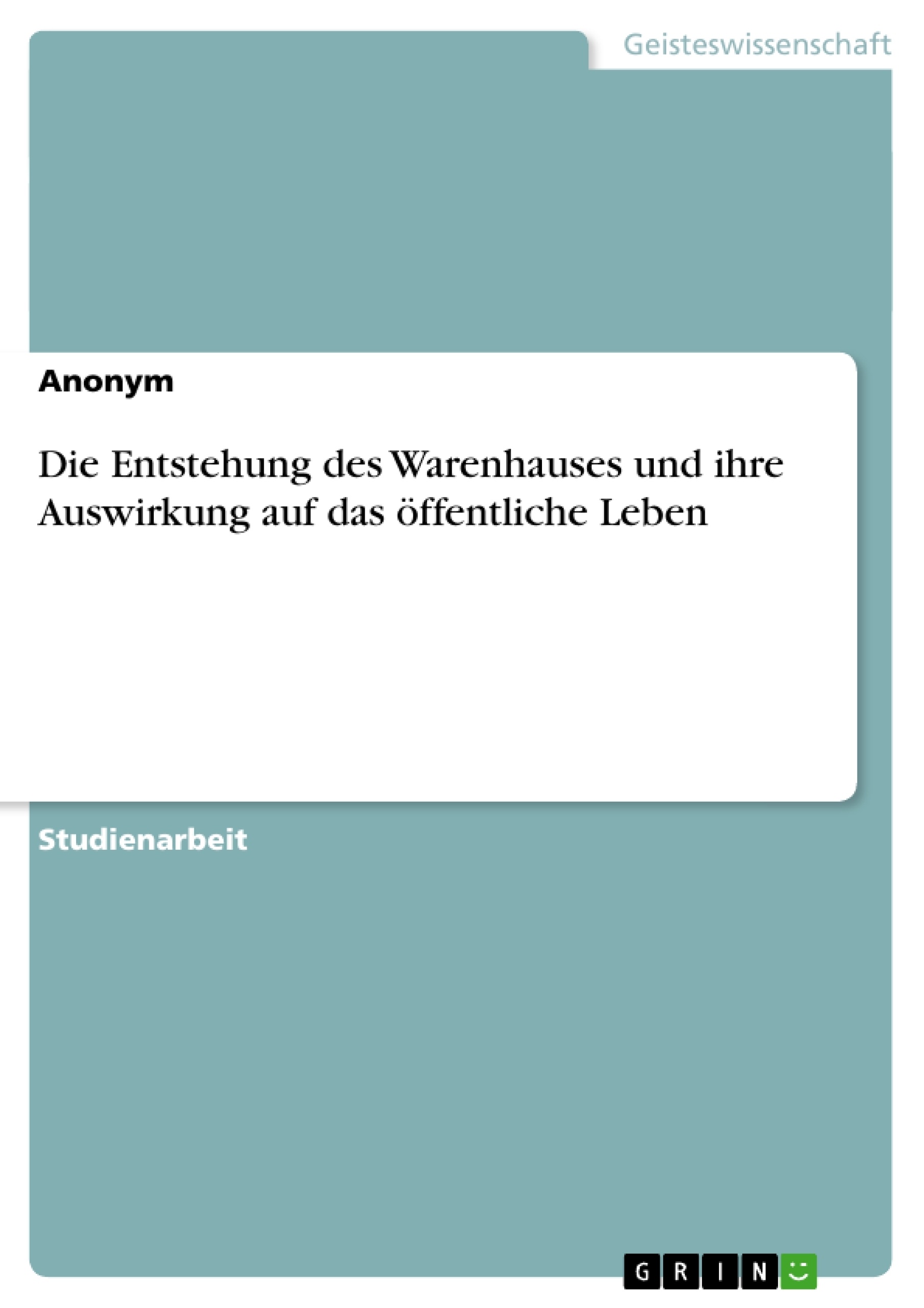Im Seminar „Das Leben in der Menge“ im Sommersemester 2005 haben wir uns mit der Industrialisierung, Metropolenbildung und den Menschen der Großstadt befasst. Dazu haben wir uns zunächst die Entstehung der Großstädte im 19. Jahrhundert angeschaut, um später auf die Eigenarten des Lebens in der Großstadt, wie Migration, Fremdheit und Isolation, einzugehen. Im Text „Die Auswirkungen des Industriekapitalismus auf das öffentliche Leben“ von Richard Sennett wird die große Zuwanderung und das enorme Bevölkerungswachstum in den Städten Paris und London beschrieben. Die Lokalisierung der Städte führte zu Fremdheit und Isolation zwischen den gesellschaftlichen Klassen. Anhand des Warenhauses veranschaulicht Sennett, wie sich die Öffentlichkeit durch den Industriekapitalismus veränderte. A n Stelle einer durch aktiven Austausch geprägten Öffentlichkeit, die um jeden neu erworbenen Artikel feilschen muss, trat eine andere, intensivere, aber weniger gesellige Öffentlichkeitserfahrung. 1
In der folgenden Arbeit möchte ich zunächst den Inhalt des Textes „Die Auswirkungen des Industriekapitalismus auf das öffentliche Leben“ zusammenfassen und den Autor Richard Sennett vorstellen. Im Gliederungspunkt 3 beschäftige ich mich vertiefend mit der Entstehung des Warenhauses, die bereits in Richard Sennetts Text erläutert wird. Ich werde zum Beispiel fragen: Welche Voraussetzungen waren nötig, um ein Warenhaus gründen und erfolgreich leiten zu können? Wie wurde das Warenhaus als neue Form des Einzelhandels von der Bevölkerung aufgenommen - gab es auch kritische Stimmen? Welche Neuerungen des Verkaufs wurden im Warenhaus umgesetzt und welche Auswirkungen hatten diese auf das Verhalten von Käufer und Verkäufer? Welche Anreize hatte das neue Warenhaus für die potentiellen Kunden? Warum fuhren sie erst ins Stadtzentrum, um einkaufen zu gehen und blieben nicht in ihren eigenen Vierteln? Und schließlichwas meint Richard Sennett mit der „ Mystifikation der öffentlichen Erscheinungsbilder“ 2?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- „Die Auswirkungen des Industriekapitalismus auf das öffentliche Leben“ (Richard Sennett, 2002)
- Zusammenfassung des Textes
- Kurze Vorstellung des Autors Richard Sennett
- Die Entstehung des Warenhauses
- Voraussetzungen für die Entstehung des Warenhauses
- Festpreis statt Feilschen
- Freier Eintritt ohne Kaufverpflichtung
- Eine neue Verkaufspsychologie
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text von Richard Sennett analysiert die Auswirkungen des Industriekapitalismus auf das öffentliche Leben im 19. Jahrhundert, insbesondere anhand der Entwicklung von Großstädten wie Paris und London. Der Fokus liegt dabei auf dem Wandel der öffentlichen Erfahrung, der durch das Aufkommen des Warenhauses und die damit verbundenen Veränderungen in Konsumverhalten und sozialer Interaktion geprägt wurde.
- Die Auswirkungen des Bevölkerungswachstums in Großstädten
- Die Entstehung der Warenöffentlichkeit
- Die Veränderung der Konsumkultur durch das Warenhaus
- Die Abkehr von aktiver Interaktion in der Öffentlichkeit
- Die Lokalisierung und soziale Segregation in der Stadt
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text gliedert sich in vier Abschnitte, die die Auswirkungen des Industriekapitalismus auf das öffentliche Leben beleuchten. Der erste Abschnitt beschreibt den Zuzug in die Metropolen Paris und London im 19. Jahrhundert und die Ursachen für dieses starke Bevölkerungswachstum. Im zweiten Abschnitt wird die "Lokalisierung" der Stadt behandelt, d.h. die Aufteilung in verschiedene Segmente und die damit verbundene Entmischung der gesellschaftlichen Klassen. Der dritte Abschnitt widmet sich dem Einfluss des Zufalls auf das bürgerliche Leben, insbesondere im Kontext der Börse und der noch unbekannten Konjunkturzyklen. Im letzten Abschnitt beleuchtet der Text die Entstehung der "Warenöffentlichkeit" und die Auswirkungen des Warenhauses auf Konsumverhalten und soziale Interaktion.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter des Textes sind Industriekapitalismus, Großstadtentwicklung, Warenhaus, öffentliches Leben, Konsumverhalten, Lokalisierung, soziale Segregation, Zufall, bürgerliches Leben, Mystifikation.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt das Warenhaus in der Theorie von Richard Sennett?
Sennett nutzt das Warenhaus als Beispiel dafür, wie der Industriekapitalismus die Öffentlichkeit von aktivem Austausch hin zu einer passiveren "Warenöffentlichkeit" veränderte.
Was änderte sich beim Einkaufen durch die Entstehung der Warenhäuser?
Anstelle des Feilschens traten Festpreise, freier Eintritt ohne Kaufzwang und eine neue Verkaufspsychologie, die auf visuelle Reize setzte.
Was versteht Sennett unter der "Lokalisierung" der Stadt?
Damit ist die Aufteilung der Großstädte in spezialisierte Segmente und die räumliche Trennung der sozialen Klassen gemeint.
Warum lockten Warenhäuser die Menschen in das Stadtzentrum?
Warenhäuser boten eine bisher unbekannte Warenvielfalt und ein intensives öffentliches Erlebnis, das in den eigenen Wohnvierteln nicht verfügbar war.
Was bedeutet "Mystifikation der öffentlichen Erscheinungsbilder"?
Es beschreibt den Prozess, bei dem Waren und Menschen in der Öffentlichkeit durch Kleidung und Inszenierung ihre soziale Identität verhüllen oder neu kodieren.
Welche Voraussetzungen ermöglichten den Erfolg der Warenhäuser?
Die Industrialisierung, das enorme Bevölkerungswachstum in Metropolen wie Paris und London sowie neue Logistik- und Produktionsmethoden waren entscheidend.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2005, Die Entstehung des Warenhauses und ihre Auswirkung auf das öffentliche Leben, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49389