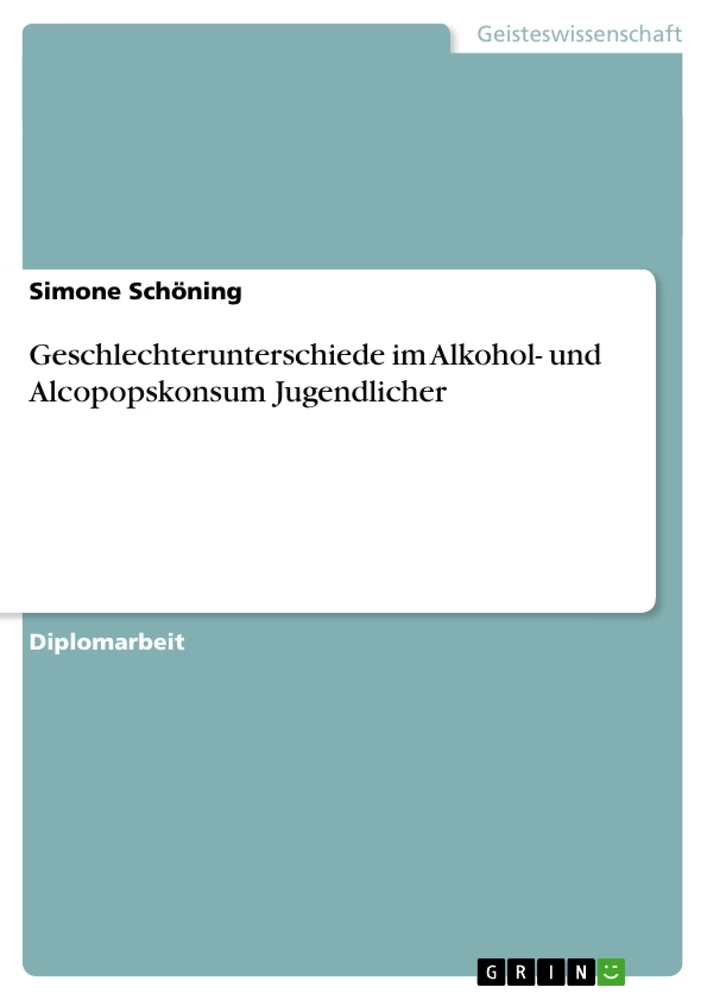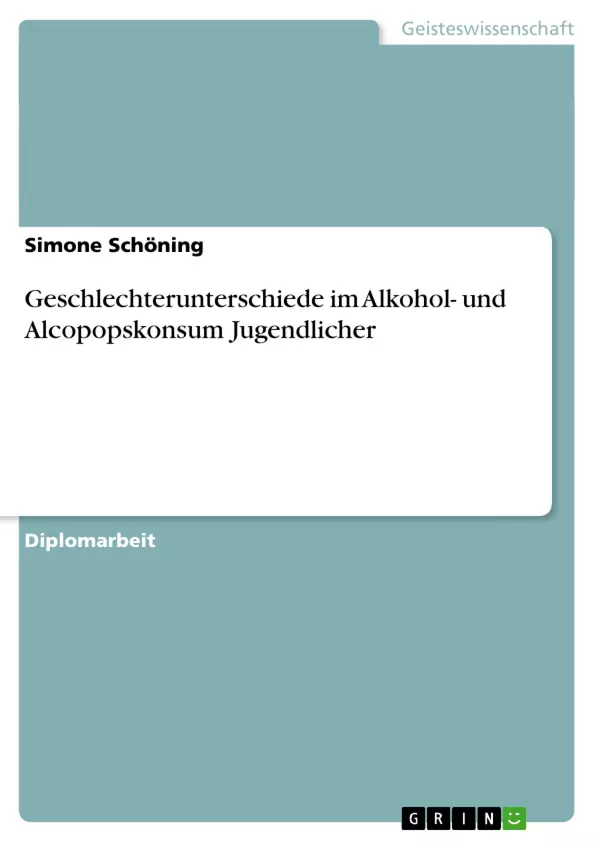Im Leben eines jeden Jugendlichen findet neben den vielfältigen Entwicklungen ein Austesten und Versuchen in diversen Lebenslagen statt. Dementsprechend probiert fast jeder Jugendliche früher oder später Alkohol.
Dies ist ein normaler und gesellschaftlich anerkannter Schritt im Entwicklungsprozess des Erwachsenwerdens.
Da dieser Lebensabschnitt jeden Menschen irgendwann betrifft und er eine besondere Schnittstelle im Leben eines jeden einzelnen in Bezug auf seine weitere Lebensgestaltung und -planung ist, ist das mehr oder weniger „Gelingen“ dieser Phase von großer Bedeutung. Des Weiteren ist der Erwerb des Konsumverhaltens eine Vorgabe, die sich mit ihren Konsequenzen durch das gesamte Leben ziehen wird.
Dieser Fakt wird sich in Zukunft nicht ändern und so verbleibt die Wichtigkeit der genauen Kenntnis über die geschlechtsspezifischen Bedürfnisse und Erfahrungen der Jugend, da hier vielfältige Ansatzpunkte der sozialarbeiterischen und sozialpädagogischen Tätigkeit vorhanden sind, die eine potentielle positive Beeinflussung des Verlaufs bei Fachkenntnis implizieren.
Da insbesondere der Alkohol- und Alcopopskonsum in der Jugend Risiken aufwirft, lege ich hier meinen Schwerpunkt, um darzustellen, inwiefern dies eine mögliche Gefährdung des Individuums beinhaltet.
Zusätzlich sollen missbräuchliche oder gar abhängige Konsummuster von normalem Entwicklungsverhalten abgegrenzt werden, u. a. um zu einer professionellen Arbeit in diesem Bereich zu verhelfen.
Um noch effizienter wirken zu können, ist das Wissen über geschlechtsspezifische Formen und Zielsetzungen des Konsums von Bedeutung, weshalb hier ebenfalls eine Fokussierung erfolgt.
In der vorliegenden Arbeit werde ich mich damit beschäftigen, inwiefern der Alkohol- und Alcopopskonsum tatsächlich vorliegt und vor allem, welche Rolle dabei die beiden Geschlechter spielen.
Sofern ein differenziertes Konsumverhalten festzustellen ist, ist zu klären, ob dies einen Einfluss auf die Geschlechterrollen hat.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Alkohol
- 2.1 Historische und kulturelle Entwicklung des Alkoholkonsums
- 2.2 Definition Alkohol/Alkopops
- 2.3 Wirkung des Alkohols
- 2.4 Alkoholkonsum in der Gesellschaft
- 2.5 Wirtschaftliche Bedeutung
- 3. Reifung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
- 3.1 Kindheit
- 3.1.1 Säuglingsalter und frühe Kindheit
- 3.1.2 Kleinkind-Vorschulalter
- 3.1.2.1 Spiel
- 3.1.2.2 Identifikation mit dem Geschlecht
- 3.1.2.3 Geschlechtskonstanz
- 3.1.3 Schulalter
- 3.2 Jugend und Adoleszenz
- 3.2.1 Pubertät
- 3.2.2 Biologische Veränderungen
- 4. Selbst und Identität
- 4.1 Emotionale Ablösung von den Eltern
- 4.2 Geschlechtsspezifische Sozialisation
- 4.2.1 Soziale und kulturelle Konstruktion von Geschlechtlichkeit
- 4.2.2 Körpersozialisation
- 5. Risikoverhalten Jugendlicher
- 5.1 Kontext der Lebenssituation
- 5.1.1 Subjektive Problemlagen
- 5.1.2 Schule und Beruf
- 5.1.3 Verhältnis zu den Eltern
- 5.1.4 Peer-Group
- 5.2 Formen des Risikoverhaltens
- 5.2.1 Stressrisiko
- 5.2.2 Drogenrisiko
- 5.2.3 Delinquenzrisiko
- 5.3 Geschlechtsspezifisches Risikoverhalten
- 6. Alkoholkonsum
- 6.1 Alcopops
- 6.2 Physische Auswirkungen
- 6.3 Psychische Auswirkungen
- 6.4 Soziale Auswirkungen
- 6.4.1 Familie
- 6.4.2 Peer-Group
- 6.4.3 Schule
- 6.4.4 Berufsausbildung
- 6.5 Geschlechtsspezifische Bedeutung
- 6.5.1 Jungen
- 6.5.2 Mädchen
- 7. Prävention
- 7.1 Edukativ-kommunikative Maßnahmen
- 7.1.1 Familie
- 7.1.2 Schule und Berufsausbildung
- 7.1.3 Berufsausbildung
- 7.1.4 Jugendarbeit
- 7.1.5 Beratung
- 7.1.6 Gesundheitliche Aufklärung
- 7.1.7 Öffentlichkeitsarbeit
- 7.2 Strukturelle Maßnahmen
- 7.2.1 Jugendschutzgesetz
- 7.2.2 Minderung der Verfügbarkeit
- 7.2.3 Nachfrage- und Angebotsreduzierung
- 7.2.4 Gesetzgeberische Maßnahmen
- 7.3 Geschlechtsspezifische Prävention
- 8. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit dem Alkohol- und Alcopopskonsum Jugendlicher, insbesondere mit dem Fokus auf geschlechtsspezifische Unterschiede im Konsumverhalten und den damit verbundenen Folgen. Die Arbeit untersucht, inwiefern sich die geschlechtsspezifische Sozialisation und die Rollenbilder auf das Konsumverhalten von Jungen und Mädchen auswirken.
- Entwicklung und Reifung von Kindern und Jugendlichen im Kontext des Alkoholkonsums
- Soziale und kulturelle Konstruktion von Geschlechtlichkeit und ihre Auswirkungen auf das Risikoverhalten Jugendlicher
- Analyse des Alkohol- und Alcopopskonsums in der Jugend, inklusive der Auswirkungen auf die physische, psychische und soziale Gesundheit
- Zusammenhänge zwischen dem Konsumverhalten und geschlechtsspezifischen Rollenbildern
- Präventionsmaßnahmen im Bereich des Alkoholkonsums und deren Wirksamkeit, insbesondere im Hinblick auf geschlechtsspezifische Ansätze
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und beleuchtet die Relevanz des Alkohol- und Alcopopskonsums in der Jugend. Kapitel 2 befasst sich mit der historischen Entwicklung des Alkoholkonsums, der Definition von Alkohol und Alcopops sowie den gesundheitlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen des Alkoholkonsums. Kapitel 3 untersucht die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, insbesondere die pubertäre Entwicklung und die damit verbundenen biologischen und psychosozialen Veränderungen. Kapitel 4 widmet sich der Entstehung von Selbst und Identität im Jugendalter, mit einem Schwerpunkt auf der Rolle der geschlechtsspezifischen Sozialisation. Kapitel 5 analysiert Risikoverhalten bei Jugendlichen, wobei die Faktoren, die zu riskantem Verhalten führen, sowie die geschlechtsspezifischen Unterschiede betrachtet werden. Kapitel 6 beleuchtet den Alkoholkonsum im Detail, inklusive der physischen, psychischen und sozialen Auswirkungen. Dabei wird insbesondere auf die geschlechtsspezifische Bedeutung des Alkoholkonsums eingegangen. Schließlich werden in Kapitel 7 verschiedene Präventionsmaßnahmen im Bereich des Alkoholkonsums vorgestellt und diskutiert, wobei ein Fokus auf die Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Aspekte gelegt wird.
Schlüsselwörter
Alkoholkonsum, Alcopops, Jugendliche, Geschlecht, Sozialisation, Risikoverhalten, Prävention, Geschlechterrollen, Auswirkungen, Entwicklung, Identität, Jugend, Gesundheit.
Häufig gestellte Fragen
Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede beim Alkoholkonsum von Jugendlichen?
Ja, Jungen und Mädchen zeigen unterschiedliche Konsummuster und Zielsetzungen. Jungen nutzen Alkohol oft zur Selbstdarstellung, während Mädchen andere Motive und Risikowahrnehmungen haben.
Was sind Alcopops und warum sind sie für Jugendliche riskant?
Alcopops sind süße, alkoholhaltige Mixgetränke. Durch den Zucker wird der bittere Alkoholgeschmack überdeckt, was zu einem schnelleren und unkontrollierteren Konsum führt.
Wie beeinflusst die geschlechtsspezifische Sozialisation das Trinkverhalten?
Soziale Rollenbilder und die Konstruktion von Männlichkeit oder Weiblichkeit prägen, wie riskant sich Jugendliche verhalten, um Anerkennung in ihrer Peer-Group zu finden.
Ab wann spricht man bei Jugendlichen von missbräuchlichem Konsum?
Die Arbeit grenzt normales Entwicklungsverhalten (Austesten) von missbräuchlichen Mustern ab, bei denen Alkohol zur Problembewältigung oder unter ständigem Gruppenzwang konsumiert wird.
Welche Rolle spielt die Peer-Group beim Alkoholkonsum?
Die Peer-Group ist ein zentraler Faktor. Der Wunsch nach Zugehörigkeit und die Identifikation mit Gleichaltrigen können riskantes Konsumverhalten sowohl fördern als auch hemmen.
Was zeichnet eine effektive geschlechtsspezifische Prävention aus?
Effektive Prävention berücksichtigt die unterschiedlichen Bedürfnisse von Jungen und Mädchen und setzt nicht nur auf Aufklärung, sondern auch auf die Stärkung der Identität und alternative Problemlösungsstrategien.
- Citar trabajo
- Simone Schöning (Autor), 2005, Geschlechterunterschiede im Alkohol- und Alcopopskonsum Jugendlicher, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49403