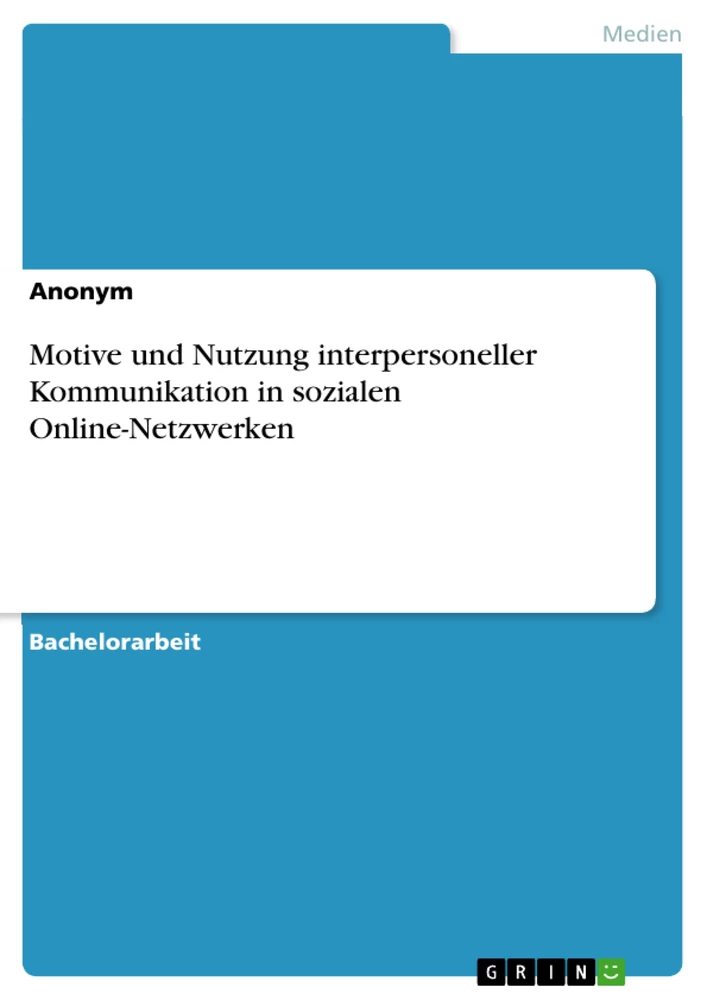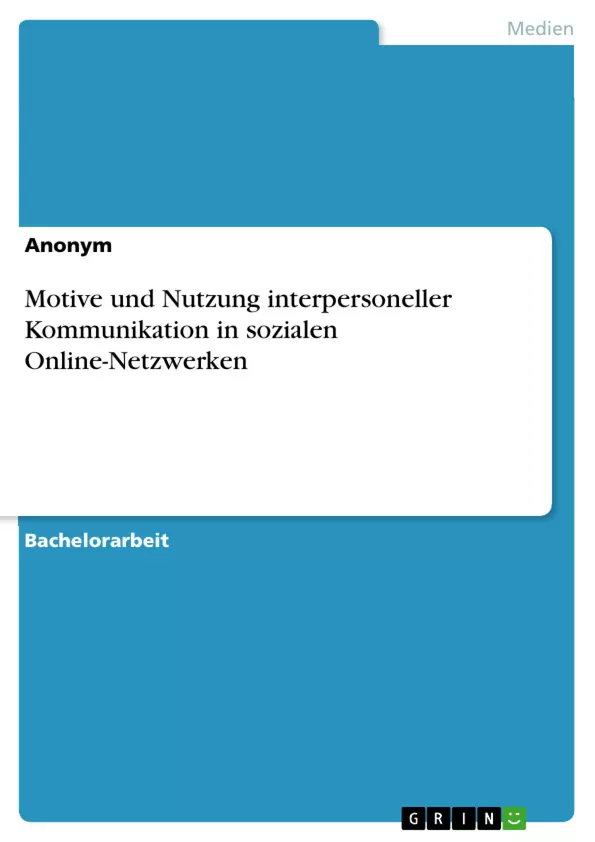Welche Motive haben junge Erwachsene im Alter von 20 bis 30 Jahren zur Nutzung von Facebook, WhatsApp, Instagram und Snapchat?
Ob Facebook, WhatsApp, Instagram oder Snapchat: Die sozialen Online-Netzwerke lassen unser aller Leben immer digitaler werden. Der schnelle WhatsApp-Chat ersetzt überwiegend die SMS oder den kurzen Anruf. Mit Statusmeldungen, Schnappschüssen oder Kurzvideos werden Meinungen und Erlebnisse in Sekundenschnelle mit FreundInnen geteilt. In der heutigen Zeit steht ein Meer aus vielen Möglichkeiten der Interaktion und des Zeitvertreibs zur Verfügung. Durch den technologischen Fortschritt und dem Aufkommen des Internets, konnte sich Anfang des zweiten Jahrzehnts im 21. Jahrhundert das Zeitalter der sozialen Netzwerke etablieren.
Durch die Entstehung von zahlreichen, zuvor noch nie dagewesenen Medien, fanden auch neue Kommunikationswege ihren Platz in der Gesellschaft. Die Suchmaschine ‚Google‘ ersetzt für viele die Enzyklopädie, Facebook ist das neue Adressbuch, Instagram ist das digitale Fotoalbum und Snapchat wird von vielen NutzerInnen als öffentliches Tagebuch genutzt. Diese Entwicklung vermutete der Wissenschaftler Krotz (2001: 19) bereits zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Er ging davon aus, dass durch die gesellschaftliche Veränderung und die stetige Entwicklung zahlreicher neuer Medien, sich die Kommunikation über diese immer weiter ausdehne. In diesem Zusammenhang hat sich auch das Verhalten der interpersonellen Kommunikation im digitalen Zeitalter verändert.
Das Internet, das die Grundlage für diese Veränderung geschaffen hat, ermöglicht unzählige Optionen zum Kommunikationsaustausch mit anderen Personen. So bewertet Krotz (2001: 23 u. 35) das Internet als Kommunikationsraum, welcher sowohl interpersonale als auch Medienkommunikation impliziert und die Gleichzeitigkeit von Handlungen fördert. So finden „Alltagshandeln und Kommunikation [...] zunehmend sowohl räumlich als auch zeitlich und sinnbezogen auf medienvermittelte Weise statt. Die Medien werden auch wichtiger, was soziale Gelegenheiten, Inhalte und Formen von Kommunikation angeht“ (Krotz 2001: 35). Hierbei stellt sich die Frage nach der Wichtigkeit bestimmter Medien. Wofür und auf welche Weise werden diese von den RezipientInnen verwendet?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fragestellung und Zielsetzung
- Relevanz und Forschungsstand
- Aufbau und Vorgehensweise
- Das Web 2.0 und die sozialen Netzwerke
- Definition
- Anwendungen
- Soziale Online-Netzwerke
- Snapchat
- Kurzüberblick über die bisherigen Ergebnisse
- Theoretische Verortung
- Uses- and Gratifications-Approach
- Bedürfniskategorien
- Weiterentwicklungen des U&G-Approaches
- Uses-and-Gratification-Ansatz im Online-Bereich
- Kritik am Uses- and Gratifications-Approach
- Zwischenfazit
- Methodisches Vorgehen
- Das problemzentrierte Leitfadeninterview
- Definition und die qualitative Erhebungsmethode
- Konzeption des Interviewleitfadens
- Auswahl der befragten Personen
- Datenerhebung, Durchführung und Auswertung
- Durchführung der Befragung
- Aufbereitung und Auswertung der Daten
- Darstellung der Ergebnisse und Einordnung in den theoretischen Rahmen
- Kognitive Motive
- Affektive Motive
- Interaktive Motive
- Identitätsbildende Motive
- Zeitbezogene Motive
- Integrative Motive
- Schluss
- Reflexion der Theorie
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit den Motiven und der Nutzung interpersoneller Kommunikation in sozialen Online-Netzwerken. Ziel ist es, die verschiedenen Motive der NutzerInnen für die Nutzung dieser Plattformen zu erforschen und in den theoretischen Rahmen des Uses-and-Gratifications-Ansatzes einzubinden. Die Arbeit untersucht die Nutzung von sozialen Online-Netzwerken aus der Perspektive der NutzerInnen und analysiert, welche Bedürfnisse diese durch die Nutzung dieser Plattformen befriedigen.
- Die Bedeutung und Entwicklung von sozialen Online-Netzwerken im Web 2.0
- Die Anwendung des Uses-and-Gratifications-Ansatzes im Kontext der Nutzung von sozialen Online-Netzwerken
- Die Analyse der Motive für die Nutzung von sozialen Online-Netzwerken durch qualitative Interviews
- Die Einordnung der Ergebnisse in den theoretischen Rahmen des Uses-and-Gratifications-Ansatzes
- Die Reflexion des Uses-and-Gratifications-Ansatzes im Kontext der Ergebnisse der Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der interpersonellen Kommunikation in sozialen Online-Netzwerken ein und stellt die Fragestellung sowie die Zielsetzung der Arbeit dar. Des Weiteren werden die Relevanz des Themas und der aktuelle Forschungsstand beleuchtet. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Web 2.0 und den sozialen Netzwerken, wobei die Definition, Anwendungen und die Funktionsweise von sozialen Online-Netzwerken wie Facebook, WhatsApp, Instagram und Snapchat näher erläutert werden.
Das dritte Kapitel stellt den Uses-and-Gratifications-Approach vor, welcher im weiteren Verlauf der Arbeit als theoretischer Rahmen für die Analyse der Ergebnisse dienen soll. Es werden die zentralen Annahmen des Ansatzes sowie die verschiedenen Bedürfniskategorien und Weiterentwicklungen beleuchtet. Das vierte Kapitel erläutert die methodische Vorgehensweise der Arbeit, insbesondere die Anwendung des problemzentrierten Leitfadeninterviews als qualitative Erhebungsmethode.
Das fünfte Kapitel beschreibt die Durchführung der Datenerhebung sowie die Aufbereitung und Auswertung der Daten. Im sechsten Kapitel werden die Ergebnisse der Interviews dargestellt und in den theoretischen Rahmen des Uses-and-Gratifications-Ansatzes eingeordnet. Hierbei werden die verschiedenen Motive für die Nutzung von sozialen Online-Netzwerken anhand der Ergebnisse der Interviews analysiert.
Schlüsselwörter
Soziale Online-Netzwerke, Interpersonelle Kommunikation, Uses-and-Gratifications-Ansatz, Qualitative Forschung, Leitfadeninterview, Motive, Bedürfnisse, Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, Web 2.0, Digitalisierung, Mediennutzung, Kommunikation im Internet.
Häufig gestellte Fragen
Welche Motive untersuchen junge Erwachsene bei der Nutzung sozialer Netzwerke?
Die Arbeit untersucht kognitive, affektive, interaktive, identitätsbildende, zeitbezogene und integrative Motive bei der Nutzung von Plattformen wie Facebook und WhatsApp.
Was ist der Uses-and-Gratifications-Ansatz?
Der Uses-and-Gratifications-Ansatz ist ein theoretischer Rahmen, der analysiert, warum Menschen bestimmte Medien nutzen und welche Bedürfnisse sie damit befriedigen möchten.
Welche sozialen Netzwerke werden in dieser Studie analysiert?
Die Studie konzentriert sich auf die Nutzung von Facebook, WhatsApp, Instagram und Snapchat durch junge Erwachsene im Alter von 20 bis 30 Jahren.
Wie hat sich die interpersonelle Kommunikation durch das Internet verändert?
Die Kommunikation findet zunehmend medienvermittelt statt, wobei soziale Netzwerke traditionelle Wege wie SMS oder Anrufe weitgehend ersetzen.
Welche Forschungsmethode wurde für diese Bachelorarbeit verwendet?
Es wurde eine qualitative Erhebungsmethode in Form von problemzentrierten Leitfadeninterviews angewandt.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2016, Motive und Nutzung interpersoneller Kommunikation in sozialen Online-Netzwerken, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/494052