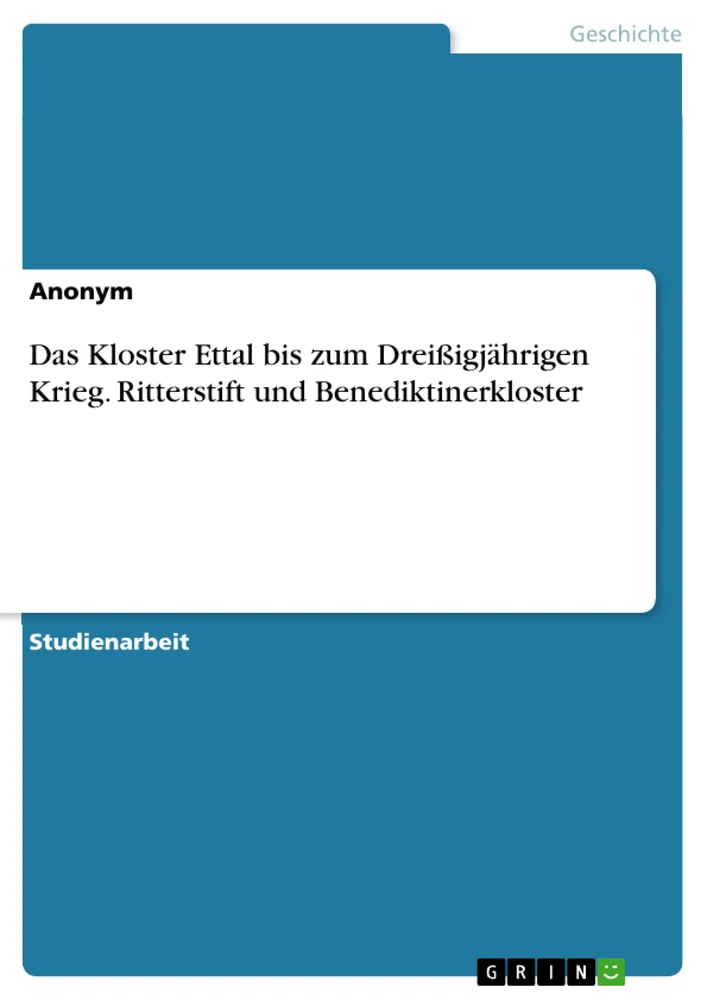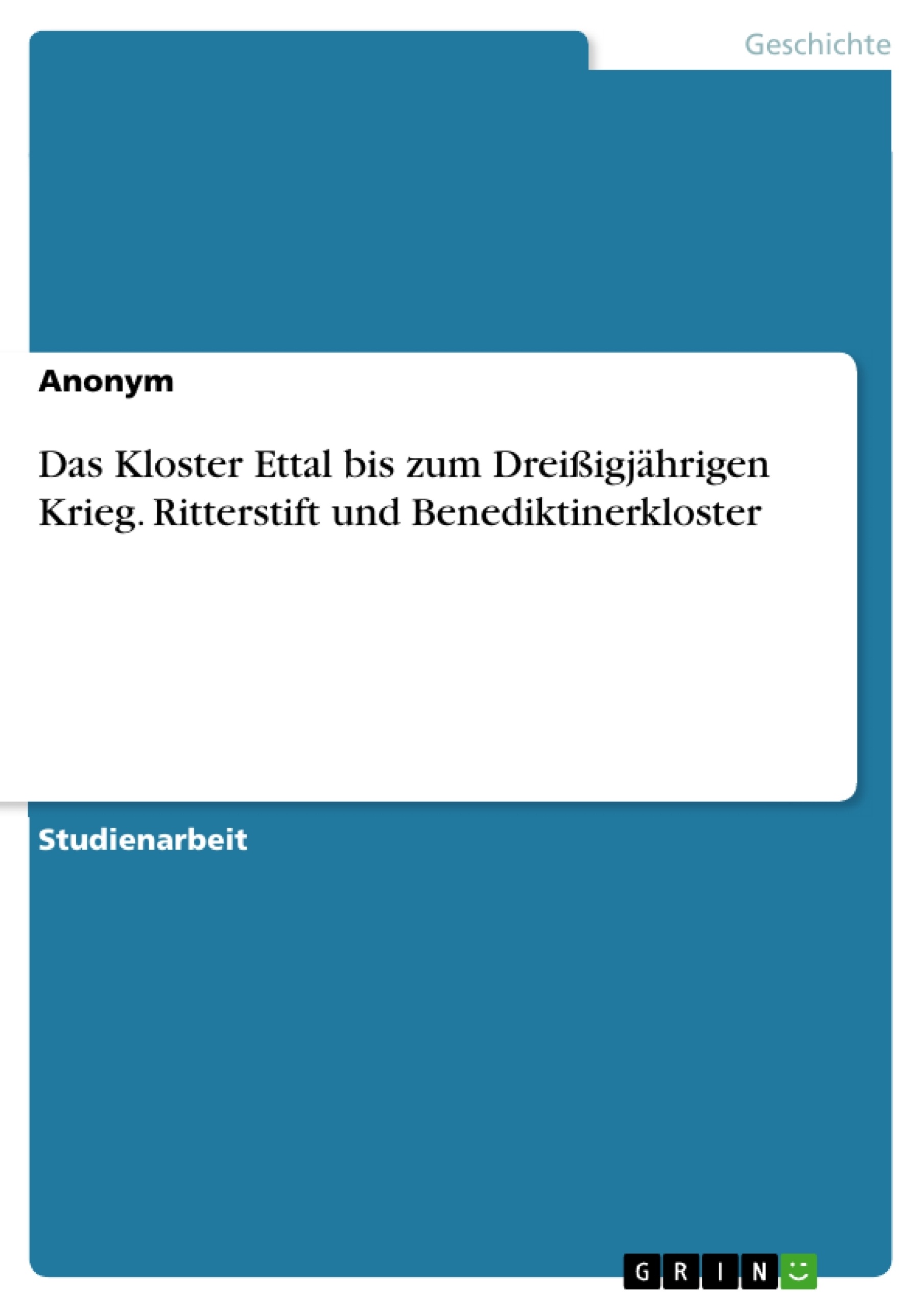In dieser Hausarbeit wird das Kloster Ettal vorgestellt. Unter Einbeziehung der Quellen wird die Entstehung des Klosters und des Ritterstifts, sowie die interessante Vorgeschichte dargelegt. Darüber hinaus werden die Ritterregeln und ihre entsprechenden Auswirkungen auf den Klosteralltag vorgestellt.
Es erfolgt eine genaue Abgrenzung des Grundbesitzes und der entsprechenden Rechte zur jeweiligen Zeit, was die schnell wachsende Bedeutung des Klosters für Kaiser Ludwig verdeutlicht. Abschließend werden einige besondere Ereignisse der Zeit nach dem Tod des Kaisers 1347, sowie im Zeitraum zwischen Reformation und dem dreißigjährigen Krieg geschildert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Entstehung des Klosters Ettal
- Die Namensgebung des Klosters
- Die Kirche des Klosters
- Die mittelalterliche Klosteranlage
- Geistliche Bewohner des Klosters
- Das Ritterstift
- Die Gründung des Ritterstifts
- Die Ritterregeln
- Strafen bei Nichteinhaltung der Ritterregeln
- Zusammenleben zwischen Rittern und Mönchen
- Grundbesitz und Rechte
- Erste Phase: 1330-1332
- Zweite Phase: 1339 - 1343
- Die Zeit nach dem Tod des Kaisers
- Von der Reformation bis zum dreißigjährigen Krieg
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit hat zum Ziel, die Geschichte des Benediktinerklosters Ettal, insbesondere seine Gründung und das zugehörige Ritterstift, umfassend darzustellen. Die Arbeit beleuchtet die verschiedenen Motive hinter der Gründung durch Kaiser Ludwig den Bayern und analysiert die Organisation und das Zusammenleben innerhalb des Klosters, unter Berücksichtigung der Ritterregeln und des Grundbesitzes.
- Die Gründung des Klosters Ettal und die Motive Kaiser Ludwigs
- Das Ritterstift und die spezifischen Ritterregeln
- Das Zusammenleben von Mönchen und Rittern im Kloster Ettal
- Die Entwicklung des Grundbesitzes und der Rechte des Klosters
- Wichtige Ereignisse nach dem Tod Kaiser Ludwigs
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die Forschungslage zur Geschichte des Klosters Ettal. Sie benennt die verwendeten Quellen, darunter bedeutende Werke zur Geschichte Bayerns und des Mittelalters, und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Die Entstehung des Klosters Ettal: Dieses Kapitel beschreibt die Gründung des Klosters Ettal am 28. April 1330 durch Kaiser Ludwig den Bayern. Es beleuchtet verschiedene Motive für die Gründung, von religiösen Gelübden bis hin zu politischen und wirtschaftlichen Strategien Ludwigs. Die Erwähnung eines Gelöbnisses gegenüber einem Mönch und die strategische Lage an einer wichtigen Handelsroute werden als entscheidende Faktoren hervorgehoben. Die Bedeutung der Gründung für den Kaiser, inklusive der Versorgung verdienter Ritter, wird ebenfalls diskutiert.
Die Namensgebung des Klosters: Dieses Kapitel analysiert den Ursprung des Namens "Ettal". Es werden zwei Theorien vorgestellt: Die Ableitung vom althochdeutschen "Etal" (Gesetz, Gelöbnis) und die Interpretation als "unser Frauen Etal" (Mariental) aufgrund des Sprachgebrauchs Kaiser Ludwigs. Beide Interpretationen werden im Kontext der Gründung und der religiösen Bedeutung des Klosters diskutiert.
Die Kirche des Klosters: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Architektur der Ettaler Klosterkirche. Die besondere Bauweise als Zwölfeckbau mit einer Mittelsäule, die in dieser Form im Deutschen Reich selten ist, wird als herausragende architektonische Besonderheit hervorgehoben und ihre Bedeutung für den heutigen Tourismus angesprochen. Es werden auch offene Fragen zur Baugeschichte und zur Konstruktion des Gewölbes angesprochen.
Die mittelalterliche Klosteranlage: [Da der Text keine weiteren Informationen zu diesem Kapitel enthält, kann hier keine Zusammenfassung gegeben werden.]
Schlüsselwörter
Benediktinerkloster Ettal, Kaiser Ludwig der Bayer, Ritterstift, Ritterregeln, Mittelalter, Gründung, Grundbesitz, religiöse Motive, politische Strategien, wirtschaftliche Bedeutung, Architektur, Klosterkirche.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Benediktinerkloster Ettal
Was ist der Gegenstand der Hausarbeit?
Die Hausarbeit befasst sich umfassend mit der Geschichte des Benediktinerklosters Ettal, insbesondere seiner Gründung durch Kaiser Ludwig den Bayern und dem zugehörigen Ritterstift. Sie analysiert die Motive hinter der Gründung, die Organisation und das Zusammenleben innerhalb des Klosters (Mönche und Ritter), die Ritterregeln, den Grundbesitz und die Entwicklung des Klosters nach dem Tod Kaiser Ludwigs.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: die Gründung des Klosters und die Motive Kaiser Ludwigs, das Ritterstift und seine Regeln, das Zusammenleben von Mönchen und Rittern, die Entwicklung des Grundbesitzes und der Rechte des Klosters, wichtige Ereignisse nach dem Tod Kaiser Ludwigs, die Namensgebung des Klosters und die Architektur der Klosterkirche.
Wie ist die Hausarbeit aufgebaut?
Die Hausarbeit ist gegliedert in Kapitel zur Einleitung, Entstehung des Klosters, Namensgebung, Klosterkirche, mittelalterlicher Klosteranlage, geistlichen Bewohnern, dem Ritterstift (Gründung, Regeln, Strafen, Zusammenleben), Grundbesitz und Rechten (einschließlich zeitlicher Phasen), der Zeit nach dem Tod des Kaisers, der Entwicklung vom Reformation bis zum Dreißigjährigen Krieg und einem Fazit. Zusätzlich beinhaltet sie ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Einleitung der Hausarbeit nennt die verwendeten Quellen, darunter bedeutende Werke zur Geschichte Bayerns und des Mittelalters. Die genauen Quellenangaben sind im Haupttext der Hausarbeit zu finden (diese sind in der Vorschau nicht vollständig enthalten).
Welche Motive werden für die Gründung des Klosters Ettal genannt?
Die Hausarbeit nennt verschiedene Motive für die Gründung des Klosters durch Kaiser Ludwig den Bayern: religiöse Gelübde (möglicherweise ein Gelöbnis gegenüber einem Mönch), politische und wirtschaftliche Strategien (strategische Lage an einer wichtigen Handelsroute), und die Versorgung verdienter Ritter.
Was ist das Ritterstift und welche Rolle spielte es?
Das Ritterstift war ein integraler Bestandteil des Klosters Ettal. Die Hausarbeit untersucht die Gründung des Ritterstifts, die spezifischen Ritterregeln, die Strafen bei deren Nichteinhaltung und das Zusammenleben zwischen Rittern und Mönchen.
Wie ist die Klosterkirche architektonisch gestaltet?
Die Klosterkirche ist als Zwölfeckbau mit einer Mittelsäule gestaltet, eine im Deutschen Reich seltene Bauweise. Ihre architektonische Besonderheit und Bedeutung für den Tourismus werden hervorgehoben. Offene Fragen zur Baugeschichte und Konstruktion des Gewölbes werden ebenfalls angesprochen.
Welche Bedeutung hat die Namensgebung des Klosters "Ettal"?
Die Hausarbeit diskutiert zwei Theorien zur Namensgebung: die Ableitung vom althochdeutschen "Etal" (Gesetz, Gelöbnis) und die Interpretation als "unser Frauen Etal" (Mariental). Beide Interpretationen werden im Kontext der Gründung und der religiösen Bedeutung des Klosters betrachtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Benediktinerkloster Ettal, Kaiser Ludwig der Bayer, Ritterstift, Ritterregeln, Mittelalter, Gründung, Grundbesitz, religiöse Motive, politische Strategien, wirtschaftliche Bedeutung, Architektur, Klosterkirche.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2018, Das Kloster Ettal bis zum Dreißigjährigen Krieg. Ritterstift und Benediktinerkloster, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/494087