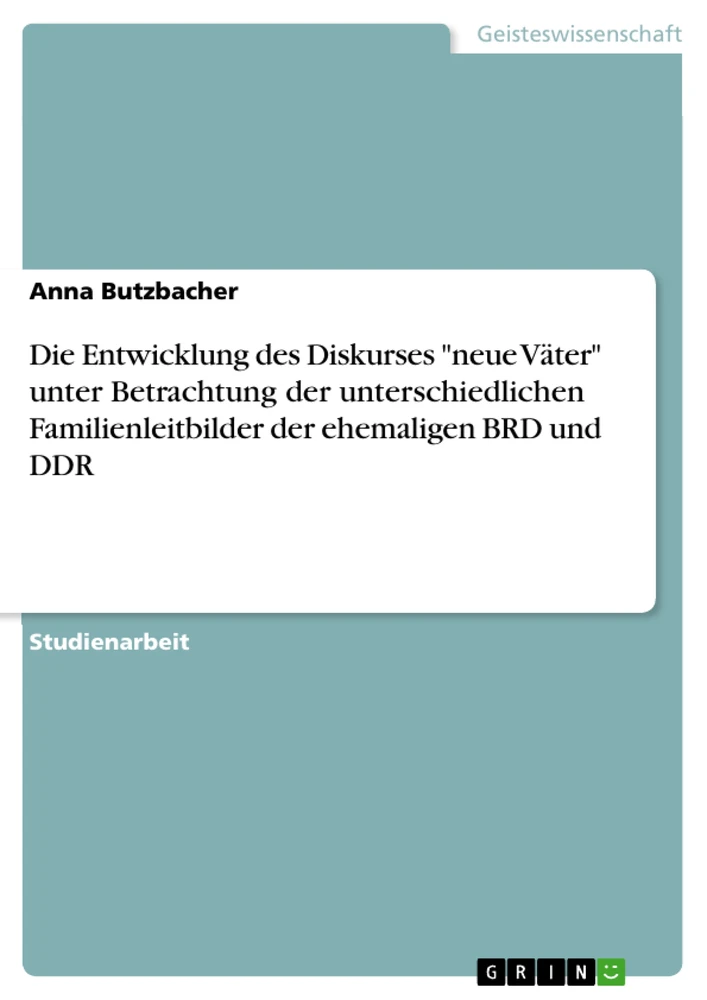In der folgenden Arbeit soll geprüft werden, ob das Bild des "neuen" Vaters auf ganz Deutschland zutrifft und wo genau die Unterschiede beziehungsweise die Gemeinsamkeiten liegen. Chancengleichheit 2017, was bedeutet das? Vor allem gleiche Rechte, gleiche Aussichten auf dem Arbeitsmarkt, gleicher Lohn und die Frauenquote in Führungsbereichen. All diese Dinge zielen auf eines ab: Die Emanzipation der Frau mit dem Ziel der Gleichberechtigung für eben diese. Doch wo bleibt in diesem Diskurs die Integration der Männer in Lebensbereiche, die die Frauen im Zuge der Loslösung von traditionellen Rollenverteilungen verlassen wollen? Meistens denkt man bei dem Wort Gleichberechtigung ja nicht daran, dass auch Männer betroffen sind, wenn es um eine neue Gewichtung der Waagschalen zwischen Arbeitswelt und Familienleben geht. Dabei ist dies ein wichtiger Aspekt im Bereich der Gleichberechtigung, zumal damit auch allgemeine Männlichkeitsvorstellungen und Rollenerwartungen verbunden sind.
Im Zuge dessen wird die Stellung des Vaters innerhalb der Kernfamilie seit etwa 30 Jahren zunehmend thematisiert. Lag der Fokus vorher vor allem auf dem Beziehungsgeflecht zwischen Mutter und Kind, so gewinnt der Vaterschaftsdiskurs laufend mehr Interesse innerhalb der deutschen und europäischen Familiensoziologie. Das Vaterbild befindet sich im Wandel, weg vom traditionellen Rollenverständnis des Mannes als Ernährer und Oberhaupt der Familie, hin zum "neuen" und "involviertem" Vater, der sich aktiv am Familienalltag beteiligt. Neben neuartigen Konzepten der Kinderbetreuung impliziert der aufkommende Diskurs auch die egalitäre Stellung des Mannes in der Beziehung zur Mutter der Kinder und folglich in der ganzen Gesellschaft. Nicht nur die Frage nach einem Leitbild des neuen Vaters entsteht, sondern vielmehr die Frage nach einer neuen Männlichkeit.
Die Aufspaltung Deutschlands in Ost und West nach Ende des zweiten Weltkriegs und dem erneuten Zusammenschluss zu Beginn der 90er Jahre ermöglichte ein einmaliges geschichtliches Phänomen. Durch die unterschiedlichen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedingungen in beiden Teilstaaten entstanden im Laufe der Jahre auch zwei Verständnisse von Familie und den Rollen der einzelnen Akteure innerhalb dieses Konstrukts.
Inhaltsverzeichnis
- Zur Emanzipation des Mannes in seiner Rolle als Vater
- Einstieg: Definition des Ausdruckes der „neuen Väter“ und Unterschiede zum traditionellen Rollenbild des Vaters
- Familienleitbilder- eine Gegenüberstellung von DDR und BRD
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Grundsätze der Familienpolitik beider Teilstaaten
- Der Mann als Ernährer – Die Rolle des Vaters in der ehemaligen BRD
- Das Doppelverdiener-Modell in der DDR
- Was geschah nach der Wende?
- Spannungsfeld zwischen Erwerbsarbeit und Familienfürsorge
- Theorie und Praxis – inwiefern lässt sich das Konstrukt des neuen Vaters bereits verwirklichen?
- Hegemoniale Vaterschaftsvorstellungen trotz Gleichstellungspostulat im Westen
- Adult work-Modell und gegenläufige Enttraditionalisierung im Osten
- Fazit
- Die völlige Gleichberechtigung und Akzeptanz der neuen Väter als Prozess der Zukunft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung des Diskurses der „neuen Väter“ und analysiert, wie sich die unterschiedlichen Familienleitbilder der ehemaligen BRD und DDR auf die Wahrnehmung und die Rolle des Vaters ausgewirkt haben. Die Arbeit untersucht, inwiefern sich das traditionelle Vaterbild, das vor allem den Mann als Ernährer und Oberhaupt der Familie sah, in Richtung eines „neuen“ und „involvierten“ Vaters gewandelt hat, der aktiv am Familienalltag teilnimmt.
- Entwicklung des Diskurses der „neuen Väter“
- Vergleich der Familienleitbilder der ehemaligen BRD und DDR
- Untersuchung der Auswirkungen unterschiedlicher Familienpolitiken auf die Rolle des Vaters
- Analyse des Spannungsfelds zwischen Erwerbstätigkeit und Familienfürsorge
- Bewertung der Umsetzbarkeit des Konstrukts des „neuen Vaters“ in Ost- und Westdeutschland
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Emanzipation des Mannes in seiner Rolle als Vater und stellt den Wandel vom traditionellen zum „neuen“ Vater dar. Das zweite Kapitel definiert den Ausdruck der „neuen Väter“ und zeigt die Unterschiede zum klassischen Rollenbild des Vaters auf.
Das dritte Kapitel befasst sich mit den unterschiedlichen Familienleitbildern in der DDR und der BRD. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Familienpolitik der beiden Teilstaaten erläutert, sowie die Rolle des Vaters in der ehemaligen BRD und im Doppelverdiener-Modell der DDR dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die Themen Emanzipation, Vaterschaft, Familienleitbilder, Familienpolitik, Gleichstellung, BRD, DDR, Wiedervereinigung, Erwerbstätigkeit, Familienfürsorge, „neue Väter“ und Männlichkeitsvorstellungen.
Häufig gestellte Fragen
Wer sind die „neuen Väter“?
„Neue Väter“ sind Männer, die sich vom traditionellen Bild des alleinigen Ernährers lösen und sich aktiv und emotional am Familienalltag und der Kindererziehung beteiligen.
Wie unterschied sich die Vaterrolle in der DDR von der BRD?
In der DDR war das Doppelverdiener-Modell Standard, was die Vaterrolle beeinflusste, während in der BRD lange das Ernährermodell mit dem Mann als Oberhaupt dominierte.
Was bedeutet hegemoniale Vaterschaft?
Es beschreibt ein dominantes Vaterschaftsideal, das trotz Gleichstellungsbestrebungen oft noch an traditionellen männlichen Machtstrukturen festhält.
Welches Spannungsfeld besteht für moderne Väter?
Väter stehen oft im Konflikt zwischen den Anforderungen der Erwerbsarbeit und dem Wunsch nach intensiver Familienfürsorge.
Ist die Gleichberechtigung der Väter bereits abgeschlossen?
Nein, die Arbeit beschreibt dies als einen laufenden Prozess der Zukunft, der auch eine Neudefinition von Männlichkeit erfordert.
- Citation du texte
- Anna Butzbacher (Auteur), 2018, Die Entwicklung des Diskurses "neue Väter" unter Betrachtung der unterschiedlichen Familienleitbilder der ehemaligen BRD und DDR, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/495173