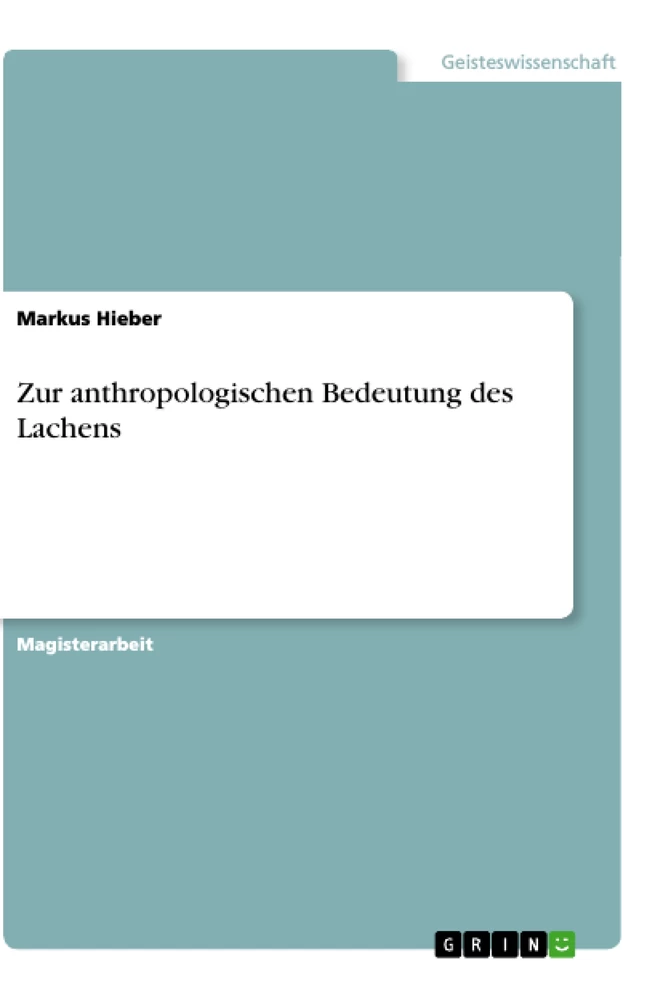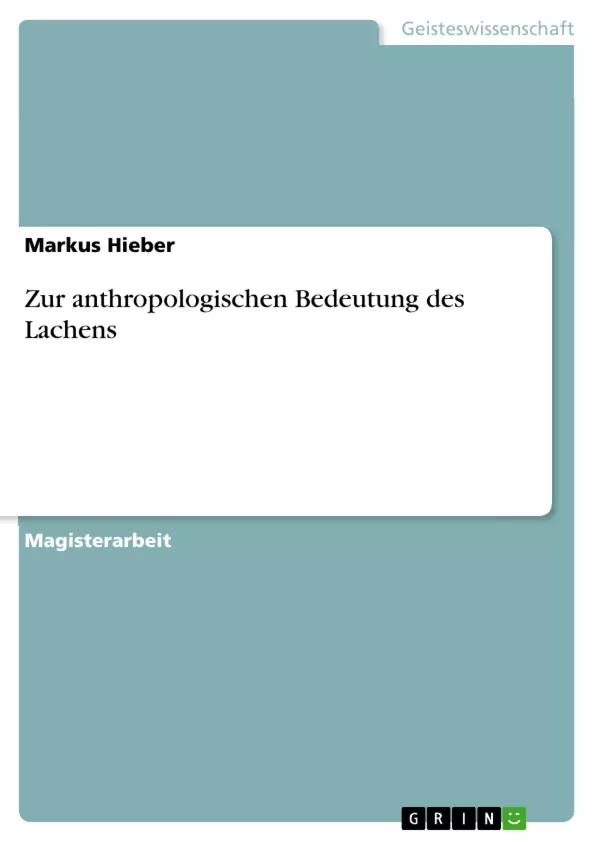Ich möchte in der vorliegenden Arbeit den zahlreichen Vorurteilen, was das Lachen sei, entgegentreten. Demgegenüber möchte ich eine ganz eigene Bestimmung des Lachens vorlegen, in der ich verschiedene Positionen zum Thema "Lachen" interpretiere, einer Prüfung unterziehe, die mir geeignet erscheinenden Teile herausnehme, um sie dann - mit eigenen Ideen und Überlegungen angereichert - zu einer hoffentlich geschlossenen und überzeugenden Theorie des Lachens zusammenzuführen. Mit dieser Untersuchung über das Lachen möchte ich zu einer Klärung beitragen, was der Mensch seinem Wesen nach ist.
Das Lachen offenbart eine Schwäche des Menschen, denn er kann dem Doppeldeutigen, dem Absurden und dem Paradoxen spontan nur selten adäquat begegnen und überantwortet sich daher in diesen Fällen der Reaktion seines Körpers. Der Mensch ist derart auf Ordnung und Vernunft fixiert, so dass ihm Unvernünftiges erst mal die Sprache verschlägt. Zugleich wird das spöttische Lachen vom Spottopfer oft als verletzend empfunden, weil das Lachen eine Kritik oder Mahnung an seinem Verhalten darstellt. Das Lachen, obwohl es spontan ausbricht und der Lachende eigentlich nichts dafür kann, erfüllt eine gesellschaftliche Funktion, die darin besteht, Menschen, die - ohne den aktuellen Veränderungen der Situation Rechnung zu tragen - automatisch handeln, auf die Gefährlichkeit ihres Tuns hinzuweisen.
Der Zusammenhang zwischen Normverletzung und unzulänglichem Lachen ist entstanden, weil der Verspottete aus der eigenen Erfahrung weiß, dass eine Person immer dann lacht, wenn eine andere Person absichtlich oder unabsichtlich nicht ordnungsgemäß handelt oder sich unvernünftig äußert. Er weiß, dass er eine Ordnung verletzt haben muß, wenn jemand anders ihn auslacht. Den Lachenden wiederum interessiert der angemahnte Fehler der ausgelachten Person aber nicht wirklich; er mahnt nicht mit voller Absicht an, sondern er erfüllt eine Funktion, ohne zu durchschauen, was er tut. Gesellschaftlich wurde ein Zusammenhang zwischen Lachen und Normverletzung konditioniert. Es ist durchaus der Gesellschaft zuträglich, wenn es Mechanismen gibt, mit denen Menschen das Verhalten ihrer Mitmenschen spiegeln können. Möglicherweise hat das Lachen über den anderen auf ihn eine pädagogische Wirkung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Das Motiv der vorliegenden Untersuchung
- 2. Plessner: Lachen als Ausdruck eines Mangels
- 2. 1. Die Theorie des Lachens in ihrem Zusammenhang
- 2. 2. Die Ausdrucksform des Lachens
- 2. 3. Die Anlässe des Lachens
- 2. 4. Der Zusammenhang zwischen Anlässen des Lachens und der Ausdrucksform des Lachens
- 2. 5. Mensch und Tier im Vergleich in bezug auf das Lachen
- 2. 6. Auswertung der Plessnerschen Theorie des Lachens
- 2. 6. 1. Wertvolle Erkenntnisse
- 2. 6. 2. Unschlüssigkeiten und Lücken in Plessners Theorie des Lachens
- 2. 6. 2. 1. Ist die Psyche des Tieres für den Menschen zugänglich?
- 2. 6. 2. 2. Sprachliche Doppeldeutigkeiten
- 2. 6. 2. 3. Fehlende Rückschlüsse von der Form des Lachens auf seine Funktion
- 2. 6. 2. 4. Prinzipielle oder relative Grenzen menschlichen Verhaltens
- 2. 6. 2. 5. Von Plessner selbst eingestandene Grenzen seiner Untersuchung
- 3. Worauf verweist Kränkung durch spöttisches Lachen?
- 3. 1. Verletzung durch Spott
- 3. 2. Reaktive und objektive Haltung gegenüber der Verletzung
- 4. Bergson: Lachen als eine „soziale Geste“ bei „Versteifung des Charakters“
- 4. 1. Die wesentlichen Thesen von Bergson zum Thema „Lachen“
- 4. 2. Auswertung der Bergsonschen Theorie des Lachens
- 4. 3. Die Grenzen der Theorie des Lachens von Bergson
- 4. 3. 1. Die Kritik von Plessner und Heinrich an Bergson
- 4. 3. 2. André Glucksmann: Gibt es Gelächter, so gibt es auch Dummheit
- 4. 3. 2. 1. Ist Minderwertigkeit komisch?
- 4. 3. 2. 2. Zur Relevanz von Gluckmanns Kritik an Bergson
- 5. Lachen in vorbereiteten Situationen
- 5. 1. Die Beliebigkeit des Spottziels
- 5. 2. Identifikation des/der Lachenden mit dem/der Ausgelachten
- 5. 3. Katharsis im Theater
- 5. 4. Benjamin: Ausbruch von Massenpsychosen in kollektives Gelächter beim Filmpublikum
- 6. Lachen als Therapeutikum
- 6. 1. Die Wahrheit in der Binsenweisheit „Lachen ist gesund“
- 6. 2. Lachen als Körperertüchtigung
- 6. 3. Lachen in der empirischen Forschung der Psychologie
- 7. Humor als die Fähigkeit zur eingeschränkten Steuerung des Lachens
- 8. Lachen in der Gemeinschaft
- 8. 1. „Lach-Tabus“
- 8. 2. Lachen über grauenvolle Dinge
- 8. 3. Lachen und Heiterkeit
- 8. 4. Galgenhumor: Das letzte Auftrumpfen des Todgeweihten
- 8. 5. Das subversive Lachen oder das Ventil, das zu früh geöffnet wird
- 8. 6. Gibt es einen gesellschaftlichen Trend zur Ausbreitung des Lachens?
- 8. 7. Ausblick: Glück durch Lachen als Gesellschaftsutopie?
- 9. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit befasst sich mit der anthropologischen Bedeutung des Lachens. Das Ziel der Arbeit ist es, eine neue Funktionsbestimmung des Lachens zu entwickeln, die die Schwächen bisheriger Theorien überwindet und gleichzeitig die Frage nach dem Wesen des Menschen in den Vordergrund stellt.
- Analyse und Kritik der Theorien von Plessner und Bergson zum Thema Lachen
- Untersuchung der Beziehung zwischen Lachen und Kränkung
- Erforschung der Rolle des Lachens in vorbereiteten Situationen, wie z.B. Theater und Film
- Bedeutung des Lachens als Therapeutikum und in der Gemeinschaft
- Humor als Möglichkeit der kontrollierten Lachäußerung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Motiv der Arbeit vor und kritisiert die bisherige Forschung zum Thema Lachen als unzureichend und unvollständig. Kapitel 2 analysiert die Theorie des Lachens von Helmut Plessner, die das Lachen als Ausdruck eines Mangels darstellt. Kapitel 3 untersucht die Kränkung durch spöttisches Lachen und die unterschiedlichen Reaktionsweisen auf diese. Kapitel 4 befasst sich mit Henri Bergsons Theorie des Lachens als einer „sozialen Geste“ bei „Versteifung des Charakters“, analysiert deren Grenzen und die Kritik von Plessner und anderen Philosophen. Kapitel 5 befasst sich mit dem Lachen in vorbereiteten Situationen, wie z.B. Theater und Film, sowie mit der Beliebigkeit des Spottziels und der Identifikation mit dem Ausgelachten. Kapitel 6 betrachtet das Lachen als Therapeutikum und beleuchtet die Forschung der Psychologie zum Thema. Kapitel 7 untersucht den Zusammenhang zwischen Lachen und Humor. Kapitel 8 befasst sich mit dem Lachen in der Gemeinschaft, den „Lach-Tabus“, dem Lachen über grauenvolle Dinge, dem Galgenhumor und der Frage, ob es einen gesellschaftlichen Trend zur Ausbreitung des Lachens gibt. Die Zusammenfassung fasst die zentralen Ergebnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Lachen, Humor, Anthropologie, Plessner, Bergson, Kränkung, Spott, Theater, Film, Therapeutikum, Gemeinschaft, Lach-Tabus, Galgenhumor. Sie beleuchtet die Bedeutung des Lachens als Ausdruck des menschlichen Wesens und als Mittel der Lebensbewältigung.
- Citar trabajo
- Markus Hieber (Autor), 2002, Zur anthropologischen Bedeutung des Lachens, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/496033