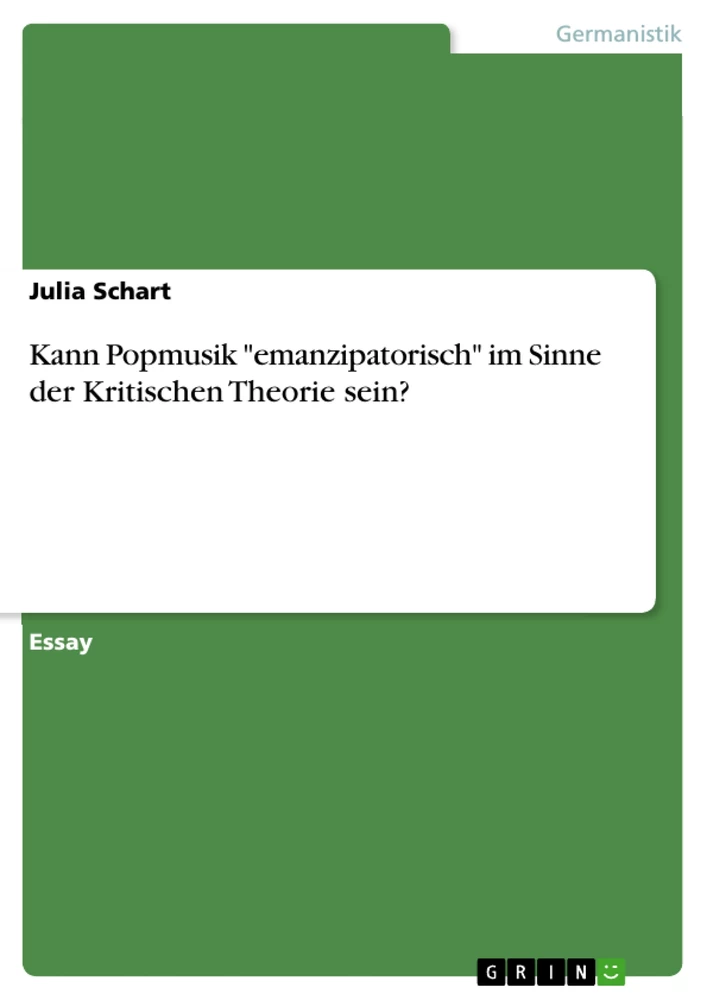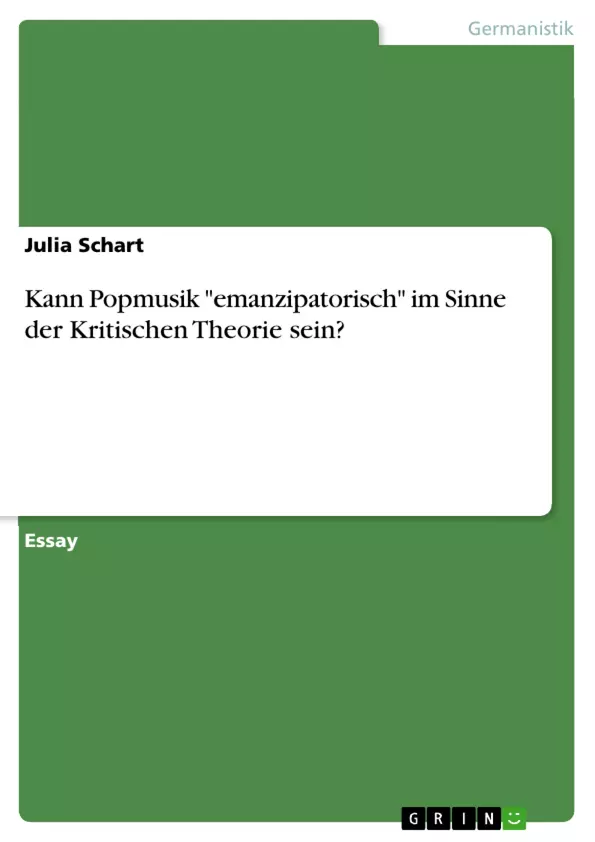Durch Elvis Presley war es plötzlich auch in Deutschland in Mode zu englischsprachiger Musik zu tanzen – kurze Röcke, ein ausgeprägter Hüftschwung und mitreißende Beats waren die Angriffspunkte jener Ära. Man wollte den Eltern, Freiheit, Ekstase und Ungebundenheit demonstrieren. Zwar kann man laut Behrens nicht von einer strikt emanzipatorischen Bewegung sprechen, sondern eher von einer inszenierten Rebellion ohne Ziel. Denn der Hauptgrund dieses vermeintlichen Protestzuges war vielmehr die Auflehnung und Abgrenzung der Heranwachsenden von den alten und, in deren Augen, angestaubten Werten der Erwachsenen, die immer noch von der harten Zeit des Krieges geprägt waren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Popmusik – Begriff und Bedeutung
- Popmusik im Kontext der Nachkriegszeit: U-Musik und E-Musik
- Die 1950er Jahre: Rock'n'Roll und inszenierte Rebellion
- Die 1960er Jahre: Wirtschaftlicher Aufschwung und Schlagermusik
- Rezeption und Interpretation von Popmusik
- Schlussfolgerung: Popmusik als Unterhaltung und Ausdruck gesellschaftlicher Strömungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage, inwieweit Popmusik im Sinne der Kritischen Theorie als emanzipatorisch verstanden werden kann. Sie analysiert die Entwicklung der Popmusik in der Nachkriegszeit Deutschlands, insbesondere in den 1950er und 1960er Jahren, und beleuchtet den Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Veränderungen und musikalischen Ausdrucksformen.
- Entwicklung des Popmusik-Begriffs und seine Bedeutung im historischen Kontext
- Der Einfluss von gesellschaftlichen und politischen Ereignissen auf die Popmusik
- Die Rolle von Popmusik als Ausdruck von Rebellion und Konformität
- Die Rezeption und Interpretation von Popmusik durch die Hörer
- Popmusik als Spiegel der individuellen Persönlichkeit und als Medium gesellschaftlicher Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Popmusik – Begriff und Bedeutung: Die Einleitung definiert den Begriff "Popmusik" und dessen Wandel im Laufe der Geschichte. Sie beleuchtet die unterschiedliche Interpretation des Begriffs, von populärer Musik im breiten Sinne bis hin zur Unterscheidung zwischen U-Musik (Unterhaltungsmusik) und E-Musik (Ernste Musik). Die Einleitung legt den Grundstein für die weitere Analyse, indem sie die Vielschichtigkeit des Phänomens Popmusik hervorhebt und die Forschungsfrage nach dem emanzipatorischen Potential von Popmusik im Kontext der Kritischen Theorie einführt. Der Bezug auf Halbscheffel und Kneif sowie Adorno untermauert die unterschiedlichen Perspektiven auf Popmusik und deren Popularität.
Popmusik im Kontext der Nachkriegszeit: U-Musik und E-Musik: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung der Popmusik in der Nachkriegszeit Deutschlands. Es differenziert zwischen der Nachfrage nach U-Musik als Reaktion auf die Kriegsjahre und dem Aufkommen von Subgenres, die gesellschaftliche Problematiken thematisieren. Bewegungen wie der Krautrock, die Hamburger Schule und die Neue Deutsche Welle werden als Beispiele für alternative musikalische Ausdrucksformen genannt, die im Gegensatz zur überwiegend unpolitischen U-Musik stehen. Das Kapitel beleuchtet den Übergang von einer harmoniebedürftigen Nachkriegsgeneration hin zu einer aufgeweckteren Jugendkultur.
Die 1950er Jahre: Rock'n'Roll und inszenierte Rebellion: Dieses Kapitel beschreibt den Einfluss des amerikanischen Rock'n'Roll auf die deutsche Jugendkultur der 1950er Jahre. Es analysiert den Rock'n'Roll als Ausdruck einer inszenierten Rebellion gegen die elterliche Generation und die Werte der Nachkriegszeit, wobei betont wird, dass diese Rebellion laut Behrens eher eine stilisierte Abgrenzung als eine politisch motivierte Bewegung war. Der Fokus liegt auf der symbolischen Bedeutung von Musik, Kleidung und Tanz als Mittel der Selbstinszenierung und der Abgrenzung von den älteren Generationen, die noch von den Kriegserfahrungen geprägt waren.
Die 1960er Jahre: Wirtschaftlicher Aufschwung und Schlagermusik: Im Gegensatz zu den 1950er Jahren, zeichnet dieses Kapitel ein Bild der 1960er Jahre als Dekade des wirtschaftlichen Aufschwungs und des Rückzugs in die massentaugliche Schlagermusik. Der Fokus liegt auf der Analyse von Schlagertexten, die Themen wie Heimat, Fernweh, Arbeitsmigration und die Konsumgesellschaft widerspiegeln. Es wird diskutiert, wie die Musikindustrie die positive Seite der wirtschaftlichen Entwicklung betonte und die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit vermeidet. Der Vergleich mit der kritischen Auseinandersetzung der Literatur (Böll, Andersch, Grass) unterstreicht die kontrastierende Rolle der Musik in diesem Kontext.
Rezeption und Interpretation von Popmusik: Dieses Kapitel untersucht die subjektive Rezeption von Popmusik und betont, dass die Interpretation eines Liedes von der individuellen Lebenslage des Hörers abhängt. Musik wird als Spiegel der individuellen Persönlichkeit dargestellt, die sowohl egozentrisch-emanzipatorische als auch gesellschaftliche Botschaften vermitteln kann. Das Beispiel von Drafi Deutschers "Marmor, Stein und Eisen bricht" und dessen Umdeutung in der Studentenbewegung von 1968 illustriert die vielfältigen Interpretationen und den Wandel der Bedeutung von Liedern im Laufe der Zeit.
Schlüsselwörter
Popmusik, Kritische Theorie, Emanzipation, Nachkriegszeit, Rock'n'Roll, Schlagermusik, gesellschaftliche Veränderungen, Jugendkultur, Rebellion, Konsumgesellschaft, Rezeption, Interpretation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Popmusik in der Nachkriegszeit
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Popmusik in der Nachkriegszeit Deutschlands, insbesondere in den 1950er und 1960er Jahren. Sie analysiert den Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Veränderungen und musikalischen Ausdrucksformen und befragt das emanzipatorische Potential von Popmusik im Lichte der Kritischen Theorie.
Welche Zeiträume werden untersucht?
Der Fokus liegt auf der Nachkriegszeit, speziell den 1950er und 1960er Jahren in Deutschland. Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung der Popmusik in diesen Dekaden und deren Spiegelung gesellschaftlicher Entwicklungen.
Welche musikalischen Genres werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Genres, darunter Rock'n'Roll, Schlagermusik, Krautrock, die Hamburger Schule und die Neue Deutsche Welle. Der Vergleich dieser Genres dient der Analyse unterschiedlicher Ausdrucksformen und ihrer gesellschaftlichen Bedeutung.
Wie wird der Begriff "Popmusik" definiert?
Die Arbeit beleuchtet den Wandel des Begriffs "Popmusik" im Laufe der Geschichte und differenziert zwischen populärer Musik im breiten Sinne und der Unterscheidung zwischen U-Musik (Unterhaltungsmusik) und E-Musik (Ernste Musik). Die Vielschichtigkeit des Begriffs wird explizit thematisiert.
Welche gesellschaftlichen Aspekte werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert den Einfluss gesellschaftlicher und politischer Ereignisse auf die Popmusik. Themen wie der wirtschaftliche Aufschwung der 1960er Jahre, die Konsumgesellschaft, die Rolle von Rebellion und Konformität sowie die Erfahrungen der Nachkriegsgeneration werden behandelt.
Welche Rolle spielt die Kritische Theorie?
Die Kritische Theorie dient als theoretischer Rahmen, um das emanzipatorische Potential von Popmusik zu untersuchen. Die Arbeit fragt nach der Möglichkeit, Popmusik als Mittel der gesellschaftlichen Emanzipation zu verstehen.
Wie wird die Rezeption von Popmusik behandelt?
Die subjektive Rezeption von Popmusik und die Abhängigkeit der Interpretation von der individuellen Lebenslage des Hörers werden betont. Musik wird als Spiegel der individuellen Persönlichkeit und als Medium gesellschaftlicher Kommunikation dargestellt.
Welche konkreten Beispiele werden genannt?
Die Arbeit nennt Beispiele wie den Einfluss des amerikanischen Rock'n'Roll auf die deutsche Jugendkultur, die Analyse von Schlagertexten der 1960er Jahre und die Umdeutung von Drafi Deutschers "Marmor, Stein und Eisen bricht" in der Studentenbewegung von 1968.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Popmusik, Kritische Theorie, Emanzipation, Nachkriegszeit, Rock'n'Roll, Schlagermusik, gesellschaftliche Veränderungen, Jugendkultur, Rebellion, Konsumgesellschaft, Rezeption und Interpretation.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu Popmusik in der Nachkriegszeit, den 1950er und 1960er Jahren, ein Kapitel zur Rezeption und Interpretation von Popmusik und eine Schlussfolgerung. Jedes Kapitel fasst seine Kernaussagen zusammen.
- Quote paper
- B.A./B.Sc. Julia Schart (Author), 2012, Kann Popmusik "emanzipatorisch" im Sinne der Kritischen Theorie sein?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/496068