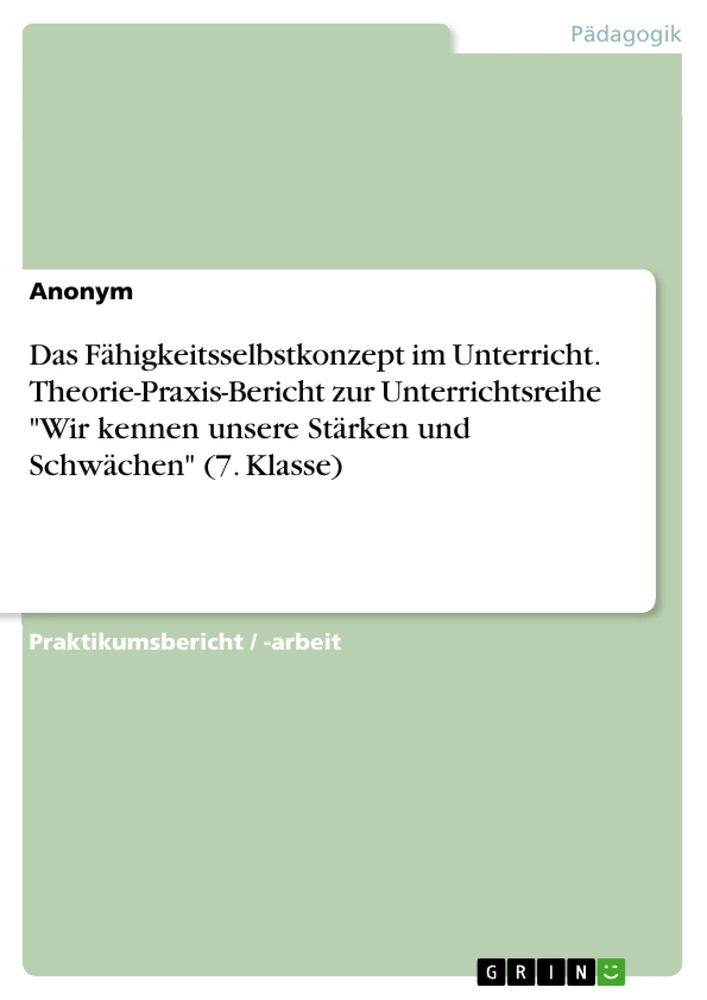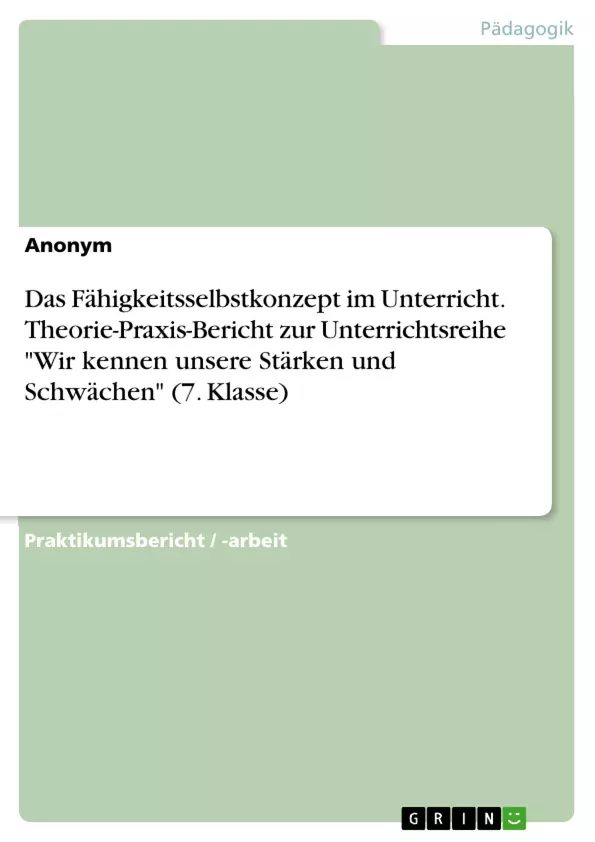In diesem Theorie-Praxis-Bericht sollen die schulischen Voraussetzungen sowie die Unterrichtsplanung in der siebten Klasse einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen sowie sozial-emotionale Beeinträchtigung dargelegt werden. Das geplante Unterrichtsvorhaben trägt den Titel "Wir kennen unsere Stärken und Schwächen". Die Reihe bezieht sich auf den Förderbereich Lern- und Arbeitsverhalten, wobei der Förderzielschwerpunkt "Fähigkeitsselbstkonzept" fokussiert werden soll.
Das Förderziel lautet: "Die SchülerInnen sind in der Lage, mittels selbstgewählter Lernwege und Kontrollmechanismen an ihren selbstformulierten Stärken und Schwächen zu arbeiten, um ihr eigenes Lernziel zu erreichen." Diese Reihe ist an kein Unterrichtsfach gebunden, weshalb ihr keine fachspezifischen Ziele zugrunde liegen. Nach der vierten Unterrichtseinheit beginnen die SchülerInnen, neben ihren Sozialzielen auch an ihren Fachzielen zu arbeiten, sodass die Unterrichtsreihe einen Bezug zu den aktuellen Inhalten der jeweiligen Fächer erhält.
Die Empfehlungen und Lehrpläne verschiedener Bundesländer bestätigen die Bedeutsamkeit der Bereiche Selbsteinschätzung der Lernleistung, der Selbstwirksamkeit sowie Fähigkeitsselbstkonzept. Die Unterrichtseinheit setzt hier mit der Förderung an. Die SchülerInnen sollen sich zunächst mit ihren Stärken und Schwächen auseinandersetzen, sodass sie sich darin üben können, eine realistische Selbsteinschätzung vorzunehmen. Durch die Formulierung eigener Lernziele und das Auswählen eines Lernwegs bestimmen sie den Gegenstand und den Weg ihres Lernens selbst und erfahren Selbstwirksamkeit, wenn sie am Ende der Unterrichtsreihe ihre Erfolge einschätzen und kontrollieren sollen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Planung und Durchführung des Unterrichtsvorhabens
- Fachliche und förderschwerpunktspezifische Ziele des Unterrichtsvorhabens
- Aufbau des Unterrichtsvorhabens in tabellarischer Form
- Themenwahl und Begründung
- Bezug zum Kernlehrplan
- Beschreibung der Planung
- Lernvoraussetzungen
- Sachanalyse
- Didaktisch-methodischer Kommentar
- geplanter Stundenverlauf
- Tatsächlicher Stundenverlauf
- Reflexion der Unterrichtseinheit
- Reflexion der Unterrichtsreihe
- Reflexion der Erfahrungen im Praxissemester in Bezug auf den fachlichen Anteil
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Theorie-Praxis-Bericht zum Praxissemester im Förderschwerpunkt Lernen analysiert die Planung und Durchführung einer Unterrichtsreihe mit dem Titel "Wir kennen unsere Stärken und Schwächen". Das Ziel dieser Reihe ist es, das Fähigkeitsselbstkonzept der Schüler*innen im Bereich Lern- und Arbeitsverhalten zu fördern, indem sie lernen, ihre Stärken und Schwächen zu erkennen und eigene Lernziele zu formulieren. Die Schüler*innen sollen anschließend selbstständig an der Entwicklung ihrer Stärken arbeiten und gleichzeitig an ihren Schwächen.
- Fähigkeitsselbstkonzept und Lernmotivation
- Individuelle Lernwege und -strategien
- Stärken- und Schwächenanalyse
- Selbstgesteuertes Lernen
- Differenzierung im Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Schule, die Klasse und die Schüler*innen, in der das Praxissemester absolviert wurde. Es beschreibt den Kontext des Unterrichtsvorhabens und beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus der Heterogenität der Schüler*innen und der räumlichen und personellen Ausstattung der Schule ergeben.
- Planung und Durchführung des Unterrichtsvorhabens: In diesem Kapitel werden die fachlichen und förderschwerpunktspezifischen Ziele der Unterrichtsreihe erläutert, der Aufbau des Unterrichtsvorhabens dargestellt und die Themenwahl begründet.
- Beschreibung der Planung: Dieser Abschnitt behandelt die Lernvoraussetzungen, die Sachanalyse, den didaktisch-methodischen Kommentar sowie den geplanten und den tatsächlichen Stundenverlauf.
- Reflexion der Unterrichtseinheit: Das Kapitel analysiert die Durchführung der Unterrichtseinheit, betrachtet das Schüler*innen- und Lehrer*innenverhalten und reflektiert die Effektivität der gewählten Methoden und Materialien.
- Reflexion der Unterrichtsreihe: Hier werden die Erfahrungen mit der gesamten Unterrichtsreihe reflektiert, einschließlich der Erfolge und Herausforderungen, die sich aus der Umsetzung der Lernziele und der Methodenwahl ergeben haben.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes sind: Förderschwerpunkt Lernen, Fähigkeitsselbstkonzept, Lernmotivation, individuelle Lernwege, Stärken- und Schwächenanalyse, selbstgesteuertes Lernen, Differenzierung im Unterricht, Unterrichtsreihe, Theorie-Praxis-Bericht, Praxissemester.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Unterrichtsreihe "Stärken und Schwächen"?
Ziel ist die Förderung des Fähigkeitsselbstkonzepts. Schüler sollen lernen, ihre eigenen Leistungen realistisch einzuschätzen und selbstgesteuert an ihren Zielen zu arbeiten.
Für welche Zielgruppe wurde die Reihe konzipiert?
Die Reihe wurde für eine 7. Klasse an einer Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen sowie sozial-emotionale Entwicklung entworfen.
Was bedeutet "Fähigkeitsselbstkonzept" im Unterricht?
Es beschreibt die kognitive Repräsentation der eigenen Fähigkeiten. Ein positives Selbstkonzept steigert die Lernmotivation und die Erfolgserwartung.
Wie funktioniert selbstgesteuertes Lernen in dieser Reihe?
Schüler wählen eigene Lernwege und Kontrollmechanismen, um ihre selbstformulierten Ziele zu erreichen, was ihre Selbstwirksamkeit stärkt.
Ist die Unterrichtsreihe an ein bestimmtes Fach gebunden?
Nein, sie ist fachunabhängig konzipiert, integriert aber nach der vierten Einheit individuelle Fachziele der Schüler.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2019, Das Fähigkeitsselbstkonzept im Unterricht. Theorie-Praxis-Bericht zur Unterrichtsreihe "Wir kennen unsere Stärken und Schwächen" (7. Klasse), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/496155