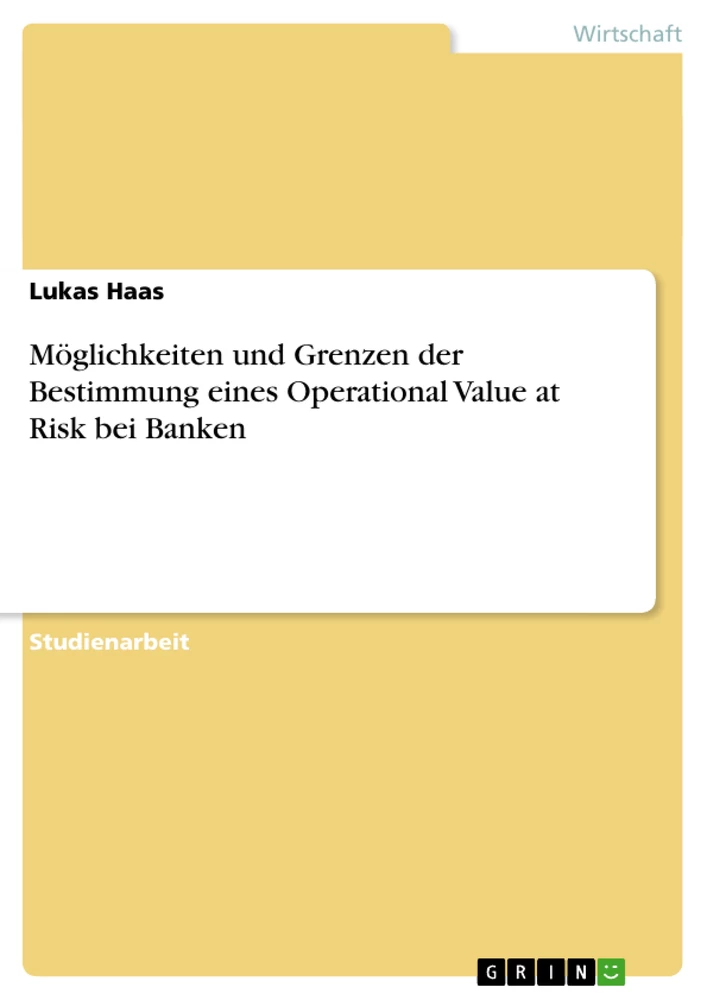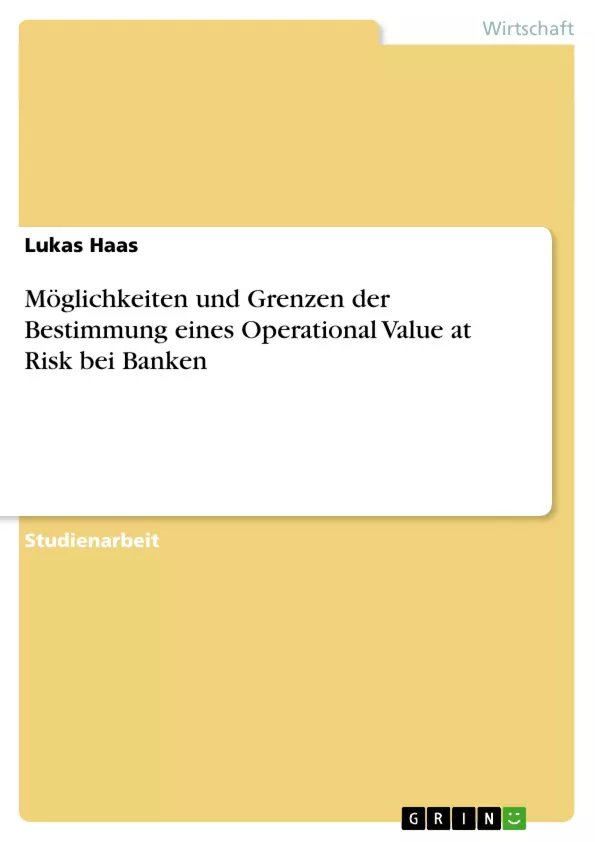Einleitung
„Der FTSE-Index der Londoner Börse ist am Montagabend wenige Minuten
vor Handelsschluss um über 200 Punkte eingebrochen, weil ein einzelner Broker eines grossen Investmenthauses einen Fehler gemacht hatte. Wie berichtet, verkaufte er versehentliche Aktien im Wert von bis zu einer halben Milliarde Pfund (1,5 Mrd. DM). Da die Börse kurz danach schloss, konnte er den Fehler nicht mehr rückgängig machen.
Am Dienstagmorgen begann der FTSE-Index 127,6 Punkte höher bei
5818 Punkten, so dass der Broker seinen Kunden grossen Schaden zugefügt
haben dürfte. Nach Angaben der Börse wird der Aktienverkauf nicht
rückgängig gemacht.“(1)
Solche und viele andere Beispiele wie der Zusammenbruch der britischen
Traditionsbank Barings, dessen Händler Nick Leeson Verluste in Höhe
von weit über einer Mrd. USD durch unautorisierte Geschäfte verursacht
hat, zeigen was für Auswirkungen schlagend werdende operationelle
Risiken haben können. Trotz teilweise existenzbedrohenden Gefahren für
das Unternehmen war das Operationelle Risiko lange Zeit ein Risikofaktor welcher wenig Beachtung fand.
Derartige Schadensfälle, die insbesondere auf operationelle Schwächen
der Banken zurückzuführen waren, rückten die Bedeutung dieser Risiken
wieder vermehrt ins Bewusstsein des Managements und der zuständigen
Aufsichtsbehörden. Ende der 90er Jahre begann man sich verstärkt mit
dem Management operationeller Risiken zu beschäftigen. Das Management
und die Überwachung operationeller Risiken hat daher in den letzten
Jahren für Banken eine zunehmend grössere Bedeutung erhalten. So
hat sich in den meisten Unternehmen die Idee durchgesetzt, eine Abteilung für operationelle Risiken zu schaffen und ihr eigene Managementstrukturen zu geben. Gestiegen ist der Stellenwert der operationellen Risiken auch aufgrund betriebswirtschaftlichem Druck, so werden heute bei der Bonitätsvergabe durch die grossen Raitingagenturen auch operationelle Risiken der Bank berücksichtigt, was sich wiederum direkt auf die Höhe der Refinanzierungskosten überträgt.
[...]
______
(1) Handelsblatt Dienstag 15.Mai 2001
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- A. GRUNDLAGEN OPERATIONELLER RISIKOMESSUNG
- I. Definition und systematische Abgrenzung
- II. Konzept des Value at Risk
- III. Messung operationeller Risiken
- B. BEWERTUNG OPERATIONELLER RISIKEN
- I. Bottom Up und Top Down, zwei alternative Ansätze
- II. Bottom Up Ansätze zur Bestimmung eines OpVaR
- III. Top Down Ansätze zur Bestimmung eines OpVaR
- C. KRITISCHE WÜRDIGUNG
- I. Stärken und Schwächen des Bottom Up Ansatzes
- II. Stärken und Schwächen des Top Down Ansatzes
- III. Grenzen der Bestimmung eines OpVaR
- FAZIT
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Seminararbeit befasst sich mit der Thematik operationeller Risiken in Banken und untersucht die Möglichkeiten und Grenzen der Bestimmung eines Operational Value at Risk (OpVaR). Die Arbeit fokussiert auf die Bewertung von operationellen Risiken im Kontext von Markt- und Kreditrisiken und analysiert zwei verschiedene Ansätze, den Bottom Up und den Top Down Ansatz, zur Bestimmung eines OpVaR. Die Analyse beinhaltet eine kritische Würdigung beider Ansätze, um ihre Stärken und Schwächen aufzuzeigen und die Grenzen des OpVaR Konzepts zu beleuchten.
- Definition und Abgrenzung von operationellen Risiken
- Das Konzept des Value at Risk und dessen Anwendung auf operationelle Risiken
- Analyse von Bottom Up und Top Down Ansätzen zur OpVaR Berechnung
- Kritik und Bewertung der Stärken und Schwächen beider Ansätze
- Aufleuchten der Grenzen bei der Bestimmung eines OpVaR
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema operationeller Risiken in Banken einführt und anhand von Beispielen die Relevanz des Themas verdeutlicht. Kapitel A befasst sich mit den Grundlagen der operationellen Risikomessung. Hierbei werden die Definition und systematische Abgrenzung operationeller Risiken erläutert, das Konzept des Value at Risk vorgestellt und verschiedene Methoden zur Messung operationeller Risiken analysiert.
Kapitel B geht auf die Bewertung operationeller Risiken ein und analysiert die beiden gängigen Ansätze, den Bottom Up und den Top Down Ansatz, zur Bestimmung eines OpVaR. Kapitel C widmet sich einer kritischen Würdigung beider Ansätze und beleuchtet deren Stärken und Schwächen. Schliesslich wird die Arbeit mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse und einem Ausblick auf die Grenzen des OpVaR Konzepts abgeschlossen.
Schlüsselwörter
Operationelle Risiken, Bankmanagement, Value at Risk (VaR), Operational Value at Risk (OpVaR), Bottom Up Ansatz, Top Down Ansatz, Risikomessung, Risikomanagement, Basel II, Bankenaufsicht.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Operationelle Risiko in Banken?
Es umfasst Risiken durch menschliches Versagen (z.B. Brokerfehler), Systemausfälle oder unautorisierte Geschäfte, wie beim Fall Barings.
Was bedeutet Operational Value at Risk (OpVaR)?
OpVaR ist eine Kennzahl, die den potenziellen maximalen Verlust aus operationellen Risiken innerhalb eines Zeitraums bei einer bestimmten Wahrscheinlichkeit angibt.
Was ist der Unterschied zwischen Bottom-Up und Top-Down Ansätzen?
Bottom-Up analysiert einzelne Geschäftsprozesse auf Risiken, während Top-Down von aggregierten Daten des gesamten Unternehmens ausgeht.
Welche Rolle spielt Basel II für operationelle Risiken?
Basel II verpflichtete Banken erstmals, operationelle Risiken explizit mit Eigenkapital zu unterlegen und entsprechende Messmodelle einzuführen.
Wo liegen die Grenzen des OpVaR?
Die Bestimmung ist schwierig, da historische Daten zu seltenen Großschäden oft fehlen und die Modellierung menschlichen Verhaltens komplex ist.
- Quote paper
- Lukas Haas (Author), 2003, Möglichkeiten und Grenzen der Bestimmung eines Operational Value at Risk bei Banken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49618