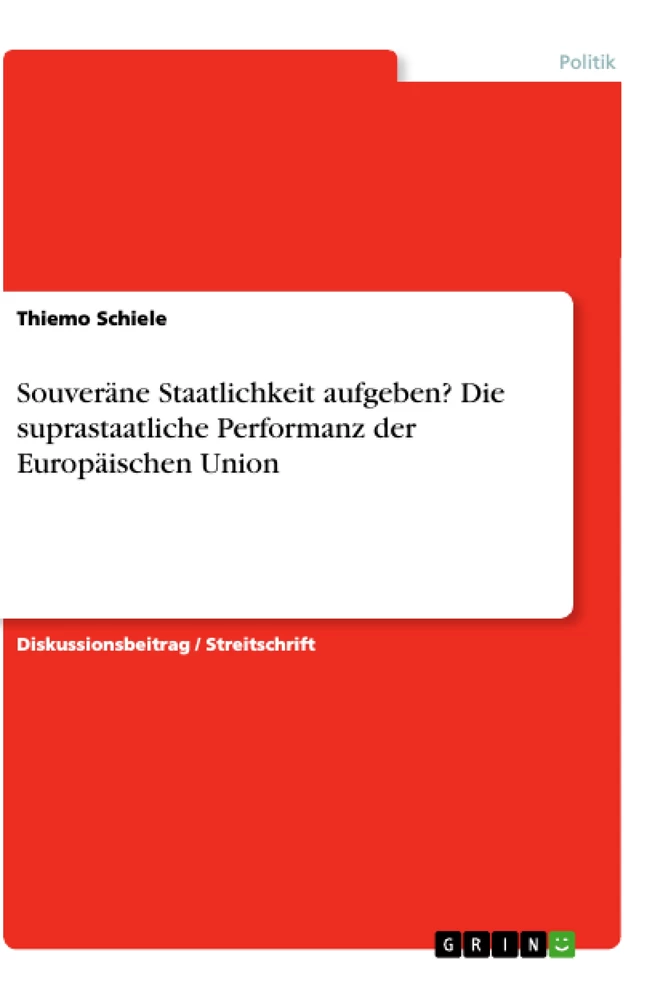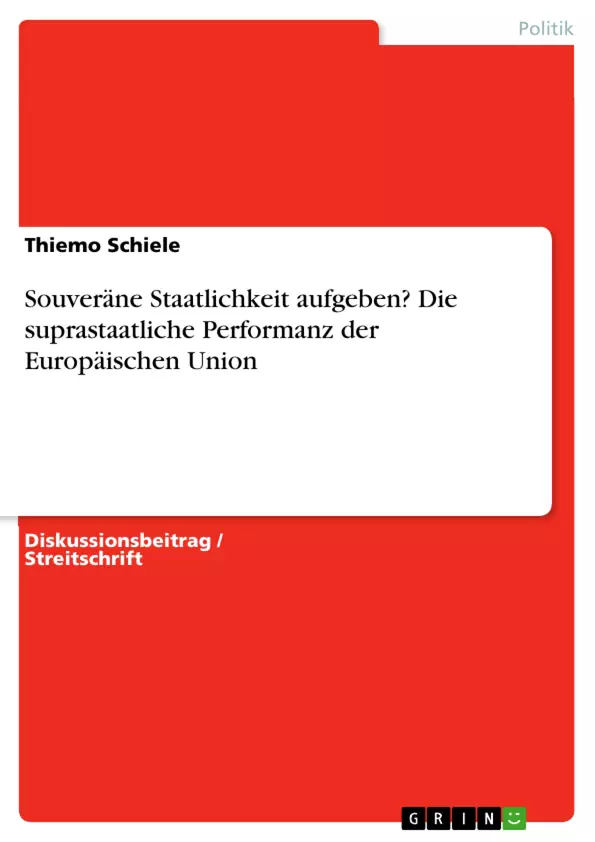Diese Arbeit konzentriert sich auf die gegenwärtigen Integrationsoptionen und -tendenzen der Europäischen Union.
Etwa neun Jahre nach dem Lissabon-Prozess ermisst sich die suprastaatliche Leistungsfähigkeit der EU offenkundig zunächst an ihrer Fähigkeit, nationale und supranationale Herausforderungen auf den internationalen und transnationalen Bühnen suprastaatlich oder zumindest intergouvernemental lösen zu können.
So ist es etwa in der Langfristperspektive als wesentlich anzusehen, dass EU-Institutionen von der Rechtmäßigkeit der "europäischen Governance" zu überzeugen imstande sind, um sich das Vertrauen und die Folgebereitschaft von Bürgern sowie der nationalen Regierungsvertreter ebenso im politischen Prozess zu sichern.
Unter diesen Umständen bleibt weiterhin fraglich, ob die europäische Integration sinn- und zweckgemäß fortgeführt werden kann oder früher oder später aufgegeben werden muss. Letzteres kann demnach nur vermieden werden, wenn sich die EU zukünftig vermehrt auf intergouvernementale Projekte konzentriert und ihre Mitgliedsländer dahingehend unterstützt, dass ein Großteil europäischer Völker hiervon profitieren kann.
Inhaltsverzeichnis
- Eurokratische Realitätsfiktion seit Lissabon
- Gegenwartsbezogene Politik im Schatten wachsender Herausforderungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text analysiert die Performanz der Europäischen Union fast neun Jahre nach Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon. Er untersucht das Problem mangelnder politischer Akzeptanz und die Herausforderungen, die sich daraus für die europäische Integration ergeben.
- Mangelnde Effizienz, Transparenz und Legitimität der EU
- Die Auswirkungen des Vertrags von Lissabon auf die EU-Governance
- Die Rolle nationaler Souveränität in der europäischen Integration
- Herausforderungen wie Brexit, Migrationskrise und zunehmende soziale Konflikte
- Die Notwendigkeit, die Interessen aller Mitgliedsstaaten zu berücksichtigen
Zusammenfassung der Kapitel
Eurokratische Realitätsfiktion seit Lissabon: Der Text analysiert die Auswirkungen des Vertrags von Lissabon auf die Europäische Union. Obwohl der Vertrag den übernationalen Rechtsetzungsorganen mehr Einfluss gab und die Rolle der Europäischen Kommission aufwertete, führen die institutionellen Anpassungen kaum zu signifikanten Verbesserungen in Bezug auf Effizienz, Transparenz und Legitimität. Die EU bleibt ein weitestgehend fremdlegitimiertes Gebilde, dessen demokratisches Defizit sich verschärft hat. Das Missverhältnis zwischen Konstitution und politisch-administrativem Handeln erzeugt neue Herausforderungen, die national und intergouvernemental oft besser gelöst zu werden scheinen. Die Frage, ob die europäische Integration langfristig sinnvoll fortgesetzt werden kann, wird diskutiert, und die Notwendigkeit, Anreize zur Kooperation zu schaffen und die Akzeptanz der EU zu steigern, wird betont. Die Gefahr eines Übergangs zur "Postdemokratie" wird angesprochen, mit den damit verbundenen Risiken wie Politikverdrossenheit und mangelnder Bürgerbeteiligung.
Gegenwartsbezogene Politik im Schatten wachsender Herausforderungen: Dieses Kapitel beleuchtet die aktuellen Herausforderungen der EU, wie Demokratie- und Legitimitätsprobleme, Finanzkrisen, Handelskriege, illegale Migration und Terrorismus. Die inkrementalistische EU-Governance der letzten eineinhalb Dekaden hat nur begrenzt dazu beigetragen, diese Probleme zu lösen. Austrittsbestrebungen wie der Brexit und Initiativen zur nationalen Unabhängigkeit werden als Wirkung sozialer und wirtschaftlicher Divergenzen betrachtet. Die Bemühungen einiger EU-Staaten, sich in Bezug auf Fragen wie illegale Migration auf nationale Souveränität zurückzuziehen, zeigen die Herausforderungen der suprastaatlichen Zusammenarbeit. Es wird deutlich, dass die internationalen Beziehungen der EU-Mitgliedsländer weniger vertieft wurden als erwartet.
Schlüsselwörter
Europäische Union (EU), Legitimität, Souveränität, (Über)Staatlichkeit, Prosperität, Governance, Integration, Desintegration, Demokratiedefizit, Brexit.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Eurokratische Realitätsfiktion und Gegenwartsbezogene Politik der EU
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text analysiert die Performance der Europäischen Union fast neun Jahre nach Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon. Im Fokus stehen die mangelnde politische Akzeptanz und die daraus resultierenden Herausforderungen für die europäische Integration.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt zentrale Themen wie mangelnde Effizienz, Transparenz und Legitimität der EU, die Auswirkungen des Vertrags von Lissabon auf die EU-Governance, die Rolle nationaler Souveränität, Herausforderungen wie Brexit, Migrationskrise und soziale Konflikte, sowie die Notwendigkeit, die Interessen aller Mitgliedsstaaten zu berücksichtigen.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text besteht aus zwei Hauptkapiteln: "Eurokratische Realitätsfiktion seit Lissabon" und "Gegenwartsbezogene Politik im Schatten wachsender Herausforderungen".
Was ist die Kernaussage des Kapitels "Eurokratische Realitätsfiktion seit Lissabon"?
Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen des Vertrags von Lissabon. Trotz erhöhten Einflusses übernationaler Organe und der Aufwertung der Kommission, blieben Verbesserungen in Effizienz, Transparenz und Legitimität aus. Die EU bleibt ein fremdlegitimiertes Gebilde mit einem verschärften Demokratiedefizit. Das Missverhältnis zwischen Konstitution und Handeln führt zu neuen Herausforderungen, die national und intergouvernemental oft besser gelöst scheinen. Die langfristige Sinnhaftigkeit der europäischen Integration wird hinterfragt, und die Notwendigkeit, Kooperation und Akzeptanz zu steigern, wird betont. Die Gefahr eines Übergangs zur "Postdemokratie" wird angesprochen.
Was ist die Kernaussage des Kapitels "Gegenwartsbezogene Politik im Schatten wachsender Herausforderungen"?
Dieses Kapitel beleuchtet aktuelle Herausforderungen wie Demokratie- und Legitimitätsprobleme, Finanzkrisen, Handelskriege, illegale Migration und Terrorismus. Die inkrementalistische EU-Governance der letzten eineinhalb Dekaden hat diese Probleme nur begrenzt gelöst. Brexit und Initiativen zur nationalen Unabhängigkeit werden als Wirkung sozialer und wirtschaftlicher Divergenzen betrachtet. Der Rückzug einiger Staaten auf nationale Souveränität in Fragen wie illegale Migration verdeutlicht die Herausforderungen suprastaatlicher Zusammenarbeit. Die internationalen Beziehungen der EU-Mitgliedsländer wurden weniger vertieft als erwartet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind Europäische Union (EU), Legitimität, Souveränität, (Über)Staatlichkeit, Prosperität, Governance, Integration, Desintegration, Demokratiedefizit und Brexit.
Für wen ist dieser Text relevant?
Dieser Text ist relevant für Wissenschaftler, Studenten und alle Interessierten, die sich mit der Europäischen Union, ihren Institutionen und den Herausforderungen der europäischen Integration auseinandersetzen.
Welche Schlussfolgerungen zieht der Text?
Der Text deutet auf ein Demokratiedefizit und eine mangelnde Legitimität der EU hin. Er betont die Notwendigkeit, die Akzeptanz der EU zu steigern und die Interessen aller Mitgliedsstaaten zu berücksichtigen, um die europäische Integration langfristig zu sichern. Die inkrementalistische Politik der EU wird als unzureichend zur Bewältigung aktueller Herausforderungen dargestellt.
- Citation du texte
- Thiemo Schiele (Auteur), 2018, Souveräne Staatlichkeit aufgeben? Die suprastaatliche Performanz der Europäischen Union, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/496286