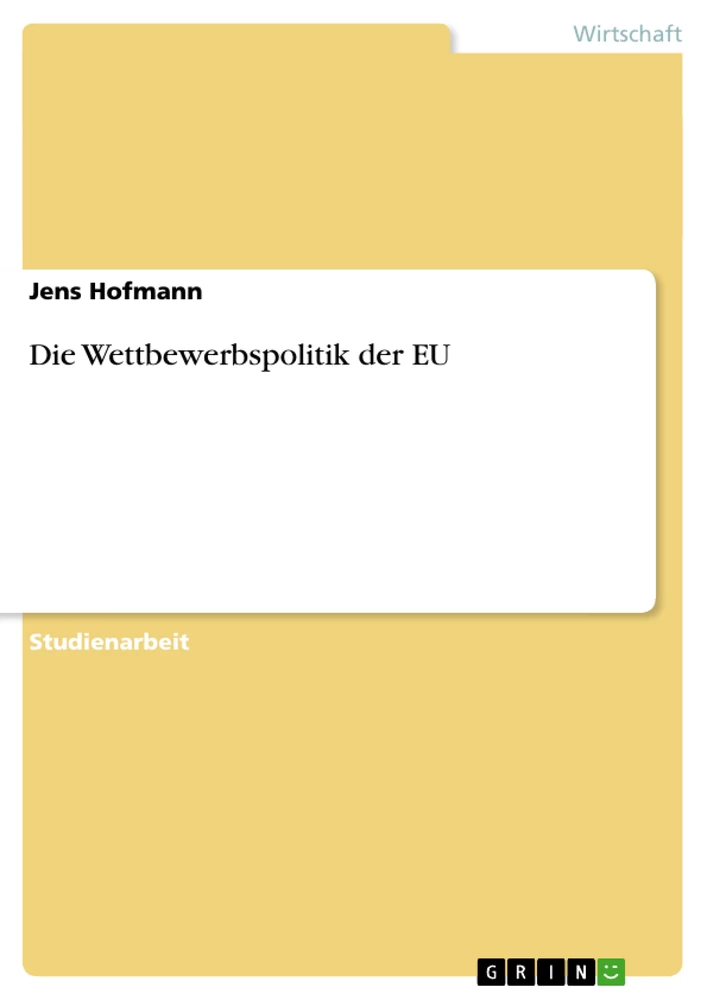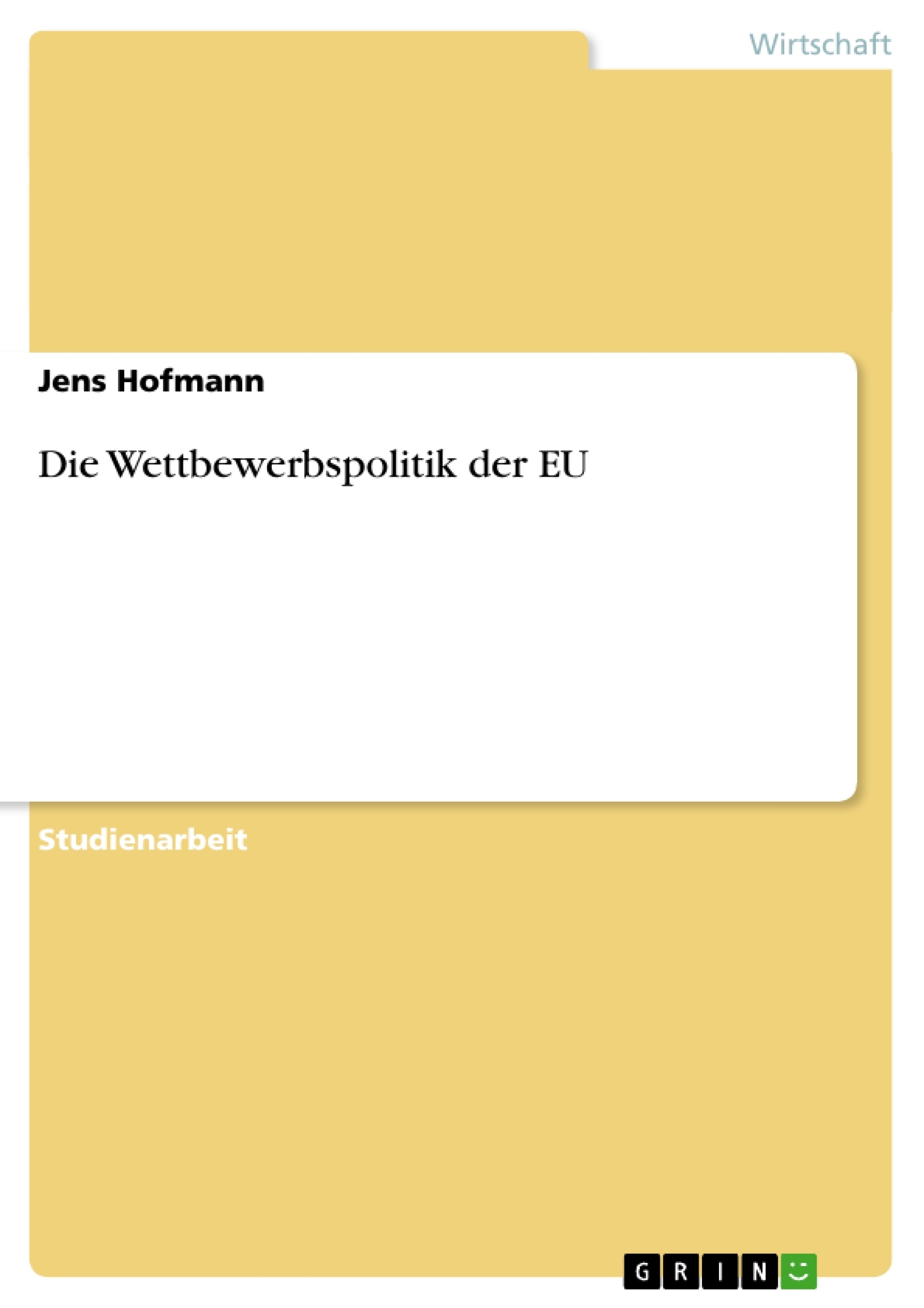Durch den Zusammenschluss zur Europäischen Union (EU) sieht sich die Wettbewerbspolitik dieser Gemeinschaft einer neuen Herausforderung gegenüber gestellt. Sie muss eine Vielzahl von Märkten aus den unterschiedlichen Ländern derart vereinen, dass die Verwirklichung des Binnenmarktes gewährleistet ist. Dadurch soll den Unternehmen aller Mitgliedsstaaten ein Wettbewerb zu gleichen Bedingungen auf allen Märkten ermöglicht werden. Dies soll durch die Förderung der wirtschaftlichen Effizienz und die Schaffung eines günstigen Klimas für Innovationen und technischen Fortschritt geschehen. Des Weiteren müssen die Interessen der Verbraucher geschützt und ihnen die Möglichkeit gegeben werden, Waren und Dienstleistungen zu den günstigsten Bedingungen erwerben zu können. Ferner soll sichergestellt werden, dass Unternehmen wie auch nationale Behörden nicht durch wettbewerbswidrige Praktiken die Dynamik des Wettbewerbs beeinträchtigen oder gar behindern.
Im Folgenden soll die Wettbewerbspolitik der EU mit ihrer Entwicklung, ihren Schwerpunkten und ihren Zielen vorgestellt und auch näher auf wichtige Regelungen eingegangen werden. Im zweiten Teil der Arbeit wird dann eine konkrete Problemstellung, der Wettbewerb auf dem europäischen Strommarkt, behandelt. Abschließend wird noch kurz die Entwicklung der EU-Wettbewerbspolitik durch den Beitritt der zehn neuen Mitgliedsstaaten am 1. Mai 2004 umrissen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Die Wettbewerbspolitik der Europäischen Union
- Entstehungsgeschichte
- Schwerpunkte und Ziele
- Materiell-rechtliche Bestimmungen
- Absprachen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen
- Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung
- Unternehmenszusammenschlüsse
- Staatliche Beihilfen
- Liberalisierung bestimmter Teilmärkte
- Wettbewerb am Strommarkt
- Analyse des Strommarktes
- Anforderungen an die Wettbewerbspolitik
- Ausblick
- Entwicklung der Wettbewerbspolitik in den Beitrittsländern
- Herausforderungen und Risiken der Entwicklung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Wettbewerbspolitik der Europäischen Union, ihre historische Entwicklung, ihre zentralen Ziele und Schwerpunkte sowie ihre Anwendung auf einem konkreten Marktbeispiel – dem europäischen Strommarkt. Die Arbeit analysiert die materiell-rechtlichen Bestimmungen und beleuchtet die Herausforderungen im Kontext der EU-Osterweiterung.
- Entwicklung der EU-Wettbewerbspolitik
- Ziele und Schwerpunkte der EU-Wettbewerbspolitik
- Materiell-rechtliche Bestimmungen der EU-Wettbewerbspolitik
- Analyse des Wettbewerbs am Strommarkt
- Herausforderungen durch die EU-Osterweiterung
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Die Einführung beschreibt die zentrale Herausforderung der EU-Wettbewerbspolitik: die Vereinheitlichung der Märkte der verschiedenen Mitgliedsstaaten, um einen funktionierenden Binnenmarkt zu gewährleisten. Es werden die Ziele benannt: Schaffung eines wettbewerblichen Umfelds für Unternehmen, Schutz der Verbraucherinteressen und Verhinderung wettbewerbswidriger Praktiken. Die Arbeit gliedert sich in die Analyse der EU-Wettbewerbspolitik und eine Fallstudie zum Strommarkt, gefolgt von einem Ausblick auf die Auswirkungen der EU-Osterweiterung.
Die Wettbewerbspolitik der Europäischen Union: Entstehungsgeschichte: Dieses Kapitel verfolgt die historische Entwicklung der EU-Wettbewerbspolitik von den Anfängen im EGKS-Vertrag bis zur Modernisierung im Jahr 1999. Es zeigt den schrittweisen Ausbau der Regelungen, von anfänglich weniger strikten Regeln hin zu einem umfassenderen System mit Notifizierungspflichten und präventiver Fusionskontrolle. Das Kapitel beleuchtet die Bedeutung des Cassis de Dijon-Urteils für die Stärkung des Binnenmarktes und die zunehmende Integration der nationalen Behörden in die Wettbewerbspolitik.
Die Wettbewerbspolitik der Europäischen Union: Schwerpunkte und Ziele: Dieses Kapitel erläutert die zentralen Ziele und Schwerpunkte der EU-Wettbewerbspolitik. Das Oberziel ist das reibungslose Funktionieren des europäischen Wirtschaftsraumes nach marktwirtschaftlichen Prinzipien. Fünf Schwerpunkte werden detailliert beschrieben: Verbot abgestimmter Verhaltensweisen, Verbot des Missbrauchs marktbeherrschender Stellungen, Fusionskontrolle, Liberalisierung von Sektoren und die Verhinderung von wettbewerbswidrigen Praktiken. Es werden die negativen Folgen wettbewerbswidrigen Handelns wie ineffiziente Faktorallokation und Wohlfahrtsverluste hervorgehoben.
Schlüsselwörter
EU-Wettbewerbspolitik, Binnenmarkt, Marktwirtschaft, Kartellverbot, Fusionskontrolle, Missbrauch marktbeherrschender Stellung, Liberalisierung, Strommarkt, EU-Osterweiterung, Wettbewerbsrecht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Wettbewerbspolitik der Europäischen Union
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Wettbewerbspolitik der Europäischen Union (EU), ihre historische Entwicklung, Ziele, Schwerpunkte und Anwendung am Beispiel des europäischen Strommarktes. Sie analysiert die materiell-rechtlichen Bestimmungen und beleuchtet die Herausforderungen im Kontext der EU-Osterweiterung.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der EU-Wettbewerbspolitik, ihre Ziele und Schwerpunkte, die materiell-rechtlichen Bestimmungen (Absprachen, Missbrauch marktbeherrschender Stellung, Unternehmenszusammenschlüsse, staatliche Beihilfen, Liberalisierung), eine Analyse des Wettbewerbs am Strommarkt und die Herausforderungen der EU-Osterweiterung.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einführung, ein Kapitel zur EU-Wettbewerbspolitik (inklusive Entstehungsgeschichte, Zielen und materiell-rechtlichen Bestimmungen), ein Kapitel zum Wettbewerb am Strommarkt und einen Ausblick auf die Entwicklung der Wettbewerbspolitik in den Beitrittsländern sowie die damit verbundenen Herausforderungen und Risiken. Kapitelzusammenfassungen sind enthalten.
Was sind die zentralen Ziele der EU-Wettbewerbspolitik?
Das Hauptziel ist das reibungslose Funktionieren des europäischen Wirtschaftsraumes nach marktwirtschaftlichen Prinzipien. Dies beinhaltet die Schaffung eines wettbewerblichen Umfelds für Unternehmen, den Schutz der Verbraucherinteressen und die Verhinderung wettbewerbswidriger Praktiken wie abgestimmte Verhaltensweisen, Missbrauch marktbeherrschender Stellungen und wettbewerbswidrige staatliche Beihilfen.
Welche materiell-rechtlichen Bestimmungen der EU-Wettbewerbspolitik werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Verbote abgestimmter Verhaltensweisen, den Missbrauch marktbeherrschender Stellungen, die Fusionskontrolle, die Liberalisierung von Sektoren und die Verhinderung wettbewerbswidriger staatlicher Beihilfen.
Wie wird der Strommarkt im Kontext der EU-Wettbewerbspolitik analysiert?
Die Arbeit analysiert den Strommarkt als Fallbeispiel, um die Anwendung der EU-Wettbewerbspolitik in der Praxis zu verdeutlichen. Es werden die spezifischen Anforderungen an die Wettbewerbspolitik im Stromsektor untersucht.
Welche Herausforderungen ergeben sich aus der EU-Osterweiterung für die Wettbewerbspolitik?
Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen der Integration der Beitrittsländer in den europäischen Binnenmarkt und die Anpassung der Wettbewerbspolitik an die unterschiedlichen wirtschaftlichen und politischen Gegebenheiten dieser Länder.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: EU-Wettbewerbspolitik, Binnenmarkt, Marktwirtschaft, Kartellverbot, Fusionskontrolle, Missbrauch marktbeherrschender Stellung, Liberalisierung, Strommarkt, EU-Osterweiterung, Wettbewerbsrecht.
- Quote paper
- Jens Hofmann (Author), 2004, Die Wettbewerbspolitik der EU, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49628