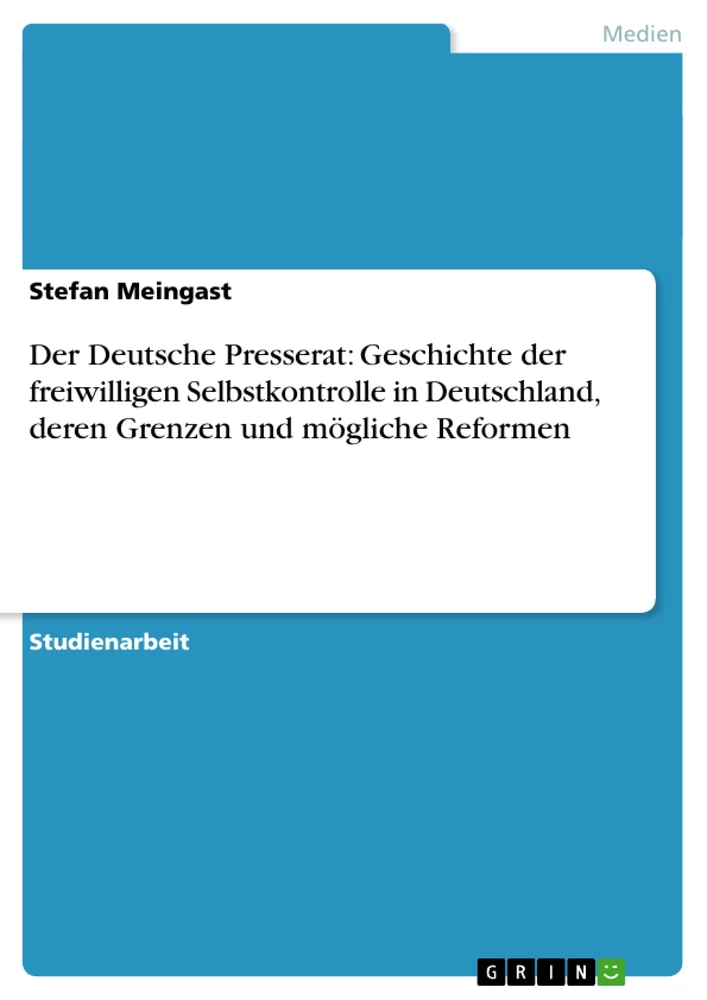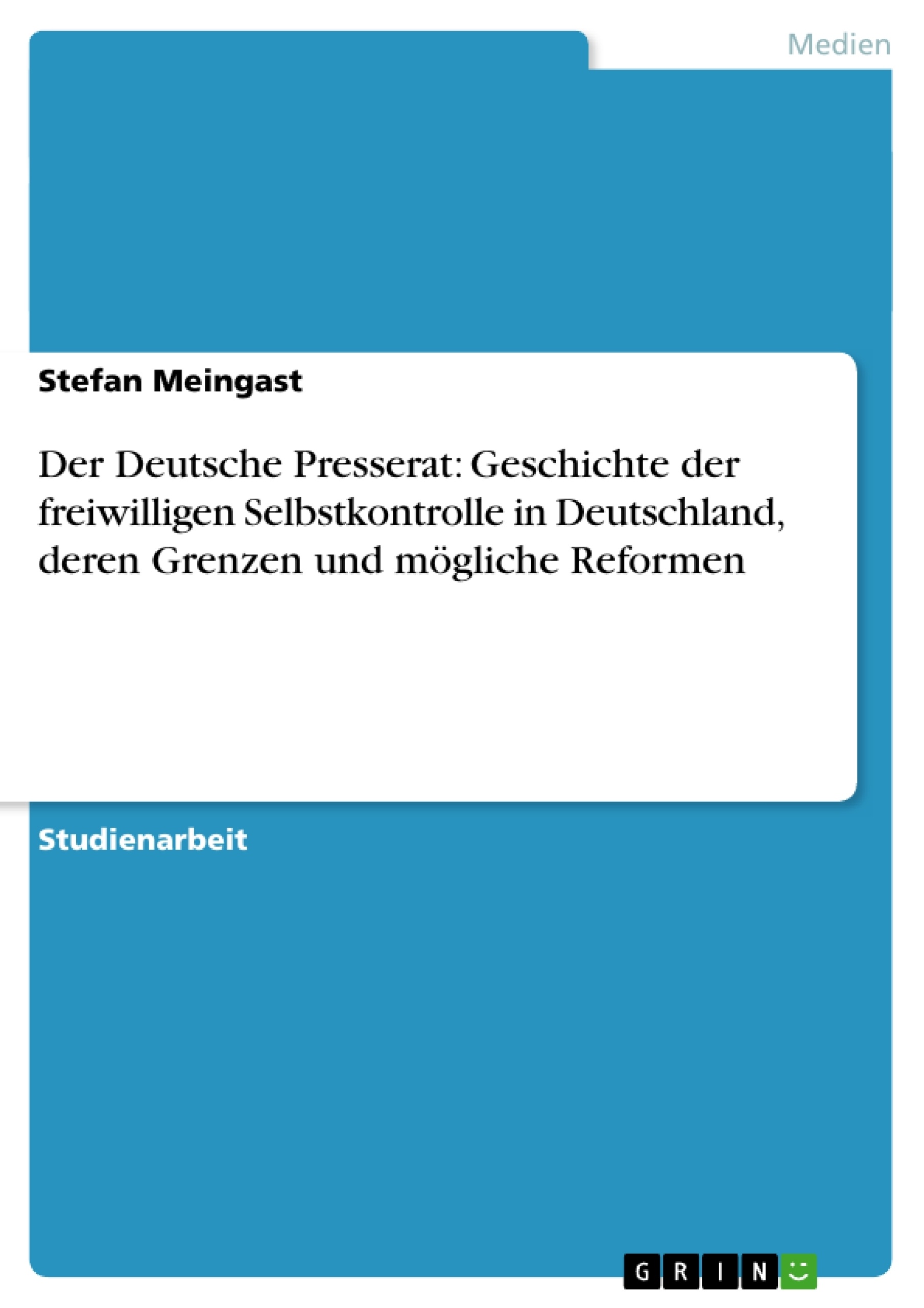In einem funktionierenden liberal-demokratischen Staat ist das Vorhandensein eines Informations- und Meinungsbildungsprozesses eine Grundvoraussetzung. Das Ergebnis dieses Prozesses, die öffentliche Meinung, ist ein Kollektivgut. Als solches ist es jedem uneingeschränkt zugänglich, niemand kann die Teilnahme am Prozess der Meinungsbildung verwehrt werden. Karl Popper weist auf den großen Einfluss der öffentlichen Meinung hin:
"Die öffentliche Meinung, was immer sie sein mag, ist sehr mächtig. Sie kann Regierungen stürzen, sogar nicht-demokratische Regierungen. Der Liberalismus muss eine solche Macht mir Argwohn betrachten."
Wo immer sich in der liberalen Demokratie eine solche Macht zeigt, stellt sich die Frage nach ihrer Verantwortlichkeit und ihrer Kontrolle. Staatliche Organe kommen hierfür nicht in Betracht. Der Staat kann sich zwar als Partner an der öffentlichen Meinungsbildung beteiligen, er kann aber niemals deren Lenkung und Kontrolle übernehmen. Die Presse ist für Popper die "institutionalisierte öffentliche Meinung" und ist in dieser Rolle ja gerade die Kontrolle der Staatsmacht. Sie kann daher ihrerseits nicht vom Staat abhängig sein. Als Ausweg aus dieser Gefahr für die öffentliche Meinung, die sich aus der unkontrollierten Macht der Presse oder aus der Macht des Staates über die Presse ergibt, existieren in einigen Ländern Einrichtungen, die sich als freiwillige Selbstkontrolle der Presse bezeichnen. In der Bundesrepublik Deutschland ist das seit 1956 der Deutsche Presserat. Als Hauptaufgabe sieht der Presserat seit seiner Gründung die Wahrung der Berufsethik im Inneren und die Verteidigung der Pressefreiheit nach außen.
In der vorliegenden Arbeit wird zu Beginn der Werdegang der Entstehung einer freiwilligen Presseselbstkontrolle in Deutschland geschildert - Ursachen der Gründung, wechselnde Schwerpunkte in der Arbeit des Presserats sowie dessen Existenzkrisen. Im zweiten Teil werden die Grenzen des Deutschen Presserats aufgezeigt und auf seine bedeutendsten Schwächen hingewiesen. Abgeschlossen wird die Arbeit mit Vorschlägen einer möglichen Reform des Deutschen Presserats und eventuellen Möglichkeiten einer Alternative zum Presserat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Freiwillige Selbstkontrolle der Presse
- Zur Geschichte des Deutschen Presserats
- Die ersten Jahre
- Der Beschwerdeausschuss
- Die Publizistischen Grundsätze
- Presserat in der Krise
- Zur Funktionsweise des Presserats
- Die Grenzen des Deutschen Presserats
- Verbesserungsvorschläge
- Die Reform
- Der Journalistenrat - die Alternative?
- Ohne Presserat
- Zur Geschichte des Deutschen Presserats
- Ergebnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Geschichte, den Grenzen und möglichen Reformen des Deutschen Presserats. Sie untersucht die Entstehung und Entwicklung der freiwilligen Selbstkontrolle der Presse in Deutschland, analysiert die Schwächen des aktuellen Systems und präsentiert verschiedene Lösungsansätze.
- Die Geschichte des Deutschen Presserats und seine Entstehung im Kontext der Nachkriegszeit
- Die Funktionsweise des Presserats und seine Rolle im Spannungsfeld zwischen Pressefreiheit und Selbstkontrolle
- Die Grenzen des Deutschen Presserats und seine wichtigsten Schwächen
- Verschiedene Reformvorschläge und die Frage nach einer möglichen Alternative zum Presserat
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung der öffentlichen Meinung in einer liberal-demokratischen Gesellschaft und die Rolle der Presse als „institutionalisierte öffentliche Meinung“. Es wird die Notwendigkeit einer unabhängigen Kontrolle der Presse betont und der Deutsche Presserat als Institution der freiwilligen Selbstkontrolle vorgestellt.
Freiwillige Selbstkontrolle der Presse
Zur Geschichte des Deutschen Presserats
Dieser Abschnitt schildert die Entstehung des Deutschen Presserats im Kontext der Nachkriegszeit und beleuchtet die Gründe für die Einführung einer freiwilligen Selbstkontrolle der Presse. Die Arbeit des Presserats wird anhand verschiedener Phasen und seiner Schwerpunkte dargestellt, einschließlich seiner Existenzkrisen.
Die Grenzen des Deutschen Presserats
Dieser Abschnitt analysiert die Grenzen des Deutschen Presserats und identifiziert seine bedeutendsten Schwächen. Er beleuchtet die Herausforderungen, denen sich der Presserat gegenübersieht, und die Kritik an seiner Effizienz und Wirksamkeit.
Verbesserungsvorschläge
Dieser Abschnitt präsentiert verschiedene Reformvorschläge für den Deutschen Presserat. Er diskutiert die Stärken und Schwächen unterschiedlicher Modelle und beleuchtet die Frage, ob der Presserat in seiner jetzigen Form reformiert werden kann oder ob eine alternative Institution geschaffen werden sollte.
Schlüsselwörter
Freiwillige Selbstkontrolle, Pressefreiheit, Deutscher Presserat, Medienethik, Journalismus, Pressegesetz, Reformvorschläge, Alternative, Medienkonzentration, öffentliche Meinung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Hauptaufgabe des Deutschen Presserats?
Der Presserat wacht über die Einhaltung der Berufsethik (Pressekodex) und verteidigt gleichzeitig die Pressefreiheit gegenüber staatlichen Eingriffen.
Warum wurde der Presserat 1956 gegründet?
Die Gründung war eine Reaktion auf drohende staatliche Pressegesetze. Die Verleger und Journalisten wollten durch freiwillige Selbstkontrolle beweisen, dass der Staat keine Aufsicht benötigt.
Was sind die Publizistischen Grundsätze?
Dies ist der Pressekodex, der ethische Richtlinien für die tägliche Arbeit von Journalisten festlegt, wie etwa die Sorgfaltspflicht, die Achtung der Menschenwürde und die Trennung von Werbung und Redaktion.
Welche Sanktionsmöglichkeiten hat der Presserat?
Die schärfste Waffe ist die öffentliche Rüge. Das betroffene Medium ist moralisch verpflichtet, diese Rüge abzudrucken. Es gibt jedoch keine Bußgelder oder rechtlichen Strafen.
Welche Kritik wird am aktuellen System des Presserats geübt?
Kritiker bezeichnen ihn oft als „zahnlosen Tiger“, da die freiwillige Selbstkontrolle keine rechtlich bindende Wirkung hat und manche Verlage Rügen ignorieren.
- Citation du texte
- Stefan Meingast (Auteur), 2000, Der Deutsche Presserat: Geschichte der freiwilligen Selbstkontrolle in Deutschland, deren Grenzen und mögliche Reformen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49662