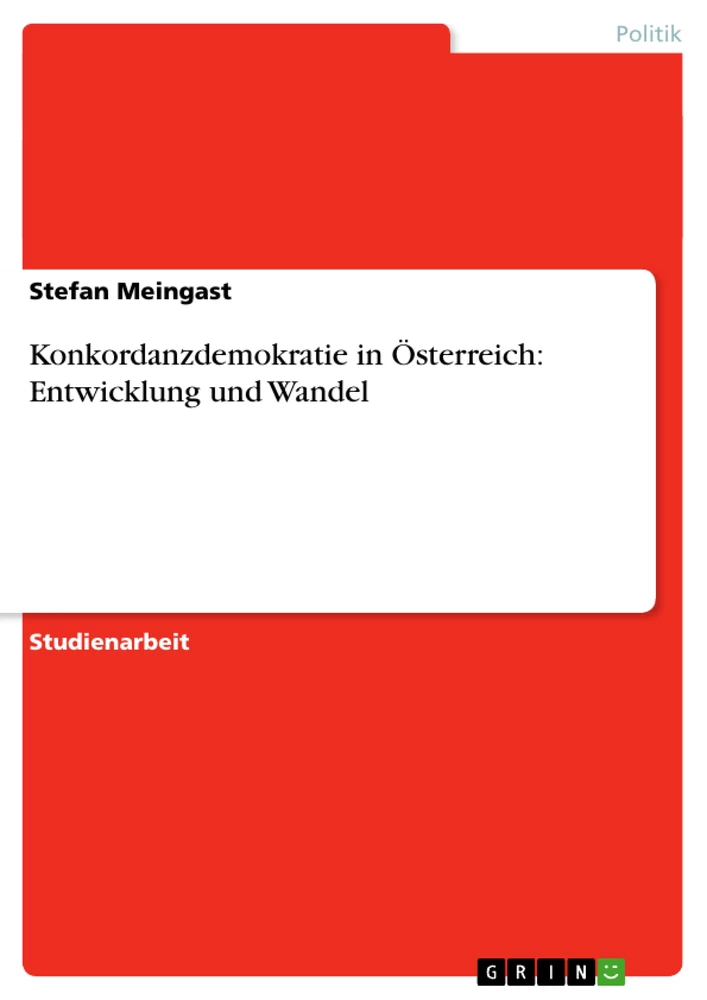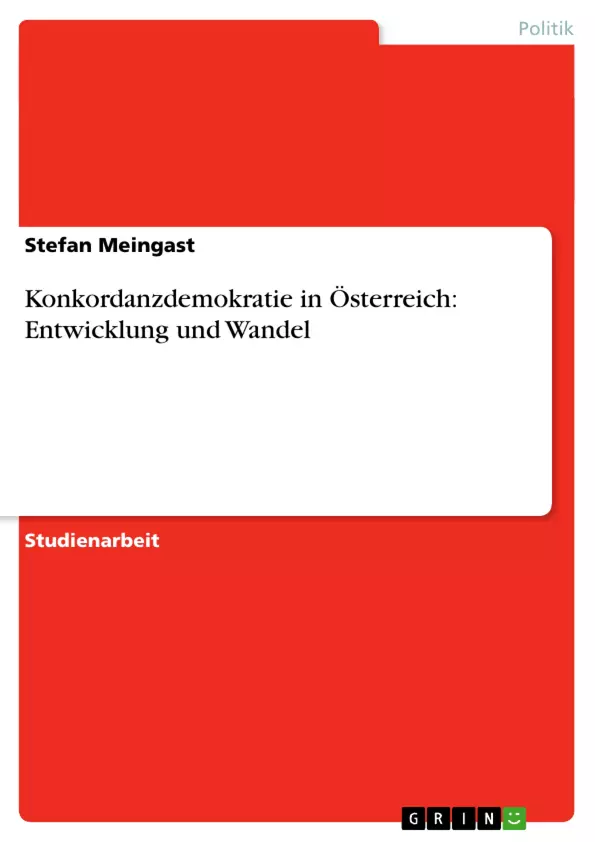„In Österreich herrscht Windstille“ - so die Zustandsbeschreibung der österreichischen Demokratie des bekannten österreichischen Politikwissenschaftlers Anton Pelinka im Jahr 1985. Pelinka kritisierte die politische Unbeweglichkeit und den Reformstillstand auf der „Insel der Seligen“, wie Österreich häufig bezeichnet wird, und machte dafür besonders das Politikmodell der Konkordanzdemokratie verantwortlich, wie es in Österreich Anwendung fand. Tatsächlich hatten nach dem Gewitter des Nationasozialismus und des Zweiten Weltkriegs die politischen Eliten der Großparteien nach dem Gegenteil von dem gesucht, wozu die Erste Republik, die letztlich den Bürgerkrieg vom Damm gebrochen hatte, geworden war. Die Lösung hieß: Konsens statt Konkurrenz. Der Wettbewerb der Parteien um Wählerstimmen sollte relativiert werden und ein Netzwerk von Institutionen sollte gewährleisten, dass jenseits der Regierungsform und den jeweiligen Mehrheitsverhältnissen eine Balance der Macht garantiert war. Die Zweite Republik war seitdem geprägt von dem Gedanken, dass in wesentlichen politischen Fragen stets ein Konsens gesucht werden müsse und die Suche nach dem politischen Kompromiss den einzig akzeptablen Weg darstellt.
Was fast 50 Jahre für große Stabilität im politischen System Österreichs gesorgt hat, erlebt in den letzten Jahren eine umfangreiche Infragestellung. Die Zeit der „Windstille“ scheint zu Ende zu gehen. Der Konsens und die ausgewogene Machtverteilung der Parteien, diese vormaligen Werte an sich, werden heute in der Öffentlichkeit mitunter als „Packelei“, „Mauschelei“ oder „Postenschacher“ tituliert, der konsensstiftende Kitt einer geschichtlichen Negativerfahrung Erste Republik ist endgültig am Ende seiner Funktionalität angelangt. So zeichnet sich seit Mitte der 1980er Jahre, besonders augenfällig aber seit Beginn der ÖVP/FPÖ-Regierung im Jahr 2000, ein Wandel in der Konkordanztradition Österreichs ab, dessen Weiterentwicklung noch nie so stark betrieben wurde und dessen Ende zwar nicht die Ablöse des Konkordanzprinzips in Österreich, aber durchaus eine Stärkung der konkurrendemokratischen Elemente bedeuten kann.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Zum Begriff „Konkordanzdemokratie“
- 1. Bedeutung des Kompromisses
- 2. Theoretische Voraussetzungen
- 3. Typische Strukturprinzipien
- III. Historische Entwicklung in Österreich
- 1. Die Erste Republik
- 2. Die Zweite Republik
- a) Die ersten Jahre
- b) Durchsetzung des Proporzgedankens
- c) Das Ende der Großen Koalition
- d) Neue Strategien
- e) Wandel der Parteienlandschaft
- IV. Merkmale der österreichischen Konkordanzdemokratie
- 1. Ausgangspunkte
- 2. Kernelemente
- 3. Wandel der Politikstruktur
- I. Generationswechsel
- II. Auflösung dominanter Lagermentalitäten
- III. Veränderung der Parteienlandschaft
- IV. Regierung als eigenständiger Akteur
- V. Erosion des Korporatismus
- VI. Neue Wirtschaftspolitik
- VII. Veränderte Außenpolitik
- 4. Aktuelle Tendenzen
- 5. Das Ende der Konkordanzdemokratie?
- V. Die Zukunft des österreichischen Konkordanzmodells
- 1. Notwendige Reformen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit bietet einen Überblick über die Entwicklung der österreichischen Konkordanzdemokratie. Sie beleuchtet die Merkmale dieses Modells und die Veränderungen, die es in den letzten Jahrzehnten erfahren hat. Das Ziel ist es, die Dimension des Wandels der österreichischen Politiklandschaft zu verdeutlichen und die Debatte um das mögliche Ende der Konkordanz zu kontextualisieren.
- Entwicklung und Wandel des Begriffs „Konkordanzdemokratie“
- Historische Entwicklung der Konkordanz in Österreich (Erste und Zweite Republik)
- Charakteristische Merkmale der österreichischen Konkordanzdemokratie
- Wandel der Politikstruktur und der Parteienlandschaft
- Aktuelle Tendenzen und die Frage nach dem Fortbestand des Konkordanzmodells
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung stellt den Ausgangspunkt der Arbeit dar. Sie kontrastiert die von Anton Pelinka beschriebene „Windstille“ der österreichischen Politik der 1980er Jahre mit den jüngsten Entwicklungen und der damit verbundenen Infragestellung des Konkordanzmodells. Die Arbeit wird als Überblick über die Entwicklung, die Merkmale und den Wandel der österreichischen Konkordanzdemokratie positioniert, wobei der Fokus auf der Darstellung der Dimension dieses Wandels liegt. Der begrenzte Umfang der Arbeit wird erwähnt und der Verzicht auf eine detaillierte Diskussion des Für und Wider der Konkordanzdemokratie sowie auf institutionelle Spezifika wie den Regierungsproporz und die Sozialpartnerschaft wird begründet.
II. Zum Begriff „Konkordanzdemokratie“: Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff der Konkordanzdemokratie im Vergleich zum Westminster-Parlamentarismus. Es unterstreicht die Bedeutung von Kompromiss und Konsens im konkordanzdemokratischen Regelsystem, im Gegensatz zum Mehrheitsprinzip des Westminster-Modells. Der Einfluss von Minderheiten wird hervorgehoben, ebenso wie Mechanismen, die eine „Majorisierung“ verhindern. Die Rolle des Interessen-ausgleichs und die Praxis des „Junktims“ in österreichischen Koalitionen werden diskutiert. Die theoretischen Voraussetzungen einer Konkordanzdemokratie nach Arend Lijphart, mit Fokus auf fragmentierte Gesellschaften und die Notwendigkeit von vier Voraussetzungen für erfolgreichen „Consociationalism“, bilden den Abschluss des Kapitels.
III. Historische Entwicklung in Österreich: Das Kapitel beschreibt die historische Entwicklung der Konkordanzdemokratie in Österreich, unterteilt in die Erste und Zweite Republik. Es beleuchtet die Ursachen für die Entstehung des Konkordanzmodells als Reaktion auf die Erfahrungen der Ersten Republik und den Zweiten Weltkrieg, die Suche nach Konsens und Kompromiss statt Konkurrenz. Die Entwicklung in der Zweiten Republik wird detaillierter dargestellt, inklusive der ersten Jahre, der Durchsetzung des Proporzgedankens, des Endes der Großen Koalition, neuer Strategien und des Wandels der Parteienlandschaft. Der Fokus liegt auf der Darstellung der historischen Entwicklung und den Schlüsselfaktoren, die das Konkordanzmodell geprägt haben.
IV. Merkmale der österreichischen Konkordanzdemokratie: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Merkmale des österreichischen Konkordanzmodells. Es analysiert die Ausgangspunkte, Kernelemente und den Wandel der Politikstruktur. Der Wandel wird als umfassender Prozess beschrieben, der verschiedene Aspekte der Politik betrifft: Generationswechsel, Auflösung dominanter Lagermentalitäten, Veränderung der Parteienlandschaft, die Regierung als eigenständiger Akteur, Erosion des Korporatismus, neue Wirtschaftspolitik und veränderte Außenpolitik. Das Kapitel untersucht die aktuellen Tendenzen und stellt abschließend die Frage nach dem möglichen Ende der Konkordanz in Österreich.
Schlüsselwörter
Konkordanzdemokratie, Österreich, Konsens, Kompromiss, Proporz, Parteienlandschaft, Wandel, Politikstruktur, Historische Entwicklung, Erste Republik, Zweite Republik, Konsensdemokratie, Korporatismus, Regierungsproporz, Pluralismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Österreichische Konkordanzdemokratie
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über die österreichische Konkordanzdemokratie. Er behandelt deren Entstehung, Entwicklung, charakteristische Merkmale und den Wandel, den sie in den letzten Jahrzehnten erfahren hat. Besonderes Augenmerk liegt auf der Darstellung der Dimension dieses Wandels und der damit verbundenen Debatte um ein mögliches Ende des Konkordanzmodells.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt folgende Themen: Den Begriff "Konkordanzdemokratie" im Vergleich zum Westminster-System, die historische Entwicklung in der Ersten und Zweiten Republik Österreichs, die Merkmale der österreichischen Konkordanzdemokratie (Ausgangspunkte, Kernelemente, Wandel der Politikstruktur), aktuelle Tendenzen und die Frage nach dem Fortbestand des Modells, sowie notwendige Reformen.
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zum Begriff der Konkordanzdemokratie, zur historischen Entwicklung in Österreich, zu den Merkmalen der österreichischen Konkordanzdemokratie und zur Zukunft des österreichischen Konkordanzmodells. Jedes Kapitel enthält eine Zusammenfassung. Zusätzlich werden die Zielsetzung und die Themenschwerpunkte, sowie Schlüsselwörter genannt.
Welche Aspekte der Konkordanzdemokratie werden im Detail behandelt?
Im Detail werden behandelt: Die Bedeutung von Kompromiss und Konsens, die Rolle von Minderheiten und Mechanismen zur Verhinderung von "Majorisierung", der Einfluss von Interessen-ausgleich und "Junktim", die theoretischen Voraussetzungen nach Arend Lijphart, die Ursachen für die Entstehung des Modells, die Entwicklung in der Ersten und Zweiten Republik (inkl. Große Koalition und Wandel der Parteienlandschaft), der Wandel der Politikstruktur (Generationswechsel, Auflösung von Lagermentalitäten, etc.), aktuelle Tendenzen und die Frage nach einem möglichen Ende der Konkordanz.
Welche Schlüsselbegriffe sind im Text relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Konkordanzdemokratie, Österreich, Konsens, Kompromiss, Proporz, Parteienlandschaft, Wandel, Politikstruktur, Historische Entwicklung, Erste Republik, Zweite Republik, Konsensdemokratie, Korporatismus, Regierungsproporz, Pluralismus.
Wird die Debatte um das Für und Wider der Konkordanzdemokratie geführt?
Nein, der Text verzichtet auf eine detaillierte Diskussion des Für und Wider der Konkordanzdemokratie. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der Entwicklung und des Wandels des Modells.
Welche Rolle spielt der Vergleich zum Westminster-System?
Der Vergleich mit dem Westminster-Parlamentarismus dient dazu, die Besonderheiten der Konkordanzdemokratie hervorzuheben, insbesondere den Unterschied zwischen Konsens/Kompromiss und Mehrheitsprinzip.
Für wen ist dieser Text gedacht?
Der Text ist für Personen gedacht, die sich einen Überblick über die österreichische Konkordanzdemokratie verschaffen möchten, insbesondere für akademische Zwecke und die Analyse politischer Themen.
- Quote paper
- Stefan Meingast (Author), 2003, Konkordanzdemokratie in Österreich: Entwicklung und Wandel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49663