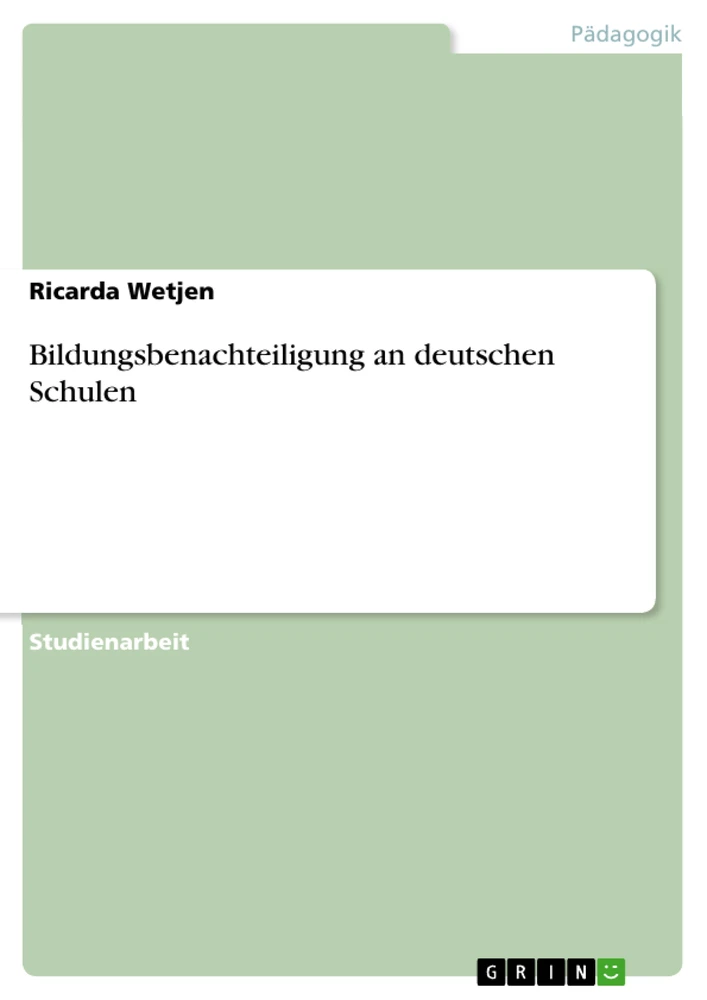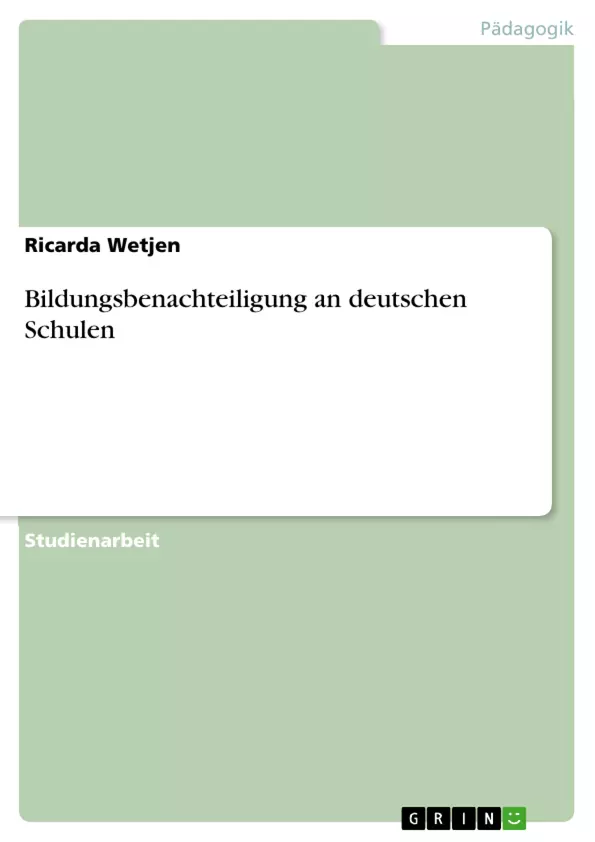Die vorliegende Arbeit soll einen klassismuskritischen Blick auf die Institution Schule geben, indem sie die Benachteiligung von Schülern und Schülerinnen mit einem sozio-ökonomisch niedrigen Status behandelt.
Darüber hinaus wird explizit auf die Unterschiede zwischen Schülern und Schülerinnen eingegangen, um eine intersektionale Form von institutioneller Bildungsbenachteiligung zu thematisieren. Unter Anbetracht beider möglichen Faktoren von Bildungsbenachteiligung stellt sich folgende Fragestellung: Wie beeinflusst die sozio-ökonomische Herkunft den Bildungserfolg von SchülerInnen und bestehen dabei explizite Unterschiede zwischen den Geschlechtern?
Seit Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts besteht in Deutschland die Schulpflicht und noch immer lässt sich nicht bestreiten, dass nach wie vor Bildungsungleichheiten, aufgrund der sozio-ökonomischen Herkunft der Schüler und Schülerinnen, bestehen. Verschiedene empirische Studien bestätigen die Abhängigkeit der Bildungschancen der Kinder von der sozialen Herkunft ihrer Eltern. Die gesellschaftliche Stellung bestimmt somit noch immer wir leben. Beispielhaft ist hier zu nennen, dass Kinder aus ArbeiterInnenklassen häufig in Arbeiterklassen verbleiben, das gleiche gilt für Kinder aus höheren Klassen.
Die hohe Relevanz von Bildung in einer immer leistungsorientierten Gesellschaft ist einleuchtend. Bildungsprozesse beeinflussen das Berufsleben, sowie die Bewältigung gesellschaftlicher Anforderungen und entscheiden somit über das Scheitern oder den Erfolg individueller Ambitionen. Darüber hinaus bestimmt Bildung über die soziale, politische und kulturelle Teilhabe. Die Institution Schule stellt dabei die größte Einflussnahme im lern- und sozialisationsbiographischen Prozess eines Menschen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begrifflichkeiten
- Klassismus
- sozioökonomischer Status
- Bildungsbenachteiligung
- Chancengleichheit
- Bildungsexpansion
- Selektivität des Schulsystems
- Unterschiede zwischen den Geschlechtern
- Schichtspezifische Chancenunterschiede
- Ergebnisse der PISA-Studie
- Geschlechtsspezifische Chancenunterschiede
- Theorien der Bildungsungleichheit im Schulwesen
- Makrosoziologische Theorien
- Modernisierungstheorie
- Konflikttheorie
- Mikrosoziologische Theorien der Chancenungleichheit
- Ressourcentheorie
- Humankapitalansatz
- Makrosoziologische Theorien
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Bildungsbenachteiligung von Schülern und Schülerinnen an deutschen Schulen, die aus sozioökonomisch niedrigeren Verhältnissen stammen, unter besonderer Berücksichtigung der Geschlechterunterschiede. Sie untersucht, wie die sozioökonomische Herkunft den Bildungserfolg beeinflusst und ob es dabei explizite Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt.
- Klassismus und seine Auswirkungen auf die Bildung
- Sozioökonomische Bildungsungleichheit in Deutschland
- Die Rolle des Schulsystems in der Reproduktion von Bildungsungleichheit
- Geschlechtsspezifische Chancenunterschiede in der Bildung
- Theorien zur Erklärung von Bildungsungleichheit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problematik der Bildungsungleichheit in Deutschland beleuchtet und die Fragestellung der Arbeit formuliert. Im zweiten Kapitel werden zentrale Begrifflichkeiten wie Klassismus, sozioökonomischer Status, Bildungsbenachteiligung und Chancengleichheit erläutert. Das dritte Kapitel behandelt die Bildungsexpansion in Deutschland und zeigt auf, wie sie mit der Thematik der schichtspezifischen Bildungsbenachteiligung zusammenhängt. Das vierte Kapitel analysiert die Selektivität des deutschen Schulsystems und seine Auswirkungen auf die SchülerInnen. Die Ergebnisse der PISA-Studie werden im fünften Kapitel vorgestellt, wobei explizit auf die Unterschiede innerhalb der Geschlechter eingegangen wird. Das sechste Kapitel befasst sich mit schichtspezifischen und geschlechtsspezifischen Chancenunterschieden innerhalb des deutschen Bildungssystems. Um mögliche Erklärungsversuche für die bestehende Bildungsungleichheit zu finden, werden im siebten Kapitel makrosoziologische und mikrosoziologische Theorien von Chancenungleichheit vorgestellt.
Schlüsselwörter
Klassismus, Bildungsbenachteiligung, sozioökonomischer Status, Chancengleichheit, Bildungsexpansion, Selektivität, PISA-Studie, Geschlechterunterschiede, Theorien der Bildungsungleichheit.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst der sozioökonomische Status den Bildungserfolg?
Empirische Studien zeigen, dass Kinder aus niedrigeren sozialen Schichten oft in diesen verbleiben, da das Schulsystem bestehende Ungleichheiten eher reproduziert als ausgleicht.
Was bedeutet „Klassismus“ im Schulwesen?
Klassismus bezeichnet die Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft oder des ökonomischen Status innerhalb der Institution Schule.
Gibt es Geschlechterunterschiede bei der Bildungsbenachteiligung?
Die Arbeit untersucht intersektionale Aspekte und zeigt auf, dass sich soziale Herkunft und Geschlecht unterschiedlich auf die Bildungschancen auswirken können.
Welche Theorien erklären Bildungsungleichheit?
Vorgestellt werden makrosoziologische (Modernisierungs-, Konflikttheorie) und mikrosoziologische Ansätze (Ressourcentheorie, Humankapitalansatz).
Was sagen die PISA-Studien über Deutschland aus?
Die Arbeit analysiert die PISA-Ergebnisse, die eine starke Kopplung zwischen sozialer Herkunft und Kompetenzerwerb in Deutschland bestätigen.
- Citation du texte
- Ricarda Wetjen (Auteur), 2017, Bildungsbenachteiligung an deutschen Schulen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/496651