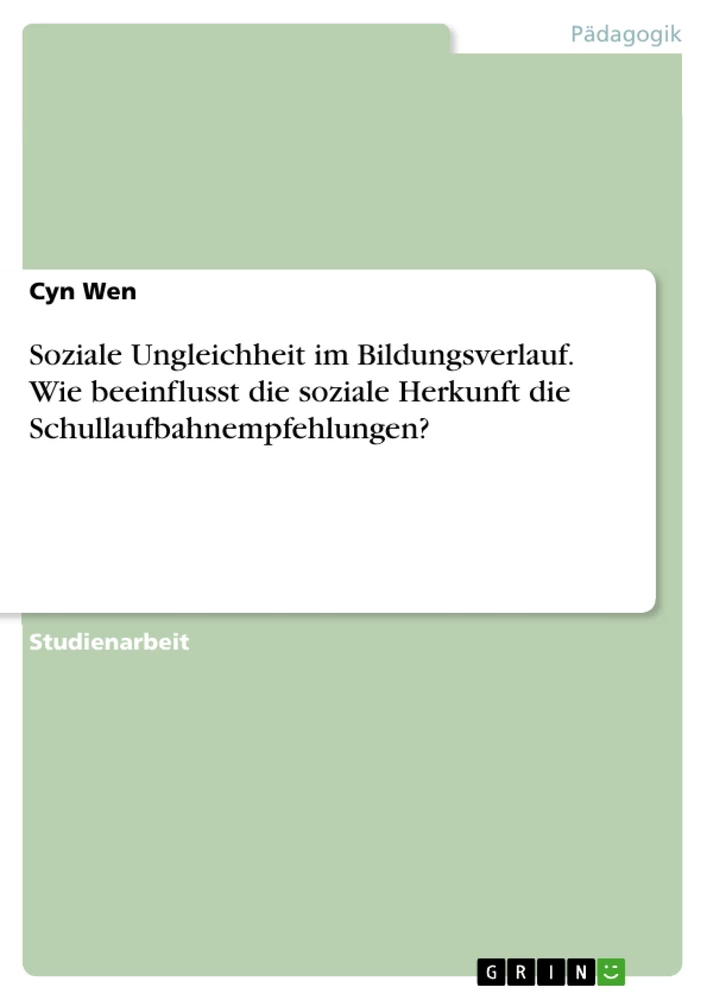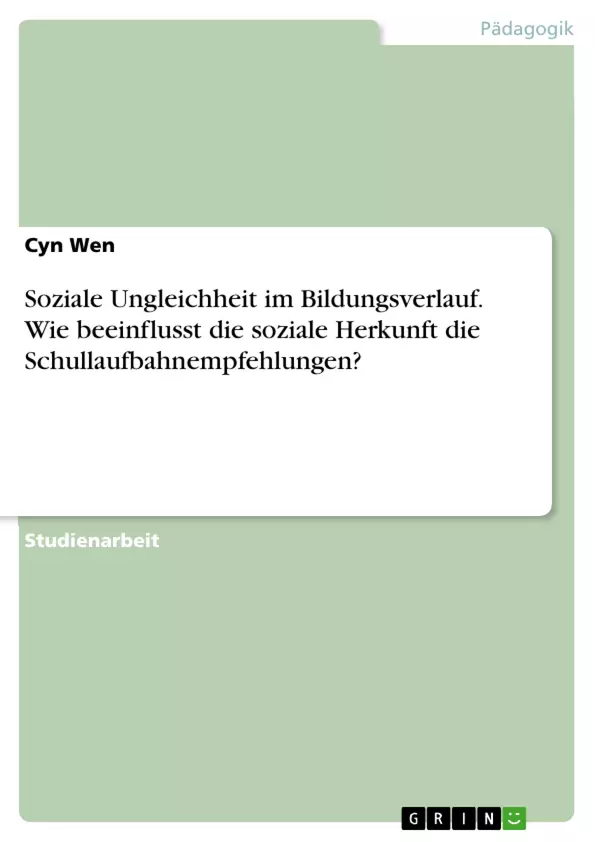Diese wissenschaftliche Hausarbeit beschäftigt sich mit der sozialen Ungleichheit, insbesondere die der schulischen Chancenungleichheit, aus der Sicht und den Theorien Pierre Bourdieus. Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht dabei der Aspekt der Schullaufbahnempfehlung. Zentrale Fragestellungen werden dabei sein, wie die Schullaufbahnempfehlung zu Stande kommt, wie sich diese zusammensetzt und welchen Einfluss die soziale Herkunft darauf hat.
Bourdieu, der von Haus aus Sozialtheoretiker und Kultursoziologe war, stellt durch seine Theorien und Konzepte auch für die Erziehungs- und Bildungswissenschaften einen wichtigen Bezugspunkt dar. Zu Beginn dieser Arbeit wird mit Hilfe Bourdieus Text: „Die konservative Schule- die soziale Chancenungleichheit gegenüber Schule und Kultur“ die Einführung dieser Arbeit stehen, in dem die soziale Chancenungleichheit gegenüber Schule und Kultur deutlich werden soll. Darauf aufbauend, wird die soziale Ungleichheit auf den Aspekt der Schullaufbahnempfehlungen untersucht. Abschließend werden im Resümee die zentralen Aussagen dieser Arbeit zusammengefasst und mögliche Förderpunkte aufgewiesen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die konservative Schule- die soziale Chancenungleichheit gegenüber Schule und Kultur nach Bourdieu
- Wie werden die Schullaufbahnempfehlungen von der sozialen Herkunft beeinflusst?
- Einführung
- Wie kann nun die soziale Herkunft Einfluss auf die Schullaufbahnempfehlungen nehmen?
- Resümee
- Zusammenfassung
- Rückbezug auf der einleitenden Fragestellung
- Eigene Bewertung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Hausarbeit untersucht die soziale Ungleichheit im Bildungsverlauf, insbesondere die der schulischen Chancenungleichheit, aus der Sicht und den Theorien Pierre Bourdieus. Im Fokus steht dabei der Aspekt der Schullaufbahnempfehlung, mit dem Ziel, die Entstehung und Zusammensetzung der Empfehlung sowie den Einfluss der sozialen Herkunft darauf zu analysieren.
- Soziale Ungleichheit im Bildungssystem
- Einfluss der sozialen Herkunft auf Schullaufbahnempfehlungen
- Theorien von Pierre Bourdieu
- Kulturelles Kapital und dessen Bedeutung für schulischen Erfolg
- Soziale Chancenungleichheit in der Schule
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Problematik der sozialen Ungleichheit im Bildungssystem und führt in die Thematik der Schullaufbahnempfehlungen ein. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der „konservativen Schule“ nach Bourdieu, wobei die soziale Chancenungleichheit gegenüber Schule und Kultur anhand des kulturellen Kapitals und des Einflusses des familiären Milieus auf den Schulerfolg erläutert wird. Das Kapitel „Wie werden die Schullaufbahnempfehlungen von der sozialen Herkunft beeinflusst?“ befasst sich mit der Frage, wie die soziale Herkunft Einfluss auf die Schullaufbahnempfehlungen nimmt und analysiert die verschiedenen Faktoren, die zu einer Reproduktion der sozialen Ungleichheit beitragen.
Schlüsselwörter
Soziale Ungleichheit, Bildungsverlauf, Schullaufbahnempfehlung, soziale Herkunft, Pierre Bourdieu, kulturelles Kapital, familiäres Milieu, schulischer Erfolg, Chancenungleichheit, Bildungssystem, Reproduktion sozialer Ungleichheit.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst die soziale Herkunft die Schullaufbahnempfehlung?
Die Arbeit zeigt auf, dass Kinder aus privilegierten Milieus aufgrund ihres kulturellen Kapitals oft bessere Empfehlungen erhalten als Kinder aus bildungsfernen Schichten.
Was versteht Pierre Bourdieu unter „kulturellem Kapital“?
Es umfasst Bildung, Wissen und kulturelle Fähigkeiten, die innerhalb der Familie weitergegeben werden und den Erfolg im Bildungssystem maßgeblich mitbestimmen.
Warum bezeichnet Bourdieu die Schule als „konservativ“?
Weil sie bestehende soziale Ungleichheiten eher reproduziert, statt sie durch echte Chancengleichheit aufzuheben.
Welche Faktoren fließen in eine Schullaufbahnempfehlung ein?
Neben den Noten spielen oft unbewusste Erwartungen der Lehrer und das häusliche Milieu der Schüler eine entscheidende Rolle bei der Einschätzung der Eignung.
Gibt es Lösungsansätze zur Reduzierung von Bildungsungleichheit?
Das Resümee der Arbeit weist auf mögliche Förderpunkte hin, um die Benachteiligung durch die soziale Herkunft im Schulsystem zu verringern.
- Quote paper
- Cyn Wen (Author), 2017, Soziale Ungleichheit im Bildungsverlauf. Wie beeinflusst die soziale Herkunft die Schullaufbahnempfehlungen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/496654