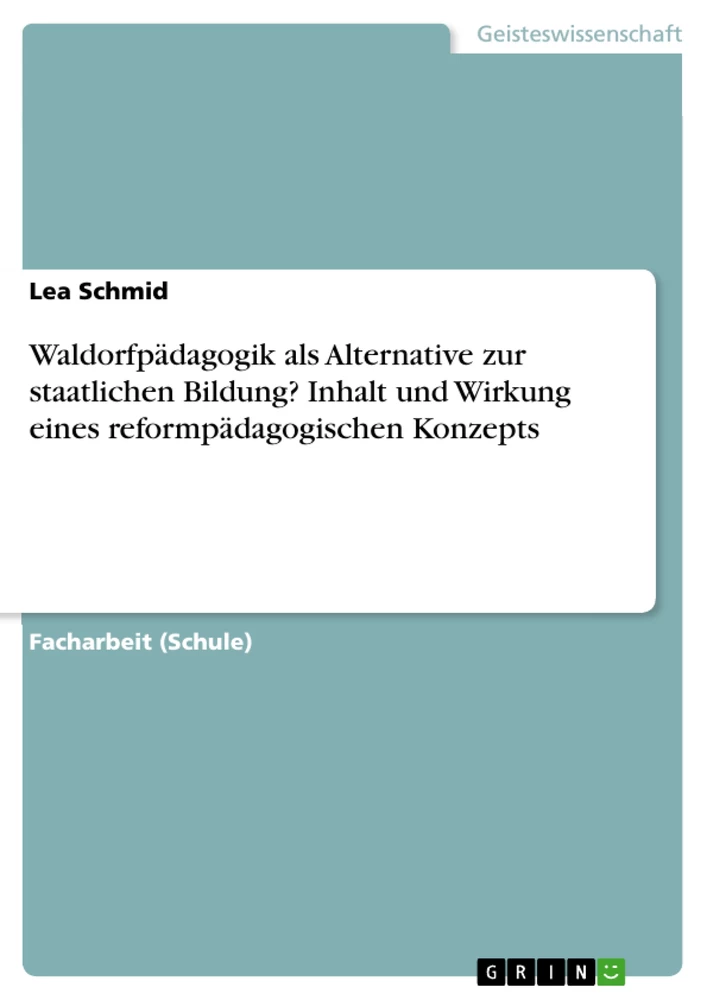Unser späteres Denken und Handeln wird maßgeblich davon beeinflusst, auf welche Art und Weise wir zu Beginn unseres Lebens auf dem Weg zum Erwachsenwerden begleitet werden. Entscheidend ist dabei nicht nur, WAS an Wissen und Werten einer Gesellschaft weitergegeben wird, sondern vor allem auch WIE dies geschieht. Großen Einfluss auf den Charakter unserer Gesellschaft hat also das Bildungssystem. Zu diesem Thema gibt es weltweit viele Diskussionen, weil es sehr verschiedene Standpunkte gibt, welche Pädagogik nun die beste ist, um junge Menschen auf das Leben vorzubereiten.
Das staatliche Bildungssystem ist darauf ausgelegt, jährlich tausende Jugendliche mit einem Schulabschluss in ihr weiteres Leben zu entlassen. Dabei hat jedes Bundesland in Deutschland verschiedene Normen, aber alle verbindet das Leistungsprinzip und ein hoher Grad an Anonymität aufgrund der großen Schülerzahl.
Seit Jahren mehrt sich Kritik auch aus den Reihen der staatlichen Schulen. Verschiedene Interessengruppen (Lehrer, Eltern, Schüler und Politiker) fordern Veränderungen am deutschen Schulsystem. Diese Arbeit untersucht, auf welchen pädagogischen Theorien das Waldorfkonzept basiert und wie es in der Realität heute umgesetzt wird. Anschließend wird die Waldorfpädagogik in der Praxis behandelt. Mich interessiert wie sich das Lernen dort von staatlichen Schulen inhaltlich und methodisch unterscheidet und wie Waldorfschulen organisiert sind.Um einen Realitätsbezug herzustellen habe ich einen Fragebogen erstellt. Die Auswertung wird die individuelle Wahrnehmung der eigenen Schulzeit von Waldorfschülern und von Schülern an staatlichen Schulen gegenüberstellen. Abschließend soll eine eigene kritische Betrachtung dieser Bildungsform zu einem persönlichen Resümee führen.
Die Arbeit besteht aus einem theoretischen Teil, der sich mit der Entstehung und Wirkung der Waldorfpädagogik als möglicher Alternative zur staatlichen Bildung auseinandersetzt und einem praktischen Teil - einer Umfrage und deren detaillierter Auswertung - in der Meinungen staatlicher Schüler und Waldorfschüler gegenübergestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- I - THEORIETEIL
- 1 Einleitung
- 2 Waldorfpädagogik - Was steckt dahinter?
- 2.1 Rudolf Steiner - der geistige Vater der Anthroposophie
- 2.2 Anfänge der Waldorfpädagogik und Aufbau der ersten Waldorfschule
- 3 Theoretische Grundlagen der Waldorfpädagogik
- 3.1 Jahrsiebte und die drei Wahrnehmungsebene
- 4 Der Rahmenlehrplan
- 4.1 Wissensvermittlung
- 4.2 Unterrichtsstruktur
- 4.3 Klassenlehrerprinzip
- 4.4 Sprachunterricht
- 4.5 Eurythmie
- 4.6 Praktika
- 4.7 Jahresarbeiten
- 4.8 Klassenfahrten
- 4.9 Zeugnisse
- 4.10 Abschlüsse
- 5 Schulorganisation
- 5.1 Gründung und Arbeitsweise einer Waldorfschule
- 5.2 Finanzen
- 5.3 Ausbildung der Lehrer
- 6 Die Umfrage
- 6.1 Erstellung eines Fragebogens
- 6.2 Auswertung der Antworten
- 7 Resümee
- II - PRAXISTEIL
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert die Waldorfpädagogik und hinterfragt ihre Eignung als Alternative zum staatlichen Bildungssystem. Der Fokus liegt auf der Erforschung der pädagogischen Grundlagen und der praktischen Umsetzung des Waldorfkonzepts.
- Die Entstehung und Entwicklung der Waldorfpädagogik im Kontext der anthroposophischen Philosophie Rudolf Steiners
- Die theoretischen Grundlagen der Waldorfpädagogik, insbesondere die Bedeutung der Jahrsiebte und der drei Wahrnehmungsebenen
- Der Rahmenlehrplan der Waldorfschule und die Besonderheiten der Wissensvermittlung und Unterrichtsstruktur
- Die Organisation und Struktur von Waldorfschulen im Vergleich zum staatlichen Bildungssystem
- Eine empirische Analyse der Wahrnehmung und Erfahrung von Waldorfschülern im Vergleich zu Schülern an staatlichen Schulen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung, die die Bedeutung des Bildungssystems für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen beleuchtet und die Relevanz der Waldorfpädagogik als Alternative zum staatlichen System herausstreicht. Im zweiten Kapitel wird der geistige Vater der Anthroposophie, Rudolf Steiner, vorgestellt. Seine Biografie wird beleuchtet, insbesondere sein Einfluss auf die Entwicklung der Waldorfpädagogik. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den theoretischen Grundlagen der Waldorfpädagogik, wobei der Fokus auf den Jahrsiebten und den drei Wahrnehmungsebenen liegt. Das vierte Kapitel analysiert den Rahmenlehrplan der Waldorfschule und beleuchtet spezifische Aspekte wie die Wissensvermittlung, Unterrichtsstruktur, das Klassenlehrerprinzip, den Sprachunterricht, Eurythmie, Praktika, Jahresarbeiten, Klassenfahrten, Zeugnisse und Abschlüsse. Im fünften Kapitel werden die Organisation und Struktur von Waldorfschulen beleuchtet, einschließlich der Gründung und Arbeitsweise, der Finanzierungsmodelle und der Ausbildung der Lehrer. Schließlich wird im sechsten Kapitel eine empirische Umfrage präsentiert, die die Wahrnehmung und Erfahrung von Waldorfschülern im Vergleich zu Schülern an staatlichen Schulen untersucht.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Waldorfpädagogik, Anthroposophie, Rudolf Steiner, Jahrsiebte, Wahrnehmungsebenen, Rahmenlehrplan, Unterrichtsstruktur, Schulorganisation, empirische Analyse, staatliches Bildungssystem und Bildungsalternativen.
- Citation du texte
- Lea Schmid (Auteur), 2018, Waldorfpädagogik als Alternative zur staatlichen Bildung? Inhalt und Wirkung eines reformpädagogischen Konzepts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/496742