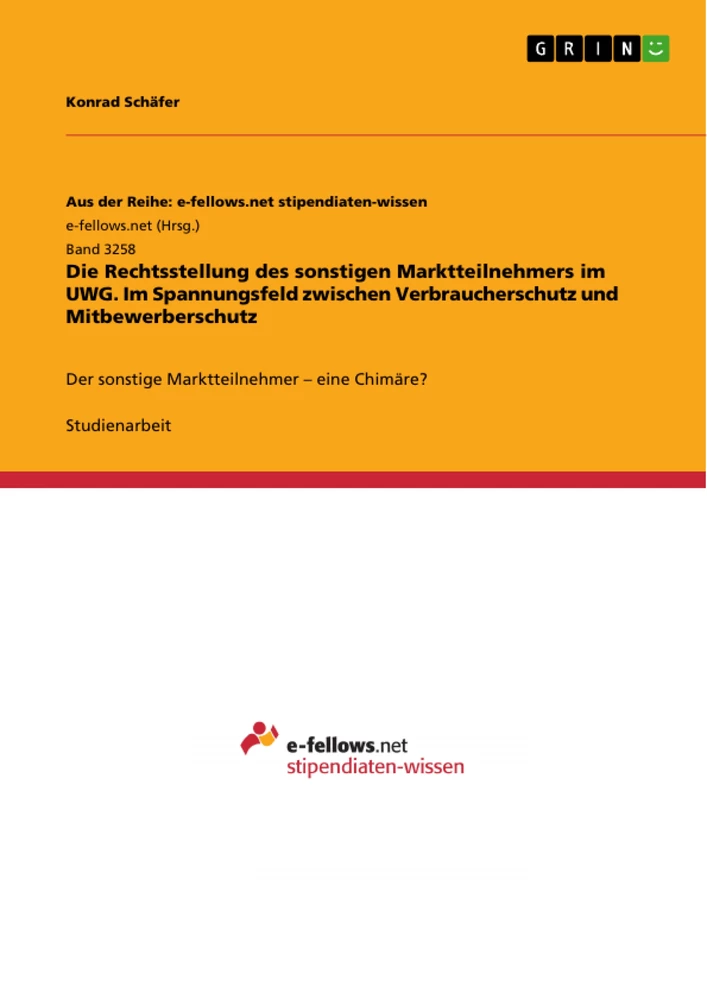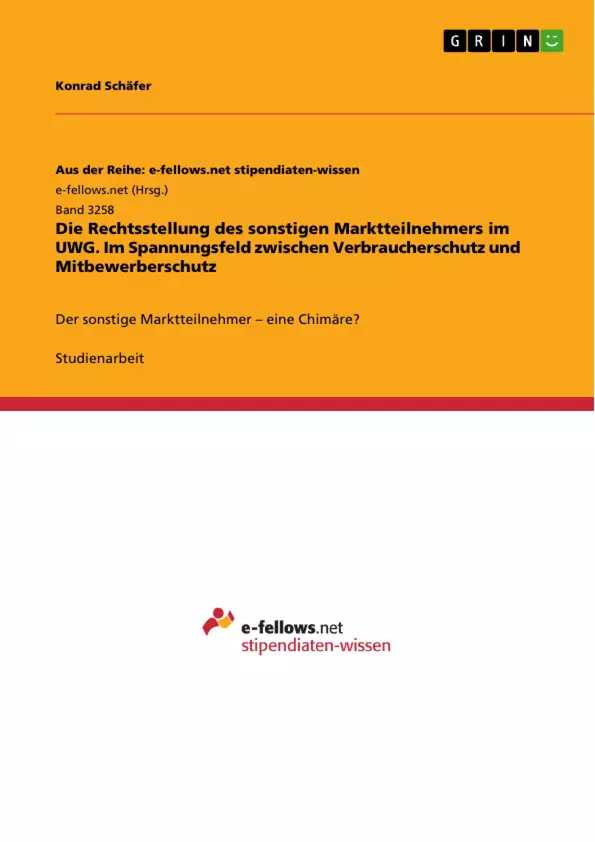Der "sonstige Marktteilnehmer" wurde im Zuge der UWG-Reform 2004 mit in die Schutzzweckbestimmung des § 1 UWG aufgenommen und wird heute auch in den §§ 2, 3a, 4a, 5 und 7 UWG explizit erwähnt. In der Literatur wird er trotzdem meist nur am Rande behandelt. Oft wird er schlicht in die Nähe des Verbrauchers gerückt, ohne sich eingehend mit seinen Interessen auseinanderzusetzen. Dass der sonstige Marktteilnehmer anders als ein Verbraucher unternehmerisch tätig wird und möglicherweise geschäftliche Interessen verfolgt, wird weitestgehend vernachlässigt.
Ob dies gerechtfertigt ist, soll Gegenstand dieser Untersuchung sein. Es stellt sich damit die Forschungsfrage, ob der sonstige Marktteilnehmer eine eigene Daseinsberechtigung besitzt oder neben dem Mitbewerber und Verbraucherschutz eine nur untergeordnete, wenn nicht gar zu vernachlässigende Rolle spielt und nur als Chimäre existiert. Ferner wird die Frage nach der Rechtsstellung des sonstigen Marktteilnehmers aufgeworfen und ob das Konstrukt des sonstigen Marktteilnehmers den europarechtlichen Vorgaben sowie den Schutzzwecken des UWG genügen kann.
Diese Untersuchung soll zunächst klären, wer überhaupt von dem Begriff des sonstigen Marktteilnehmers umfasst ist, und grundlegende europarechtliche Vorgaben beleuchten. Anschließend folgt eine kritische Auseinandersetzung mit dem Schutzzweck des sonstigen Marktteilnehmers. Die bis dahin gewonnenen Erkenntnisse sollen dann dem Schutzregime des sonstigen Marktteilnehmers gegenübergestellt werden. Soweit erforderlich, werden Alternativen zur derzeitigen Gesetzeslage vorgeschlagen.
Inhaltsverzeichnis
- A) Einleitung
- B) Abgrenzung Mitbewerber – Verbraucher – sonstiger Marktteilnehmer
- I) Analyse der Rechtsprechung
- II) Kritik
- C) Europarechtliche Grundlagen
- D) Schutzzwecke des UWG
- E) Schutzregime der „sonstigen Marktteilnehmer“
- I) Materiell-rechtlicher Schutz
- 1) Aggressive geschäftliche Handlungen
- (a) Anzapfen
- (b) Drittverantwortlichkeit
- 2) Irreführung
- (a) Tatbestand
- (b) Irreführende vergleichende Werbung
- (c) Irreführung durch Unterlassen
- 3) Unzumutbare Belästigung
- 4) Rechtsbruch
- 5) Sonstige Fallgruppen
- (a) Abwerben von Mitarbeitern
- (b) Ausschluss vom Wettbewerb
- (c) Geschäftsschädigende Äußerungen
- 1) Aggressive geschäftliche Handlungen
- II) Rechtsfolgen
- 1) Abwehransprüche
- 2) Schadensersatz
- 3) Abschöpfungsanspruch
- I) Materiell-rechtlicher Schutz
- F) Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Rechtstellung des „sonstigen Marktteilnehmers“ im Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb (UWG) im Spannungsfeld zwischen Verbraucherschutz und Mitbewerberschutz. Sie analysiert, ob der „sonstige Marktteilnehmer“ eine eigene Daseinsberechtigung besitzt oder lediglich eine untergeordnete Rolle im UWG spielt.
- Abgrenzung des Begriffs „sonstiger Marktteilnehmer“
- Europarechtliche Grundlagen für den Schutz des „sonstigen Marktteilnehmers“
- Schutzzwecke des UWG und deren Relevanz für den „sonstigen Marktteilnehmer“
- Materiell-rechtlicher Schutz des „sonstigen Marktteilnehmers“ im UWG
- Rechtsfolgen für den „sonstigen Marktteilnehmer“ im Falle einer Verletzung seiner Rechte
Zusammenfassung der Kapitel
- A) Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Daseinsberechtigung des „sonstigen Marktteilnehmers“ im UWG und erläutert den Aufbau der Arbeit.
- B) Abgrenzung Mitbewerber – Verbraucher – sonstiger Marktteilnehmer: Dieser Abschnitt analysiert die Rechtsprechung zur Abgrenzung der verschiedenen Marktteilnehmer im UWG und kritisiert die bisherige Behandlung des „sonstigen Marktteilnehmers“ in der Literatur.
- C) Europarechtliche Grundlagen: Dieser Teil befasst sich mit den europarechtlichen Vorgaben, die für den Schutz des „sonstigen Marktteilnehmers“ relevant sind.
- D) Schutzzwecke des UWG: Dieser Abschnitt untersucht die Schutzzwecke des UWG und ihre Relevanz für den „sonstigen Marktteilnehmer“.
- E) Schutzregime der „sonstigen Marktteilnehmer“: Hier werden die materiell-rechtlichen Schutzbestimmungen des UWG für den „sonstigen Marktteilnehmer“ und die möglichen Rechtsfolgen im Falle einer Verletzung seiner Rechte dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem „sonstigen Marktteilnehmer“ im UWG, Verbraucherschutz, Mitbewerberschutz, Abgrenzung von Marktteilnehmern, Europarecht, Schutzzwecke des UWG, materiell-rechtlicher Schutz, Rechtsfolgen, aggressive geschäftliche Handlungen, Irreführung, Unzumutbare Belästigung, Rechtsbruch.
Häufig gestellte Fragen
Wer ist der „sonstige Marktteilnehmer“ im UWG?
Es handelt sich um eine Restkategorie für Personen, die weder Mitbewerber noch Verbraucher sind, aber geschäftliche Interessen verfolgen oder unternehmerisch tätig werden.
Seit wann ist dieser Begriff im Gesetz verankert?
Der „sonstige Marktteilnehmer“ wurde im Zuge der UWG-Reform 2004 in die Schutzzweckbestimmung des § 1 UWG aufgenommen.
Welche unlauteren Handlungen können sonstige Marktteilnehmer betreffen?
Dazu gehören aggressive geschäftliche Handlungen, Irreführung, unzumutbare Belästigung und Rechtsbruch.
Welche Rechtsfolgen haben Verstöße gegen deren Schutzregime?
Mögliche Rechtsfolgen sind Abwehransprüche (Unterlassung), Schadensersatz und der Abschöpfungsanspruch.
Entspricht das deutsche Konstrukt den europarechtlichen Vorgaben?
Die Arbeit untersucht kritisch, ob diese nationale Kategorie den EU-Richtlinien und den Schutzzwecken des unlauteren Wettbewerbs genügt.
- Citation du texte
- Konrad Schäfer (Auteur), 2016, Die Rechtsstellung des sonstigen Marktteilnehmers im UWG. Im Spannungsfeld zwischen Verbraucherschutz und Mitbewerberschutz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/496768