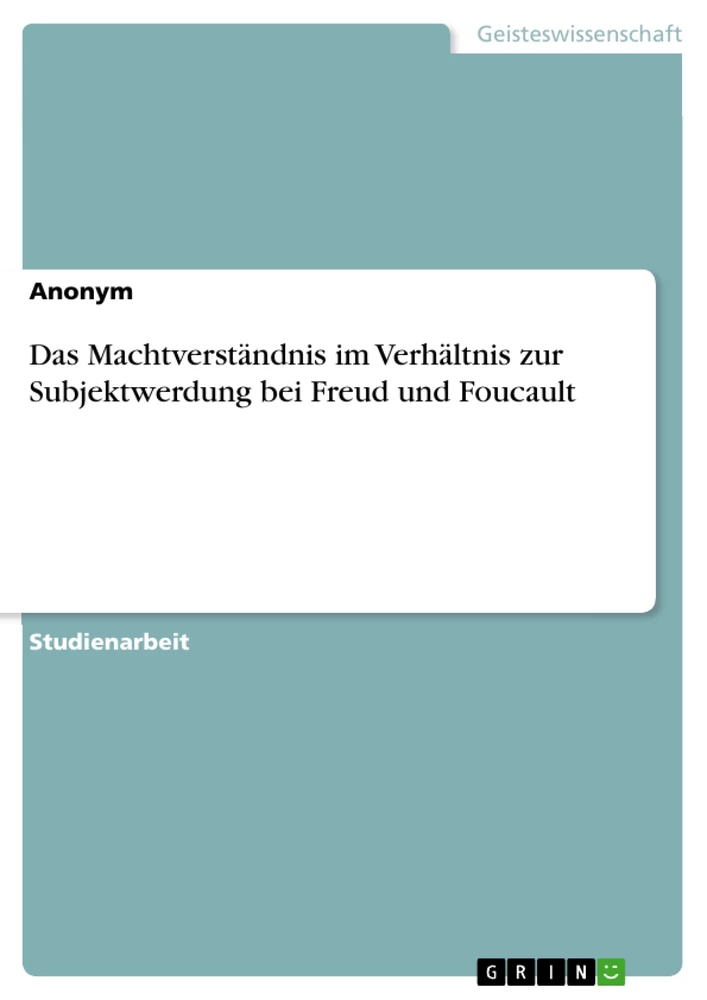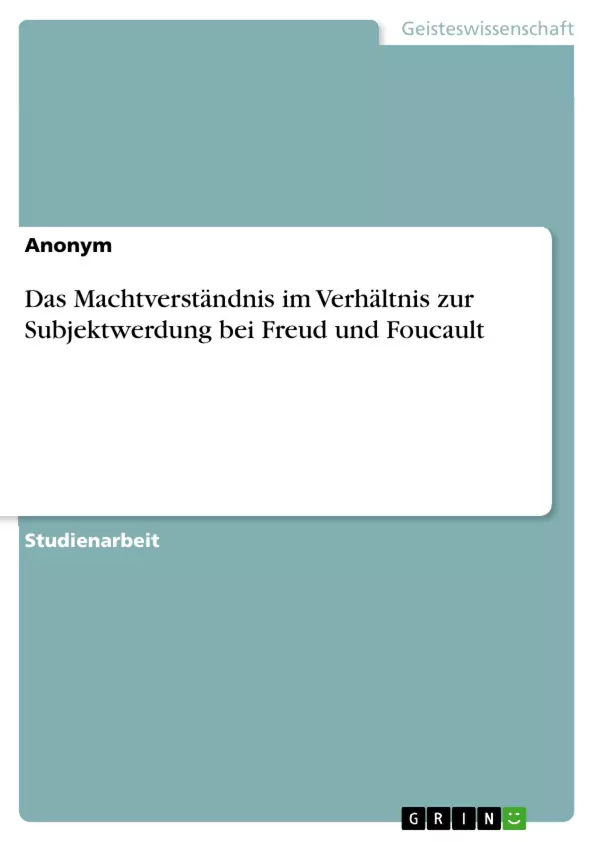Die folgende Hausarbeit soll dieses Thema behandeln, mit der Frage: Wie gelangt Foucault, trotz einer Theorie von Macht, die den gesamten Gesellschaftskörper durchzieht, zu einer solch positiven Auswirkung für das Subjekt? Hierzu wird als erstes die negative Basis von Freuds Kulturtheorie rekonstruiert, um im Weiteren, den Gegensatz von positiv und negativ bewerteter Macht zu erkennen. Vor allem soll hier das Werk Triebstruktur und Gesellschaft von Herbert Marcuse dienen, um den negativen Aspekt von Freuds Kulturtheorie herauszuheben, gerade im Hinblick auf die Entwicklung des Subjekts. Im zweiten Teil wird versucht, zu erläutern, wie Michel Foucault im Gegensatz zu Freud zu einer grundlegend positiv konnotierten Macht gelangt und wie sich diese auf das Subjekt auswirkt. Als Abschluss soll noch kurz aufgezeigt werden, wie nach Foucault der Mensch in die modernen Machtstrukturen implementiert ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die negativ konnotierte Macht
- Das Lust- und Realitätsprinzip
- Das formende Realitätsprinzip
- Das Über-Ich
- Die repressive Macht
- Zwischenfazit
- Die positiv konnotierte Macht
- Warum so negativ?
- Das Wie der Macht
- Foucaults Annahmen im Vergleich zu Freud
- Die Armee und Fabriken vom 16. bis ins 18. Jahrhundert
- Die produktive und positive Macht
- Das Subjekt in der Macht-Wissen-Beziehung
- Panoptismus
- Subjektivierungskritik
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Machtverständnis bei Sigmund Freud und Michel Foucault im Verhältnis zur Subjektwerdung. Sie beleuchtet die Frage, wie Foucault trotz einer allgegenwärtigen Machtstruktur zu einer positiven Auswirkung von Macht auf das Subjekt gelangt. Dazu wird zunächst Freuds negative Konzeption von Macht im Rahmen seiner Kulturtheorie analysiert, wobei die Bedeutung der Triebstruktur und die repressiven Aspekte der gesellschaftlichen Ordnung hervorgehoben werden.
- Freuds negativ konnotierte Macht und die Unterdrückung der Triebe
- Der Unterschied zwischen Freuds und Foucaults Machtverständnis
- Foucaults positive Konzeption von Macht und ihre Auswirkungen auf das Subjekt
- Die Rolle des Panoptismus und der Subjektivierungskritik bei Foucault
- Die Einbettung des Menschen in moderne Machtstrukturen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die traditionelle Auseinandersetzung mit dem Naturzustand des Menschen in der Anthropologie, insbesondere im Kontext der Werke von Platon und Thomas Hobbes. Freud wird als ein wichtiger Vertreter eines pessimistischen Menschenbildes vorgestellt, dessen Psychoanalyse die Anthropologie des 20. Jahrhunderts prägte. Foucaults Gegenposition zu Freud wird dargelegt, in der er eine positive Auswirkung von Macht auf das Subjekt sieht.
- Die negativ konnotierte Macht: Dieses Kapitel analysiert Freuds Kulturtheorie, die von der Unvereinbarkeit zwischen der Befriedigung der menschlichen Triebe und der zivilisierten Gesellschaft ausgeht. Die Bedeutung der Triebunterdrückung und die daraus resultierende Geschichte der menschlichen Unterdrückung werden beleuchtet. Es werden die zentralen Elemente von Freuds Konzept des Lust- und Realitätsprinzips vorgestellt, um seine Sichtweise auf die Subjektwerdung zu erklären.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Macht, Subjektwerdung, Triebstruktur, Kulturtheorie, Freud, Foucault, Panoptismus, Subjektivierungskritik, negative Macht, positive Macht.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2016, Das Machtverständnis im Verhältnis zur Subjektwerdung bei Freud und Foucault, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/496860