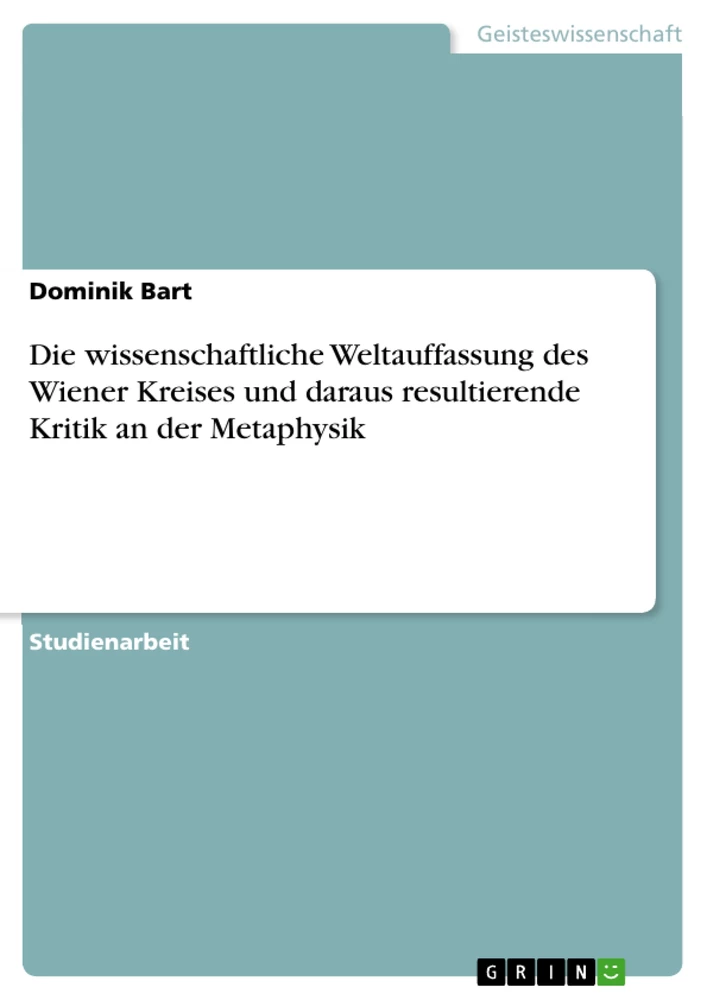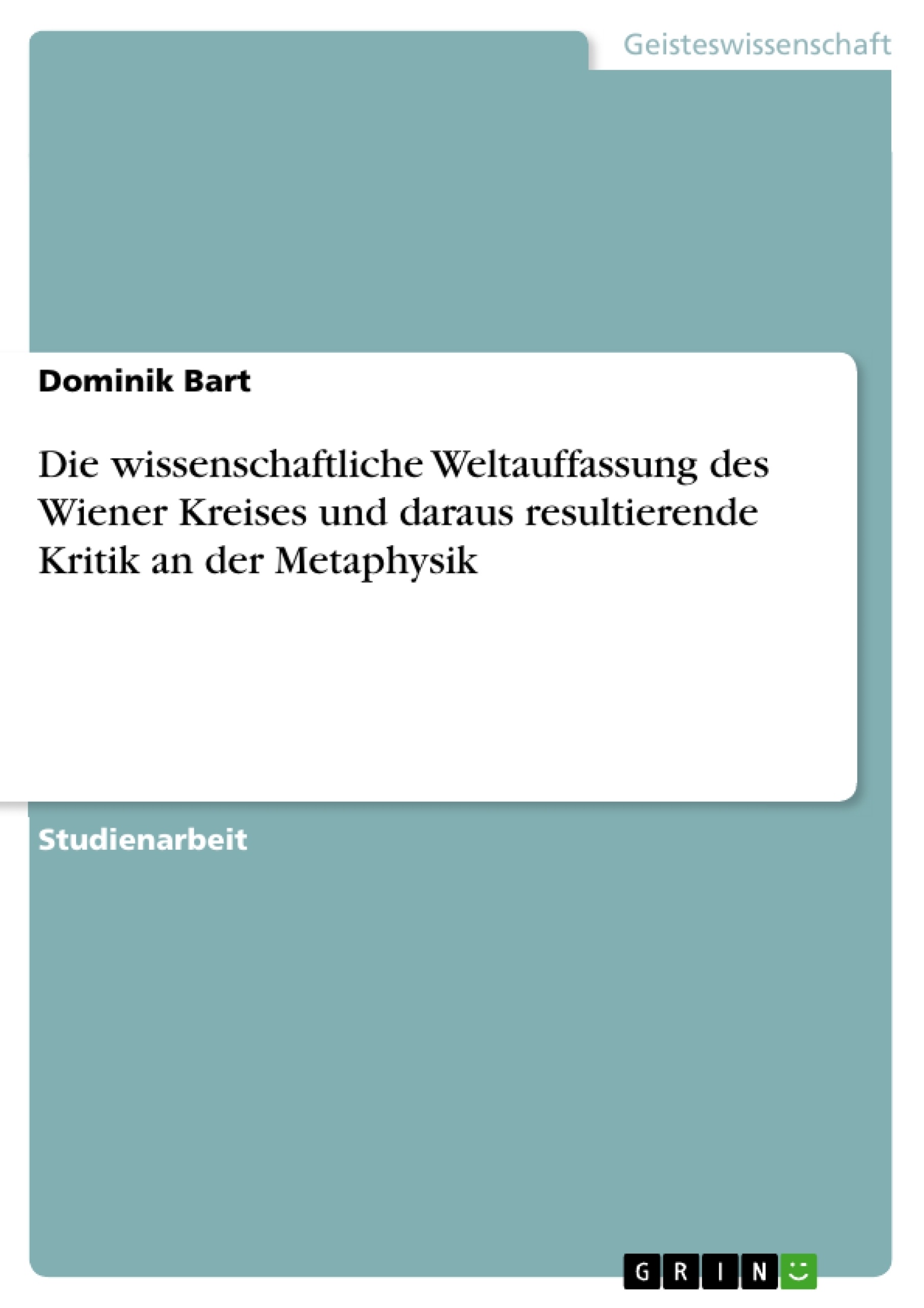Diese Arbeit befasst sich mit der Widerlegung der Metaphysik, die vom "Wiener Kreis" radikal kritisiert wurde. Das Mittel für die „Bereinigung“ der Philosophie war das Sinnkriterium, das von Rudolph Carnap entwickelt wurde. Durch dieses Kriterium konnten ausgewählte philosophische Richtungen als sinnlos überführt und aller Berechtigungsgrundlage beraubt werden. Diese teils radikale Vorgehensweise ist in fast allen Veröffentlichungen des Wiener Kreises vorzufinden.
Der „Wiener Kreis“ war zweifelsfrei einer der interessantesten philosophischen Gruppierungen des 20. Jahrhunderts. Gegründet wurde der Wiener Kreis von Moritz Schlick in den 1930er Jahren in Wien, wobei Otto Neurath, Rudolph Carnap, Hans Reichenbach und Hans Hahn schon bald zu den Mitgliedern gezählt werden konnten. Die Philosophen setzten es sich zum Ziel, eine neue Weltanschauung, nämlich die „wissenschaftliche Weltauffassung“ durchzusetzen, die Gottlob Frege’s „neue Logik“ als Grundlagen haben sollte. Als weitere Einflüsse können Wittgenstein, Russel und David Hume genannt werden. Ab Anfang der 1940er Jahre wurde die in der Philosophie, aber auch darüber hinaus, vielbeachtete Zeitschrift „Erkenntnis“ vom Wiener Kreis herausgegeben, die dem Autor als Grundlage für die Analyse der Weltauffassung des Wiener Kreises dienen wird.
Die Mitglieder des Wiener Kreises hatten es sich zur Aufgabe gemacht, die neue, wissenschaftliche Weltauffassung radikal durchzusetzen und somit in der Philosophie alle in ihren Augen unwissenschaftlichen Bereiche zu eliminieren. So sollten lediglich empirische Wahrnehmungen als hinreichendes Mittel für die Verifikation einer These akzeptiert werden.
Somit ist es nicht verwunderlich, dass das Kritisieren und Anzweifeln oder gar Widerlegen metaphysischer Elemente in der Philosophie eine zentrale Aufgabe war.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Die wissenschaftliche Weltauffassung des Wiener Kreises
- Logischer Empirismus als Grundgedanke des Wiener Kreises
- Der logische Aufbau der Welt nach Carnap
- Das Sinnkriterium
- Anwendung des Sinnkriteriums als Kritik an der Metaphysik
- Metaphysische Scheinbegriffe
- Metaphysische Scheinsätze
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der wissenschaftlichen Weltauffassung des Wiener Kreises und dessen Kritik an der Metaphysik. Sie analysiert die Kernideen des logischen Empirismus und das von Rudolph Carnap entwickelte Sinnkriterium, mit dem die Mitglieder des Wiener Kreises metaphysische Aussagen als sinnlos disqualifizierten.
- Der logische Empirismus als Grundprinzip des Wiener Kreises
- Die Ablehnung metaphysischer Aussagen aufgrund des Sinnkriteriums
- Die Bedeutung von Beobachtung und tautologischer Umformung für wissenschaftliche Erkenntnis
- Carnaps Konzept des logischen Aufbaus der Welt und seine Rolle in der Kritik an der Metaphysik
- Die Bedeutung der Einheitswissenschaft und die wissenschaftliche Weltauffassung im Kontext der Philosophie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Vorwort
Das Vorwort stellt den Wiener Kreis als eine einflussreiche philosophische Gruppierung des 20. Jahrhunderts vor und beleuchtet deren Zielsetzung, eine wissenschaftliche Weltauffassung zu etablieren, die auf Freges „neuer Logik“ basiert. Die Bedeutung der Zeitschrift „Erkenntnis“ und die kritische Haltung des Wiener Kreises gegenüber metaphysischen und anderen „unwissenschaftlichen“ Bereichen der Philosophie werden hervorgehoben.
2. Die wissenschaftliche Weltauffassung des Wiener Kreises
2.1 Logischer Empirismus als Grundgedanke des Wiener Kreises
Dieser Abschnitt definiert die wissenschaftliche Weltauffassung des Wiener Kreises, die auf empirischen Beobachtungen und der systematischen Überprüfung von Erkenntnissen beruht. Die Ablehnung von Erkenntnissen a priori und die Bedeutung von Logik und Mathematik als Werkzeuge zur Umformung von Beobachtungen in tautologische Aussagen werden hervorgehoben.
2.2 Der logische Aufbau der Welt nach Carnap
Carnaps „Logischer Aufbau der Welt“ wird als ein System vorgestellt, das wissenschaftliche Begriffe auf tatsächliche Wahrnehmungen zurückführt. Die Definition von Elementarerlebnissen, die Rolle der Ähnlichkeitsrelation und das Konzept des Konstitutionssystems, mit dem alle wissenschaftlichen Begriffe konstituiert werden können, werden erläutert.
Schlüsselwörter
Logischer Empirismus, Wiener Kreis, wissenschaftliche Weltauffassung, Metaphysik, Sinnkriterium, Beobachtung, tautologische Umformung, Einheitswissenschaft, Elementarerlebnisse, Konstitutionssystem, Carnap, Neurath, Frege, Erkenntnis, Logik, Mathematik.
Häufig gestellte Fragen
Wer gründete den Wiener Kreis?
Der Wiener Kreis wurde in den 1930er Jahren von Moritz Schlick in Wien ins Leben gerufen.
Was ist das Ziel der wissenschaftlichen Weltauffassung?
Das Ziel war die Etablierung einer Philosophie, die rein auf Logik und empirischer Wahrnehmung basiert und metaphysische Elemente eliminiert.
Was besagt das Sinnkriterium von Rudolph Carnap?
Ein Satz ist nur dann sinnvoll, wenn er entweder empirisch verifizierbar ist oder eine logische Tautologie darstellt. Metaphysische Sätze gelten daher als „Scheinsätze“.
Was versteht man unter Logischem Empirismus?
Es ist eine philosophische Richtung, die empirische Beobachtung als einzige Quelle der Erkenntnis anerkennt und Logik sowie Mathematik als formale Werkzeuge nutzt.
Welche Rolle spielt die Metaphysik für den Wiener Kreis?
Der Wiener Kreis kritisierte die Metaphysik radikal als unwissenschaftlich und sinnlos, da ihre Begriffe nicht auf tatsächliche Wahrnehmungen zurückgeführt werden können.
Was ist eine „Einheitswissenschaft“?
Das Konzept einer Einheitswissenschaft zielt darauf ab, alle wissenschaftlichen Disziplinen auf einer gemeinsamen logischen und empirischen Basis zu vereinigen.
- Quote paper
- Dominik Bart (Author), 2019, Die wissenschaftliche Weltauffassung des Wiener Kreises und daraus resultierende Kritik an der Metaphysik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/497532