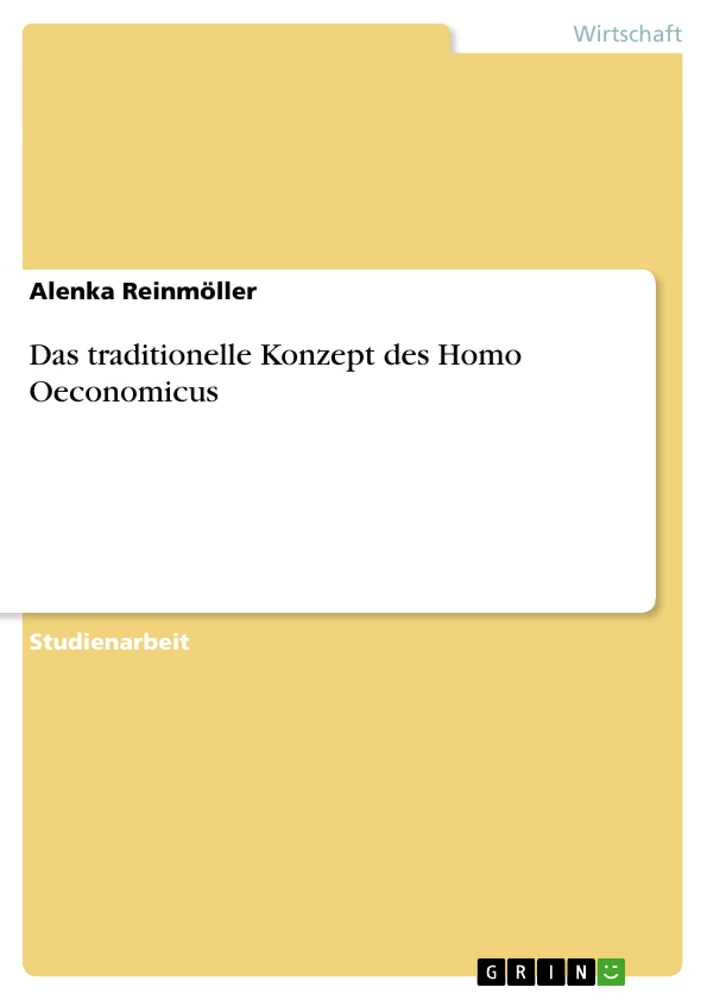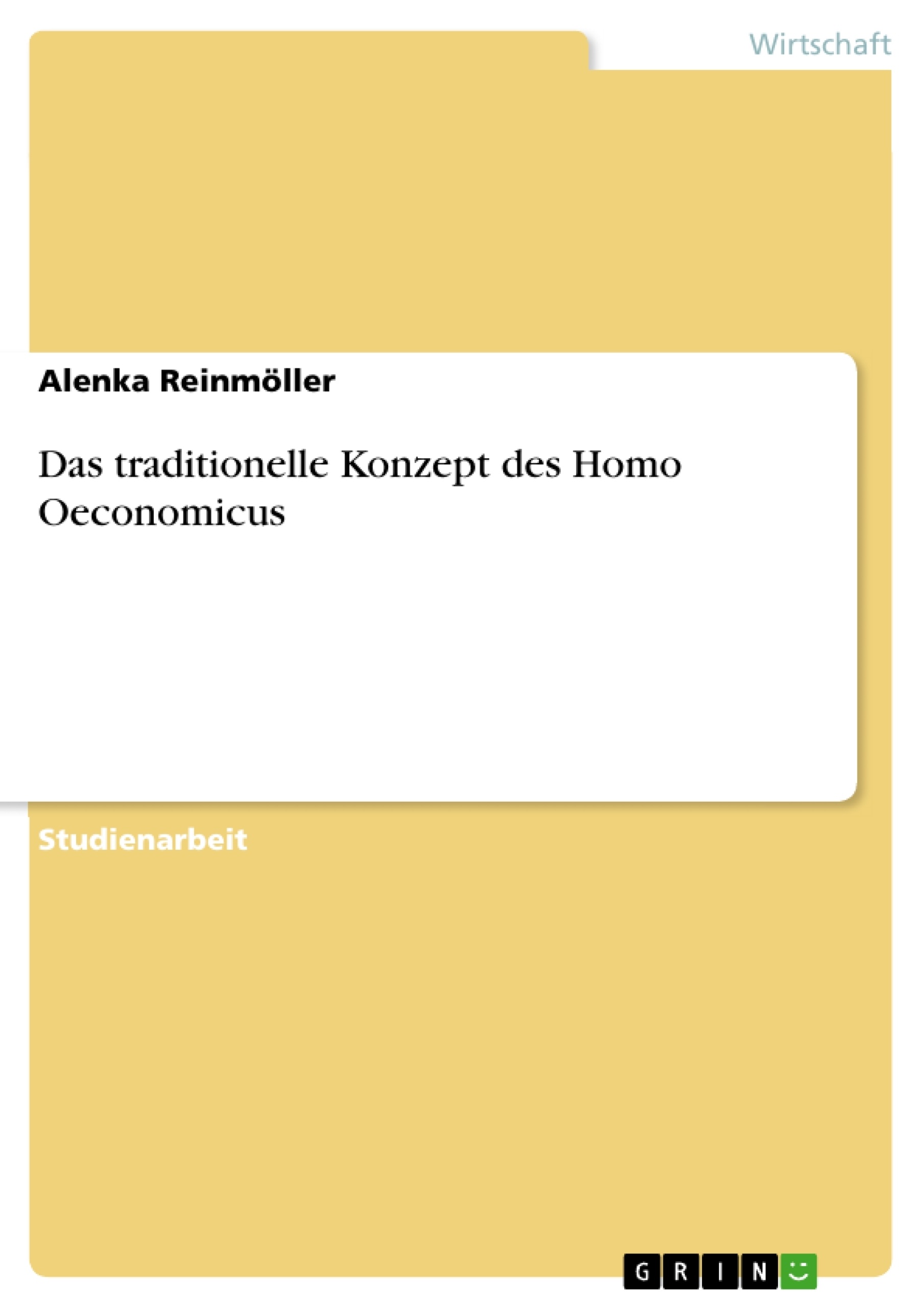In der Wirtschaftswissenschaft (insbesondere in der Neoklassik) wird ein Modell, das als Homo Oeconomicus bzw. economic man bezeichnet wird verwendet, um beobachtetes Verhalten zu erklären oder zukünftiges Verhalten prognostizieren zu können.
Die genaue Geburtsstunde des Homo Oeconomicus lässt sich nicht genau ermitteln. Bereits Adam Smith hat die Grundlage für dieses Verhaltensmodell gelegt, dass sich im Zuge der Entwicklung der Wirtschaftstheorie weiter verändert hat. Während Adam Smith davon ausging, dass der Mensch nicht nur an Eigennutz, sondern auch an sozialer Anerkennung interessiert ist, sind die Zielsetzungen des Homo Oeconomicus der Neoklassik auf egoistische Ziele reduziert.
Das Modell des Homo Oeconomicus ist allerdings umstritten. Es wird bezweifelt, ob es für die Verwendung im Rahmen einer empirischen Wissenschaft überhaupt geeignet ist. Es wird sogar angenommen, dass bei Verwendung des Modells die Nachhaltigkeit des Wirtschaftsprozesses gefährdet wird.
Um die Konzeption des Homo Oeconomicus zu verstehen ist es sinnvoll, die Entstehungsgeschichte des Homo Oeconomicus zu betrachten und einzelne Charaktereigenschaften zu analysieren.
Die vorliegende Seminararbeit beginnt mit einer Definition des Homo Oeconomicus. Im dritten Abschnitt erfolgt die Betrachtung der geschichtlichen Entwicklung des Begriffes des wirtschaftenden Menschen. Diese Betrachtung bleibt auf die Klassik bzw. Neoklassik beschränkt, da im Rahmen dieser Arbeit das traditionelle Konzept des Homo Oeconomicus vorgestellt wird.
Im vierten Abschnitt, auf dem der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt, werden die charakteristischen Merkmale des Homo Oeconomicus und die Anforderungen an das Präferenzsystem der Wirtschaftssubjekte kritisch betrachtet. Im letzten Teil erfolgt ein kurzer Ausblick auf realitätsnähere Merkmale eines wirtschaftenden Menschen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.1 Gang der Untersuchung
- 2. Der Homo Oeconomicus als idealtypisches Konstrukt
- 3. Der Homo Oeconomicus im geschichtlichen Blick
- 3.1 Allgemeines
- 3.2 Der Homo Oeconomicus in der klassischen Nationalökonomie
- 3.2.1 Adam Smith
- 3.2.2 David Ricardo
- 3.2.3 John Stuart Mill
- 3.3 Der Homo Oeconomicus in der Neoklassik
- 4. Kritische Darstellung der Charakteristika des Homo Oeconomicus
- 4.1 Rationalität
- 4.2 Eigennutz
- 4.3 Vollkommene Information
- 4.4 Anforderung an die Nutzenmaximierer
- 4.4.1 Allgemeines
- 4.4.2 Axiome
- 5. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das traditionelle Konzept des Homo Oeconomicus, ein zentrales Modell in der Wirtschaftswissenschaft. Ziel ist es, die Entstehung, die charakteristischen Merkmale und die Kritikpunkte dieses Modells zu beleuchten. Der Fokus liegt dabei auf der historischen Entwicklung und der kritischen Analyse der zugrundeliegenden Annahmen.
- Historische Entwicklung des Homo Oeconomicus-Konzepts
- Charakteristische Merkmale des Homo Oeconomicus (Rationalität, Eigennutz, vollständige Information)
- Kritik an den Annahmen des Homo Oeconomicus-Modells
- Relevanz des Homo Oeconomicus für die Wirtschaftswissenschaft
- Ausblick auf realitätsnähere Modelle des wirtschaftlichen Verhaltens
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt das Modell des Homo Oeconomicus als grundlegendes Verhaltensmodell der Wirtschaftswissenschaften vor und skizziert die Problemstellung. Es wird die Frage nach der Eignung des Modells für empirische Wissenschaft aufgeworfen und die Nachhaltigkeit des Wirtschaftsprozesses in Bezug auf das Modell hinterfragt. Die Arbeit wird methodisch strukturiert und der Gang der Untersuchung dargelegt.
2. Der Homo Oeconomicus als idealtypisches Konstrukt: (Kapitelbeschreibung fehlt im Ausgangstext. Eine Zusammenfassung muss auf Basis zusätzlicher Informationen erstellt werden.)
3. Der Homo Oeconomicus im geschichtlichen Blick: Dieses Kapitel untersucht die historische Entwicklung des Homo Oeconomicus-Konzepts, fokussiert auf die klassische Nationalökonomie (Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill) und die Neoklassik. Es werden die unterschiedlichen Auffassungen und Entwicklungen des Modells im Laufe der Zeit dargestellt, von Smiths Berücksichtigung sozialer Aspekte bis hin zur Reduktion auf egoistische Ziele in der Neoklassik.
4. Kritische Darstellung der Charakteristika des Homo Oeconomicus: Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der kritischen Betrachtung der charakteristischen Merkmale des Homo Oeconomicus: Rationalität, Eigennutz und vollkommene Information. Die Anforderung an das Nutzenmaximierungsprinzip und die zugrundeliegenden Axiome werden analysiert und kritisch hinterfragt, um die Grenzen des Modells aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Homo Oeconomicus, Wirtschaftswissenschaft, Neoklassik, Rationalität, Eigennutz, vollkommene Information, Nutzenmaximierung, klassische Nationalökonomie, Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, Modellkritik, empirische Wissenschaft, Nachhaltigkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema "Homo Oeconomicus"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit befasst sich umfassend mit dem traditionellen Konzept des Homo Oeconomicus, einem zentralen Modell der Wirtschaftswissenschaft. Sie untersucht dessen Entstehung, charakteristische Merkmale und Kritikpunkte, mit einem Fokus auf die historische Entwicklung und eine kritische Analyse der zugrundeliegenden Annahmen.
Welche Aspekte des Homo Oeconomicus werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung des Homo-Oeconomicus-Konzepts, beginnend bei der klassischen Nationalökonomie (Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill) bis hin zur Neoklassik. Im Mittelpunkt stehen die charakteristischen Merkmale des Modells: Rationalität, Eigennutz und vollständige Information. Die Arbeit analysiert kritisch die Annahmen des Modells, insbesondere das Nutzenmaximierungsprinzip und die zugrundeliegenden Axiome, um die Grenzen des Modells aufzuzeigen. Die Relevanz des Homo Oeconomicus für die Wirtschaftswissenschaft und der Ausblick auf realitätsnähere Modelle werden ebenfalls diskutiert.
Welche Wissenschaftler werden im Zusammenhang mit dem Homo Oeconomicus genannt?
Die Arbeit erwähnt Adam Smith, David Ricardo und John Stuart Mill im Kontext der klassischen Nationalökonomie. Ihre jeweiligen Beiträge zur Entwicklung des Homo-Oeconomicus-Konzepts werden untersucht und verglichen.
Welche Kritikpunkte am Homo-Oeconomicus-Modell werden angesprochen?
Die Arbeit kritisiert die Annahmen des Modells hinsichtlich Rationalität, Eigennutz und vollständiger Information. Die Grenzen des Nutzenmaximierungsprinzips und der zugrundeliegenden Axiome werden detailliert analysiert und hinterfragt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, die die Problemstellung und den Gang der Untersuchung darlegt. Es folgt ein Kapitel zum Homo Oeconomicus als idealtypisches Konstrukt (genaue Beschreibung fehlt im Ausgangstext). Ein weiteres Kapitel behandelt die historische Entwicklung des Konzepts, gefolgt von einer kritischen Darstellung der Charakteristika des Homo Oeconomicus. Die Arbeit schließt mit einem Ausblick ab.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Arbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Homo Oeconomicus, Wirtschaftswissenschaft, Neoklassik, Rationalität, Eigennutz, vollkommene Information, Nutzenmaximierung, klassische Nationalökonomie, Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, Modellkritik, empirische Wissenschaft und Nachhaltigkeit.
Wo finde ich eine detaillierte Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Der bereitgestellte Text enthält Zusammenfassungen für die Einleitung, das Kapitel zur historischen Entwicklung und das Kapitel zur kritischen Darstellung der Charakteristika des Homo Oeconomicus. Für das Kapitel "Der Homo Oeconomicus als idealtypisches Konstrukt" fehlt im Ausgangstext eine Zusammenfassung.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum gedacht, das sich mit wirtschaftswissenschaftlichen Modellen und insbesondere dem Homo-Oeconomicus-Konzept auseinandersetzen möchte. Die Zielgruppe umfasst Studierende und Wissenschaftler im Bereich der Wirtschaftswissenschaften.
- Citar trabajo
- Alenka Reinmöller (Autor), 2001, Das traditionelle Konzept des Homo Oeconomicus, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/4975