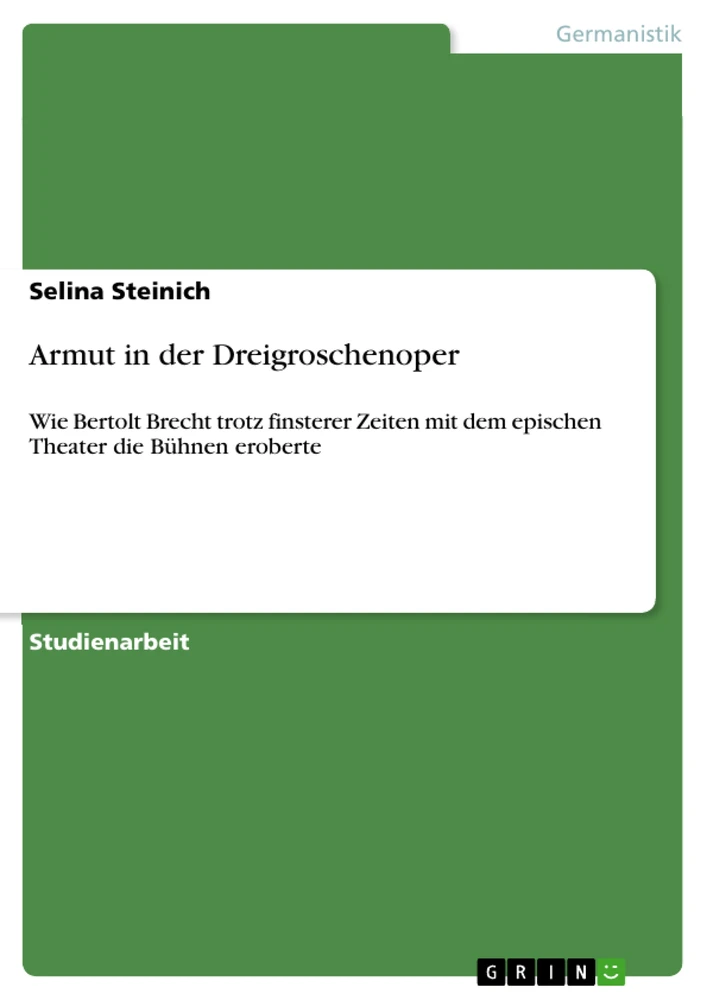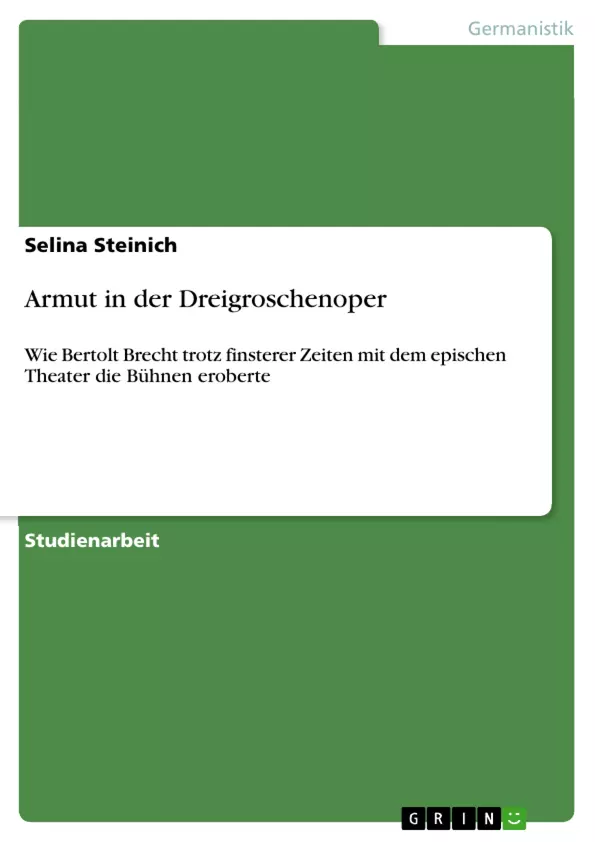In dieser Arbeit wird zunächst eine genauere Begriffsbestimmung von Armut vorgenommen, bevor auf die sozialen Verhältnisse zur Zeit von Bertolt Brecht eingegangen wird. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Dreigroschenoper und der Rolle, die Armut in diesem Werk spielt.
Die Armut in der Gesellschaft: Ein Phänomen, das grundlegend in jeder Gesellschaft vorkommt. Sie ist immer da und bereits seit der Antike der Leitbegriff für die Symbolik und Praxis solidarischer Verfahren. Konkret bedeutet die Zentralisierung des Begriffs "Armut", dass der Umgang mit Armut in einer Gesellschaft Auskunft über deren Selbstverständnis gibt.
Inklusion und Exklusion spielen hierbei eine wichtige Rolle, da die Armut hierdurch als Grenzsituation sozialer, politischer und religiöser Zugehörigkeit aufgefasst werden kann. Zunächst muss der Begriff der Armut genauer untersucht und bestimmt werden, um damit arbeiten zu können.
Naheliegend ist die Definition, Armut als "Mangel an lebenswichtigen Gütern" zu sehen. Diese Bezeichnung drückt eine Bedürftigkeit aus, welche jedoch stets von der gesellschaftlichen Wahrnehmung abhängig ist. Demnach kann eine eindeutige
Begriffsbestimmung nicht festgehalten werden. Schließlich ist das Verhältnis von Bedürftigkeit und Wahrnehmung dieser kontextabhängig.
Weiter kann ein Mangel an lebenswichtigen Gütern auf verschiedene Weisen gedeutet werden. Ein Mangel kann an unterschiedlichen Situationen und Umgebungen festgemacht werden. So wird zwischen absoluter und relativer Armut differenziert, wobei einerseits das physische Existenzminimum gemeint ist, während bei relativer Armut die deutliche Abweichung nach unten vom Durchschnitt Fokus trägt.
Genauso bestehen hier jegliche Interpretationsmöglichkeiten. Selbst beim Begriff von "lebenswichtigen" Gütern kann nicht von einer allgemeingültigen Deutung gesprochen werden. Um sämtlichen verschiedenen Deutungen vorzubeugen, wird in der heutigen Zeit Armut eher als "Zustand eines Mangels an materiellen, kulturellen und sozialen Mitteln, die zur Sicherstellung sozialer Gerechtigkeit nötig sind" bezeichnet.
Inhaltsverzeichnis
- Armut
- Begriffsbestimmung
- Die sozialen Verhältnisse zu der Zeit von Bertolt Brecht
- Die Dreigroschenoper
- Das Werk und der Autor
- Kurzanalyse
- Bertolt Brecht
- Thematisierung der Armut
- Armut im Stück
- Das epische Theater und dessen Rezeption
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht die Thematik der Armut in Bertolt Brechts "Dreigroschenoper" und analysiert, wie Brecht mit dem epischen Theater die Bühnen trotz finsterer Zeiten eroberte.
- Definition und historische Entwicklung des Armutskonzepts
- Soziale Verhältnisse in der Zeit Brechts und deren Einfluss auf sein Werk
- Analyse der Darstellung von Armut in der "Dreigroschenoper"
- Die Funktion des epischen Theaters in der "Dreigroschenoper"
- Brechts Einfluss auf das Theater und die Rezeption seines Werkes
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Definition von Armut und untersucht die Entwicklung des Begriffs von der Antike bis in die Moderne. Es werden verschiedene Perspektiven auf Armut beleuchtet, sowohl aus sozialer als auch aus politischer Sicht.
Das zweite Kapitel widmet sich den sozialen Verhältnissen in der Zeit Bertolt Brechts. Es werden wichtige Ereignisse wie der Erste Weltkrieg, die Weimarer Republik und der Aufstieg des Nationalsozialismus beleuchtet und deren Einfluss auf die gesellschaftliche Situation dargestellt.
Das dritte Kapitel analysiert die "Dreigroschenoper" als Werk und beleuchtet die zentrale Thematik der Armut im Stück. Darüber hinaus wird Brechts Stil des epischen Theaters und dessen Rezeption näher untersucht.
Schlüsselwörter
Armut, Bertolt Brecht, Dreigroschenoper, episches Theater, soziale Verhältnisse, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, Existenzminimum, Inklusion, Exklusion, Stigmatisierung.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Armut in der „Dreigroschenoper“ dargestellt?
Armut wird nicht nur als materieller Mangel, sondern als gesellschaftlicher Zustand gezeigt, der Menschen zu Kriminalität und moralischen Kompromissen zwingt („Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral“).
Was ist der Unterschied zwischen absoluter und relativer Armut?
Absolute Armut bedeutet das Fehlen lebensnotwendiger Güter zum physischen Überleben. Relative Armut beschreibt einen Mangel im Vergleich zum gesellschaftlichen Durchschnitt.
Welche Rolle spielt das „epische Theater“ bei diesem Thema?
Brecht nutzt Verfremdungseffekte, um die Zuschauer zur kritischen Reflexion über soziale Ungerechtigkeit anzuregen, anstatt sie nur emotional mitfühlen zu lassen.
Wer war Bertolt Brecht?
Ein bedeutender deutscher Dramatiker und Lyriker des 20. Jahrhunderts, der das epische Theater begründete und soziale Missstände in seinen Werken thematisierte.
Inwiefern war die Weimarer Republik prägend für das Stück?
Die wirtschaftliche Instabilität, Arbeitslosigkeit und die soziale Spaltung der 1920er Jahre bildeten den realen Hintergrund für die Themen Kriminalität und Armut in der Oper.
- Citar trabajo
- Selina Steinich (Autor), 2019, Armut in der Dreigroschenoper, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/497609