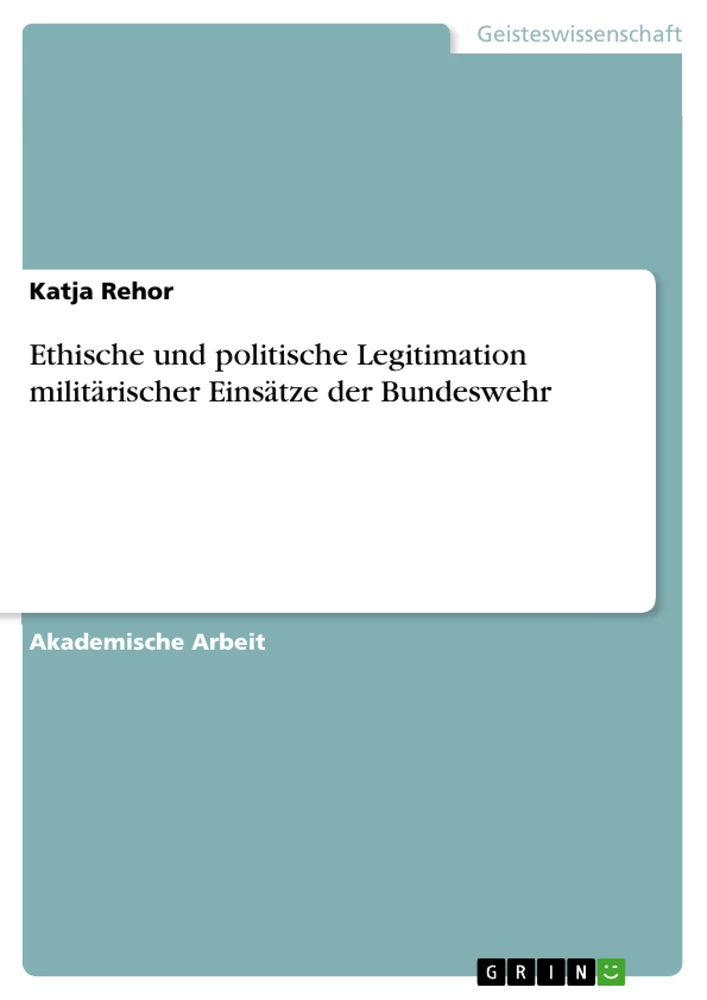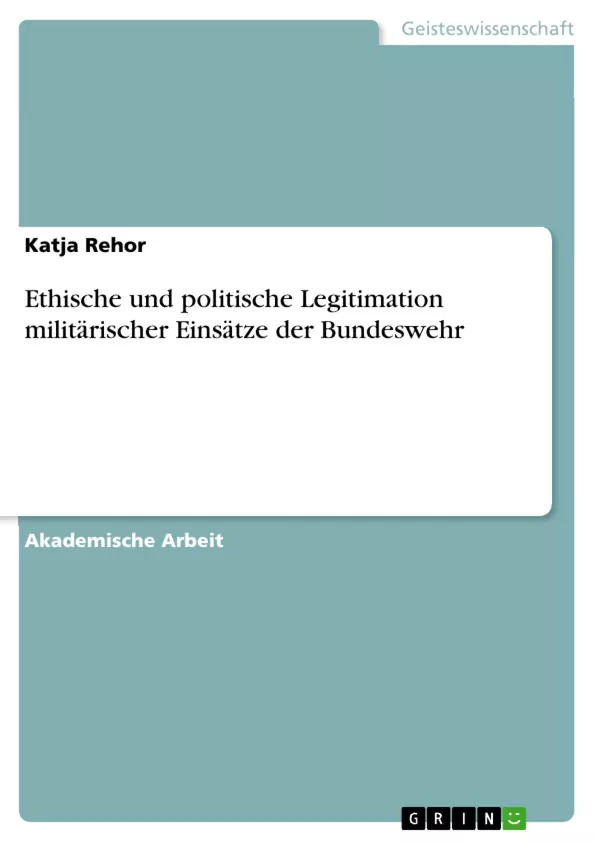Die Bundeswehr ist, als Teil der Exekutive der Bundesrepublik Deutschland, heutzutage für die breite Masse der Bürger ein selbstverständlicher Teil des politischen Systems in Deutschland. Dies bestätigte eine Bevölkerungsbefragung des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr aus dem Jahr 2013 mit einer Zustimmung von 86% der Befragten. Die Verteidigung und Sicherheit Deutschlands werden scheinbar unmittelbar mit der Bundeswehr verbunden, demzufolge sie einem großen Teil der Bevölkerung wichtig ist.
Als Armee hat die Bundeswehr die Aufgabe, Deutschland auch außerhalb der Landesgrenzen zu verteidigen und zu sichern. Sie soll Deutschland verhelfen, sich souverän in der internationalen Staatengemeinschaft zu behaupten. Doch die Auslandseinsätze der Bundeswehr lassen die Frage aufkommen, ob tatsächlich nur Sicherheits- und Verteidigungszwecke verfolgt werden. Laut des Verteidigungsministeriums ist „Deutschland [...] bereit, sich früh, entschieden und substanziell als Impulsgeber in die internationale Debatte einzubringen, Verantwortung zu leben und Führung zu übernehmen.“ Die Bundeswehr soll diesen Kurs der internationalen Verantwortung unterstützen. Doch aus welchem Zweck erwächst diese Bereitschaft und inwiefern spiegeln sich die Werte der Bundesrepublik Deutschland tatsächlich in der Arbeit der Bundeswehr wieder?
Diese besondere Lernleistung soll die Legitimation der Militäreinsätze der Bundeswehr analysieren. Dafür soll die Betrachtung vorgenommen werden, welche Funktionen Armeen innerhalb des Staates innehaben bzw. innehatten. Dafür wird ebenfalls die Geschichte der Bundeswehr kurz umrissen, um deren politische Zweckmäßigkeit festzustellen. Auch verschiedene politische und philosophische Theorien, welche sich mit der Legitimation von militärischen Einsätzen befassen, werden dargelegt, sowie die Frage geklärt, welchen Gesetzlichkeiten militärische Einsätze der Bundeswehr unterliegen. Zuletzt sollen einige allgemeine Werte festgelegt werden, welche bei einer Betrachtung der Legitimation militärischer Einsätze beachtet werden müssen. Ziel dieser besonderen Lernleistung ist nicht, eine grundsätzliche Antwort auf die
Frage zu geben, ob die Bundeswehr Militäreinsätze durchführen darf, sondern die unterschiedlichen Ansätze darzulegen.
Um dieses Ziel zu erreichen, wurde ausführlich Fachliteratur zu dieser Thematik verwendet. Diese besondere Lernleistung hat einen gänzlich theoretischen Charakter.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Militärentwicklung in Europa ab der Frühen Neuzeit
- 2.1 Das Militär als Bestandteil der europäischen Staaten der Frühen Neuzeit
- 2.2 Das Militär als Bestandteil der europäischen Staaten des 18. und 19. Jahrhunderts
- 2.3 Die Entwicklung des deutschen Militärs und des sicherheitspolitischen Umfelds im 20./21. Jahrhundert
- 3 Geschichtlicher Umriss der Bundeswehr
- 3.1 Vorgeschichte und Gründung
- 3.3 Die Bundeswehr zwischen 1960 und 1990
- 3.4 Wiedervereinigung Deutschlands 1990
- 3.4 Heutige Stellung
- 4 Grundsätze deutscher Sicherheitspolitik
- 4.1 Deutschlands Rolle in der Welt
- 4.1.1 Deutschland innerhalb der Vereinten Nationen
- 4.1.2 Deutschland innerhalb der Nordatlantischen Allianz
- 4.1.3 Deutschland innerhalb der Europäischen Union
- 4.2 Sicherheitspolitische Interessen Deutschlands
- 4.3 Mandatierung von Einsätzen durch den Bundestag
- 4.1 Deutschlands Rolle in der Welt
- 5 Die Bundeswehr als Instrument deutscher Sicherheitspolitik
- 5.1 Rolle der Bundeswehr
- 5.2 Werte der Bundeswehr
- 5.3 Organisationsprinzipien der Bundeswehr
- 6 Legitimation von Militär
- 6.1 Gewalt als Mittel zur Konfliktlösung zwischen Staaten
- 6.1.1 Legitimation staatlicher Gewaltanwendung
- 6.1.2 Politische Motive von Kriegen
- 6.1.3 Ökonomische Motive von Kriegen
- 6.2 Perspektiven zur Legitimierbarkeit militärischer Einsätze
- 6.2.1 Die Theorie des gerechten Krieges nach Michael Walzer
- 6.2.2 Der Realismus nach Hans Morgenthau
- 6.2.3 Der radikale Pazifismus des „Satyagraha“ und der politische Pazifismus
- 6.2.4 Die Grundlagen des Völkerrechts durch Hugo Grotius und Immanuel Kant und dessen moderne Auslegung
- 6.1 Gewalt als Mittel zur Konfliktlösung zwischen Staaten
- 7 Gesetzliche Regelung von Militäreinsätzen
- 7.1 Kriegsvölkerrecht (humanitäres Völkerrecht)
- 7.2 Charta der Vereinten Nationen
- 7.3 Nordatlantikvertrag
- 7.4 Gesetzliche Regelungen des Grundgesetzes
- 8 Bewertung der Legitimation
- 8.1 Umsetzung deutscher Werte und Interessen
- 8.2 Möglichkeit zur Friedenssicherung und Konfliktlösung nach ethischen Prinzipien durch Militäreinsätze
- 8.3 Rechtfertigungsgründe und -bedingungen eines Gewalteinsatzes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die ethische und politische Legitimation militärischer Einsätze der Bundeswehr. Ziel ist es, verschiedene Ansätze zur Legitimation darzulegen, ohne eine abschließende Bewertung vorzunehmen. Die Arbeit basiert auf einer theoretischen Betrachtung und nutzt ausführlich Fachliteratur.
- Historische Entwicklung des Militärs in Europa und seine Rolle im Staat
- Die Geschichte und Rolle der Bundeswehr in der deutschen Sicherheitspolitik
- Theoretische Perspektiven zur Legitimation militärischer Gewalt (gerechter Krieg, Realismus, Pazifismus)
- Rechtliche Grundlagen für Militäreinsätze der Bundeswehr
- Ethische und politische Bewertungskriterien für Militäreinsätze
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz der Thematik heraus, indem sie auf die breite Akzeptanz der Bundeswehr in der Bevölkerung verweist und gleichzeitig die Frage nach der tatsächlichen Legitimation von Auslandseinsätzen aufwirft. Die Arbeit skizziert ihren methodischen Ansatz: die Analyse der Funktionen von Armeen, der Geschichte der Bundeswehr, relevanter politischer und philosophischer Theorien sowie der rechtlichen Rahmenbedingungen für Militäreinsätze. Das erklärte Ziel ist nicht eine definitive Antwort auf die Zulässigkeit von Militäreinsätzen, sondern die Darstellung unterschiedlicher Perspektiven.
2 Militärentwicklung in Europa ab der Frühen Neuzeit: Dieses Kapitel verfolgt die Entwicklung des Militärs in Europa von der Frühen Neuzeit bis in die Gegenwart. Es zeigt, wie sich das Militär im Laufe der Geschichte vom Bestandteil feudaler Strukturen zu einem integralen Bestandteil moderner Nationalstaaten entwickelte. Die Kapitel unterstreichen die enge Verbindung zwischen staatlicher Macht und militärischer Stärke und wie sich die Kriegsführung und die Begründungen für Krieg im Laufe der Zeit veränderten, von persönlichen Motiven hin zu rationalen, staatlich motivierten Zielen.
Schlüsselwörter
Bundeswehr, Militäreinsätze, Legitimation, Sicherheitspolitik, Gewalt, gerechter Krieg, Realismus, Pazifismus, Völkerrecht, Grundgesetz, ethische Prinzipien, Friedenssicherung, Konfliktlösung.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Ethische und Politische Legitimation Militärischer Einsätze der Bundeswehr
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die ethische und politische Legitimation militärischer Einsätze der Bundeswehr. Sie untersucht verschiedene Ansätze zur Legitimation, ohne jedoch eine abschließende Bewertung vorzunehmen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung des Militärs in Europa, die Geschichte und Rolle der Bundeswehr in der deutschen Sicherheitspolitik, theoretische Perspektiven zur Legitimation militärischer Gewalt (gerechter Krieg, Realismus, Pazifismus), die rechtlichen Grundlagen für Militäreinsätze der Bundeswehr und ethische sowie politische Bewertungskriterien für Militäreinsätze.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit basiert auf einer theoretischen Betrachtung und nutzt ausführlich Fachliteratur. Sie analysiert die Funktionen von Armeen, die Geschichte der Bundeswehr, relevante politische und philosophische Theorien sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen für Militäreinsätze.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, verschiedene Ansätze zur Legitimation militärischer Einsätze darzulegen. Es geht nicht um eine definitive Antwort auf die Zulässigkeit von Militäreinsätzen, sondern um die Darstellung unterschiedlicher Perspektiven.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in acht Kapitel: Einleitung, Militärentwicklung in Europa, Geschichtlicher Umriss der Bundeswehr, Grundsätze deutscher Sicherheitspolitik, Die Bundeswehr als Instrument deutscher Sicherheitspolitik, Legitimation von Militär, Gesetzliche Regelung von Militäreinsätzen und Bewertung der Legitimation. Jedes Kapitel wird durch Unterkapitel weiter detailliert.
Welche historischen Aspekte werden beleuchtet?
Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung des Militärs in Europa von der Frühen Neuzeit bis in die Gegenwart, fokussiert auf die Entwicklung des deutschen Militärs und die Geschichte der Bundeswehr von der Gründung bis zur heutigen Stellung.
Welche theoretischen Perspektiven werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet verschiedene theoretische Perspektiven zur Legitimation militärischer Gewalt, darunter die Theorie des gerechten Krieges nach Michael Walzer, den Realismus nach Hans Morgenthau, den radikalen und politischen Pazifismus und die Grundlagen des Völkerrechts nach Hugo Grotius und Immanuel Kant.
Welche rechtlichen Grundlagen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das Kriegsvölkerrecht (humanitäres Völkerrecht), die Charta der Vereinten Nationen, den Nordatlantikvertrag und die gesetzlichen Regelungen des Grundgesetzes im Bezug auf Militäreinsätze.
Wie werden ethische und politische Bewertungskriterien berücksichtigt?
Die Arbeit untersucht die Umsetzung deutscher Werte und Interessen im Kontext militärischer Einsätze, die Möglichkeit zur Friedenssicherung und Konfliktlösung nach ethischen Prinzipien und die Rechtfertigungsgründe und -bedingungen eines Gewalteinsatzes.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bundeswehr, Militäreinsätze, Legitimation, Sicherheitspolitik, Gewalt, gerechter Krieg, Realismus, Pazifismus, Völkerrecht, Grundgesetz, ethische Prinzipien, Friedenssicherung, Konfliktlösung.
- Citation du texte
- Katja Rehor (Auteur), 2019, Ethische und politische Legitimation militärischer Einsätze der Bundeswehr, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/497700