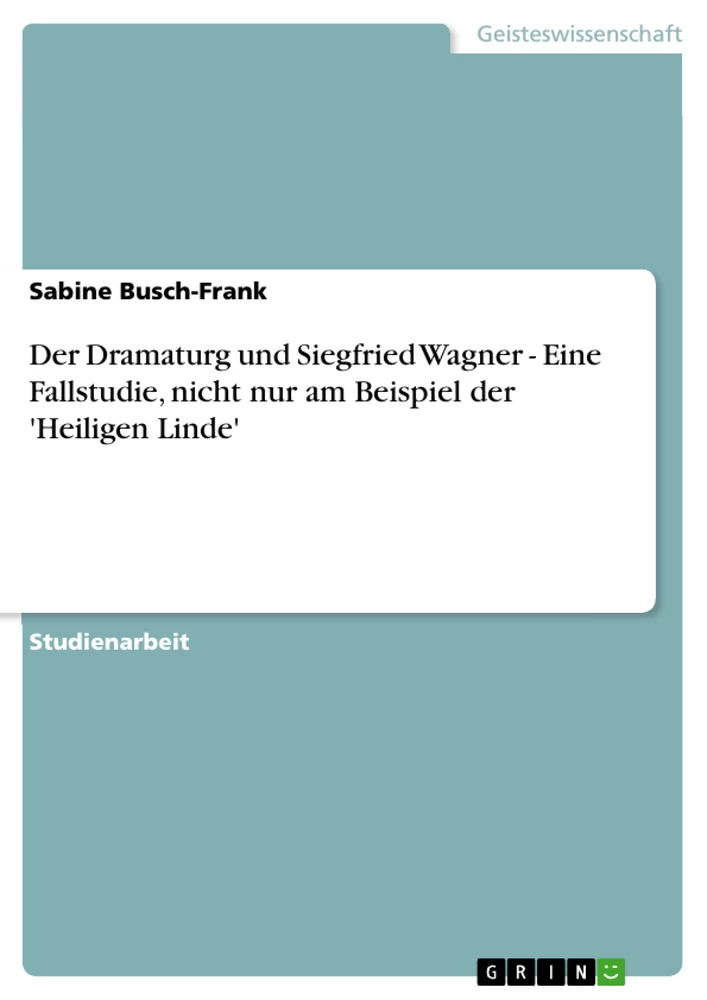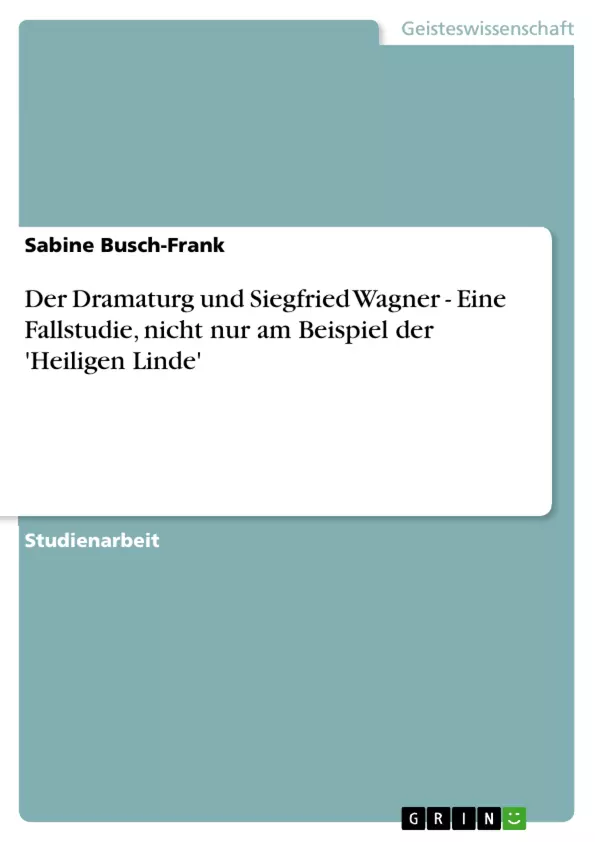Zum 125. Geburtstag des Erben von Bayreuth richtete ihm das Richard-Wagner-Museum im Haus Wahnfried eine Ausstellung unter dem Titel „Das Theater Siegfried Wagners“ aus. Doch der Titel führte in die Irre – behandelt wurde ausschließlich sein Wirken als Festspielleiter, das eigene Opernschaffen wurde bis auf Marginalien ausgegrenzt. Im Ausstellungsheft ist dazu zu lesen:
„Siegfried Wagners eigenes kompositorisches Schaffen, das unter anderem immerhin 15 vollendete Opern (!) umfasst, konnte in der Ausstellung nicht berücksichtigt werden. Es ist ein Thema für sich, das es nicht verdient, gleichsam als Appendix zu seinem Bayreuther Bühnenschaffen abgehandelt zu werden.“1
Auch anderweitig ist es schwierig, sich über das Opernschaffen Siegfried Wagners zu informieren – nehmen wir an, einem Dramaturgen würde eines von Siegfried Wagners Opernwerken zur Beurteilung vorgelegt werden, so kann dieser wohl im Normalfall kaum auf die nur schwer erreichbare Sekundärliteratur zurückgreifen.
1 Friedrich, Sven „Das Theater Siegfried Wagners. Eine Ausstellung des Richard-Wagner- Museums im Haus Wahnfried zu Siegfried Wagners 125. Geburtstag“, Bayreuth o. J. (1994), S. 3-4.
[…]
Inhaltsverzeichnis
- Der Dramaturg und Siegfried Wagner
- Die Dramaturgische Einordnung
- Das Libretto
- Die Sprache des Librettisten
- Die Figuren
- Der dramatische Aufbau
- Die Heiligen Linde
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit widmet sich der Analyse des Opernschaffens Siegfried Wagners, wobei sie sich insbesondere auf das Beispiel der Oper „Die Heilige Linde“ fokussiert. Die Arbeit verfolgt das Ziel, Siegfried Wagners Opernschaffen in seiner dramaturgischen Vielseitigkeit aufzuzeigen und seine Einordnung in die Operngeschichte neu zu beleuchten. Es werden die sprachlichen Besonderheiten seiner Libretti, die Charakterisierung seiner Figuren sowie der dramatische Aufbau seiner Werke analysiert.
- Dramaturgische Einordnung des Opernschaffens Siegfried Wagners
- Analyse der Libretti und der sprachlichen Eigenheiten
- Charakterisierung der Figuren und ihrer Namensgebung
- Der dramatische Aufbau der Opern Siegfried Wagners
- Die Oper „Die Heilige Linde“ als Fallbeispiel
Zusammenfassung der Kapitel
- Der erste Teil der Arbeit befasst sich mit der Einordnung des Opernschaffens Siegfried Wagners in die Operngeschichte. Es wird diskutiert, ob seine Werke als „Märchenopern“ bezeichnet werden können und welche dramaturgischen Kategorien sie am besten widerspiegeln.
- Der zweite Teil der Arbeit analysiert die Libretti Siegfried Wagners und die Besonderheiten seiner Sprache. Es wird auf die Verwendung von Archaismen und die Gestaltung der Verse sowie den Einfluss der Musik auf die Sprache des Librettisten eingegangen.
- Der dritte Teil widmet sich der Charakterisierung der Figuren in den Opern Siegfried Wagners. Es werden die Namensgebungen analysiert und die Unterschiede zwischen den Figuren aus der realen Welt und den Figuren aus der übernatürlichen Sphäre herausgestellt.
- Im vierten Teil der Arbeit wird der dramatische Aufbau der Opern Siegfried Wagners untersucht. Es werden die Besonderheiten des architektonischen Einflusses auf die Struktur der Opern hervorgehoben und der Einfluss von Peter P. Pachl und Dieter Heinz auf die Analyse des dramatischen Aufbaus diskutiert.
- Der fünfte Teil der Arbeit widmet sich der Oper „Die Heilige Linde“ als Fallbeispiel. Es werden die historischen Elemente, die Sagen- und Märcheneinflüsse sowie die psychologische Facette der Oper analysiert.
Schlüsselwörter
Siegfried Wagner, Opernschaffen, Dramaturgie, Libretto, Sprache, Figuren, dramatischer Aufbau, Die Heilige Linde, Märchenopern, Architektur, Historische Elemente, Sagen, Märchen, Psychologie
Häufig gestellte Fragen
Wer war Siegfried Wagner im Kontext der Operngeschichte?
Siegfried Wagner war der Erbe von Bayreuth und Sohn von Richard Wagner. Neben seiner Rolle als Festspielleiter schuf er ein umfangreiches eigenes Opernwerk mit 15 vollendeten Opern, das jedoch oft im Schatten seines Vaters stand.
Was thematisiert die Oper „Die Heilige Linde“?
Die Oper dient als Fallbeispiel für Siegfried Wagners Schaffen und vereint historische Elemente, Sagen- und Märcheneinflüsse sowie psychologische Facetten.
Warum wird Siegfried Wagners Opernschaffen oft als „Appendix“ behandelt?
Oft wurde sein kompositorisches Werk zugunsten seiner Tätigkeit als Bayreuther Festspielleiter ausgegrenzt, was dazu führte, dass Sekundärliteratur zu seinen Opern schwer erreichbar ist.
Was sind die sprachlichen Besonderheiten seiner Libretti?
Siegfried Wagner nutzte in seinen Libretti häufig Archaismen, spezifische Versgestaltungen und ließ die Sprache stark durch die Musik beeinflussen.
Können seine Werke als Märchenopern klassifiziert werden?
Die Arbeit untersucht die dramaturgische Einordnung und diskutiert, inwieweit Kategorien wie „Märchenoper“ auf seine vielseitigen Werke zutreffen.
Welchen Einfluss hatte die Architektur auf seinen dramatischen Aufbau?
Die Analyse zeigt, dass architektonische Einflüsse eine Rolle bei der Strukturierung seiner Opern spielten, was in der Forschung von Experten wie Peter P. Pachl diskutiert wird.
- Quote paper
- Dr. Sabine Busch-Frank (Author), 2001, Der Dramaturg und Siegfried Wagner - Eine Fallstudie, nicht nur am Beispiel der 'Heiligen Linde', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49785