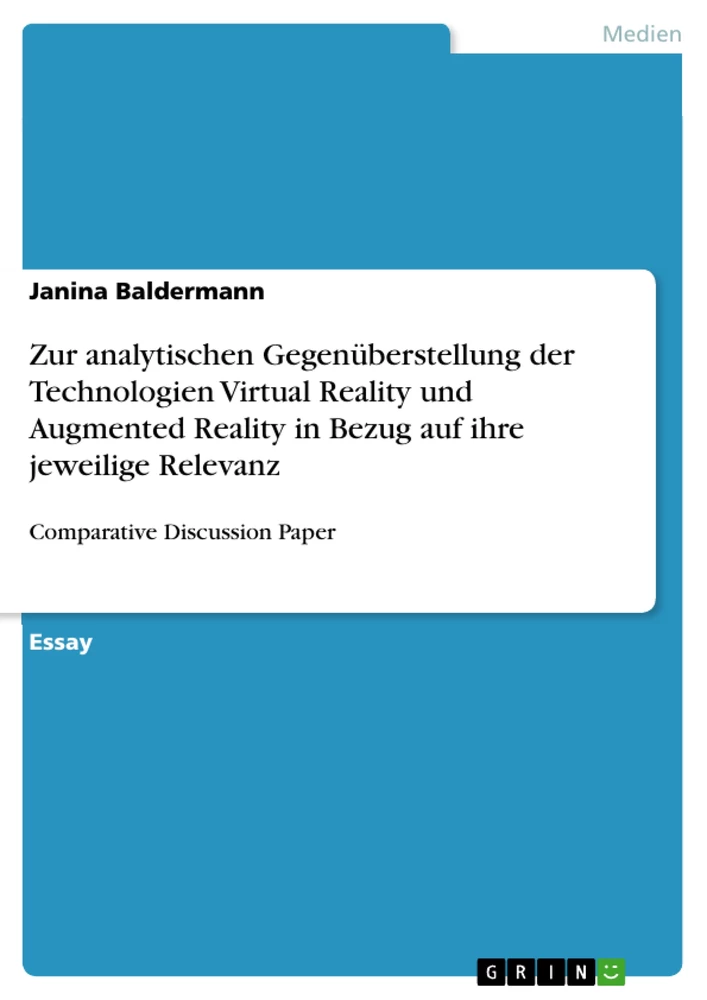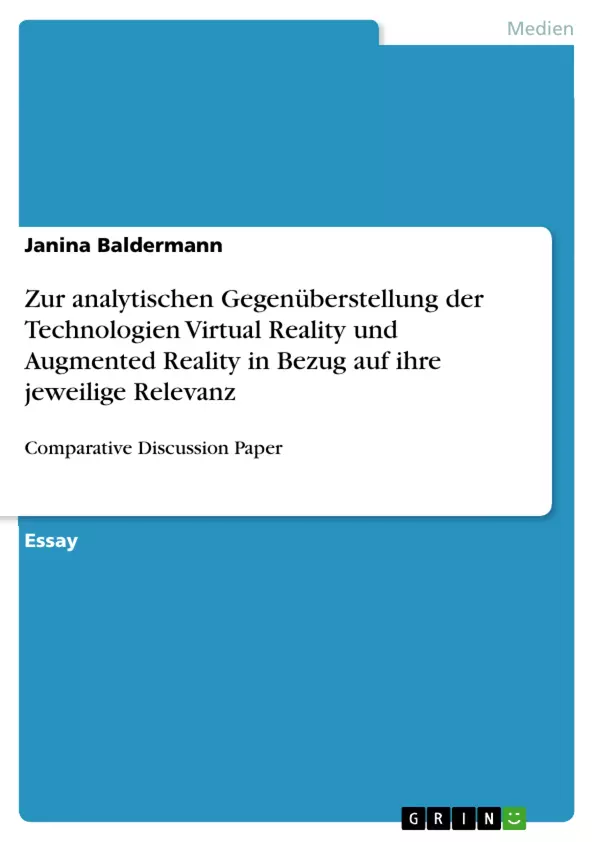Innerhalb dieser Arbeit wird erläutert, wie die Technologien VR und AR in ihren jeweiligen Anwendungsgebieten funktionieren und inwiefern sie dadurch den Menschen in seinem Schaffen beeinflussen. Dabei findet eine analytische Gegenüberstellung statt, welche sich lediglich auf die Einsatzmöglichkeiten von VR und AR begrenzen.
Schon vor über 2400 Jahren beschäftigte sich Platon mit der Frage „Was ist wahr und was ist unwahr?“. Mit seinem Höhlengleichnis untersuchte er die These, ob wir die Realität lediglich als Abbild oder als „Schatten“ sehen würden.
„Egal wie weit man zurückschaut, alle Menschen interessieren sich für die Sachen, die sie in ihren Träumen sehen und fragen sich wie es wäre, wenn man diese erleben könnte.“ (K. Perlin, 2015)
Mit diesem Wunsch erforschten die Menschen bereits in den neunziger Jahren zwei Technologien, die das Eintauchen in eine surreale Welt greifbar machen: Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionen
- Immersion
- Virtual Reality
- Augmented Reality
- Gegenüberstellung der Einsatzmöglichkeiten
- Fazit
- Zukunftsausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der analytischen Gegenüberstellung der Technologien Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) im Hinblick auf ihre jeweilige Relevanz. Sie untersucht die Definitionen und Einsatzmöglichkeiten beider Technologien und beleuchtet die jeweiligen Vor- und Nachteile.
- Definition und Abgrenzung von VR und AR
- Immersion als gemeinsamer Faktor
- Einsatzmöglichkeiten von VR und AR in verschiedenen Bereichen
- Potenziale und Herausforderungen beider Technologien
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der virtuellen und erweiterten Realität ein und skizziert die Relevanz dieser Technologien im Kontext des Höhlengleichnisses von Platon.
- Definitionen: Dieses Kapitel beleuchtet die zentralen Konzepte von Immersion, Virtual Reality und Augmented Reality und erläutert die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Technologien.
- Gegenüberstellung der Einsatzmöglichkeiten: Dieses Kapitel analysiert die Einsatzmöglichkeiten von VR und AR in verschiedenen Bereichen und vergleicht die Vor- und Nachteile jeder Technologie anhand von Beispielen.
Schlüsselwörter
Virtual Reality, Augmented Reality, Immersion, Reality-Virtuality-Continuum, Einsatzmöglichkeiten, Technologievergleich, Zukunftstrends.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptunterschied zwischen Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR)?
VR taucht den Nutzer komplett in eine computergenerierte Welt ein, während AR die reale Welt um digitale Elemente erweitert (überlagert).
Was bedeutet „Immersion“?
Immersion beschreibt den Effekt, bei dem ein Nutzer das Gefühl hat, physisch in eine künstliche Umgebung einzutauchen und die virtuelle Welt als real wahrzunehmen.
In welchen Bereichen wird VR bevorzugt eingesetzt?
VR findet häufig Anwendung in der Unterhaltung (Gaming), in Simulationen (Flugtraining) und in der Therapie (Behandlung von Phobien).
Welche Vorteile bietet AR für die Industrie?
AR unterstützt Techniker durch das Einblenden von Montageanleitungen im Sichtfeld, ermöglicht virtuelle Möbelplatzierungen im Handel und verbessert die Navigation.
Was ist das Reality-Virtuality-Continuum?
Es beschreibt die Skala zwischen der rein realen Umgebung und der rein virtuellen Realität, wobei AR und Mixed Reality die Zwischenstufen bilden.
- Quote paper
- Janina Baldermann (Author), 2018, Zur analytischen Gegenüberstellung der Technologien Virtual Reality und Augmented Reality in Bezug auf ihre jeweilige Relevanz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/498000