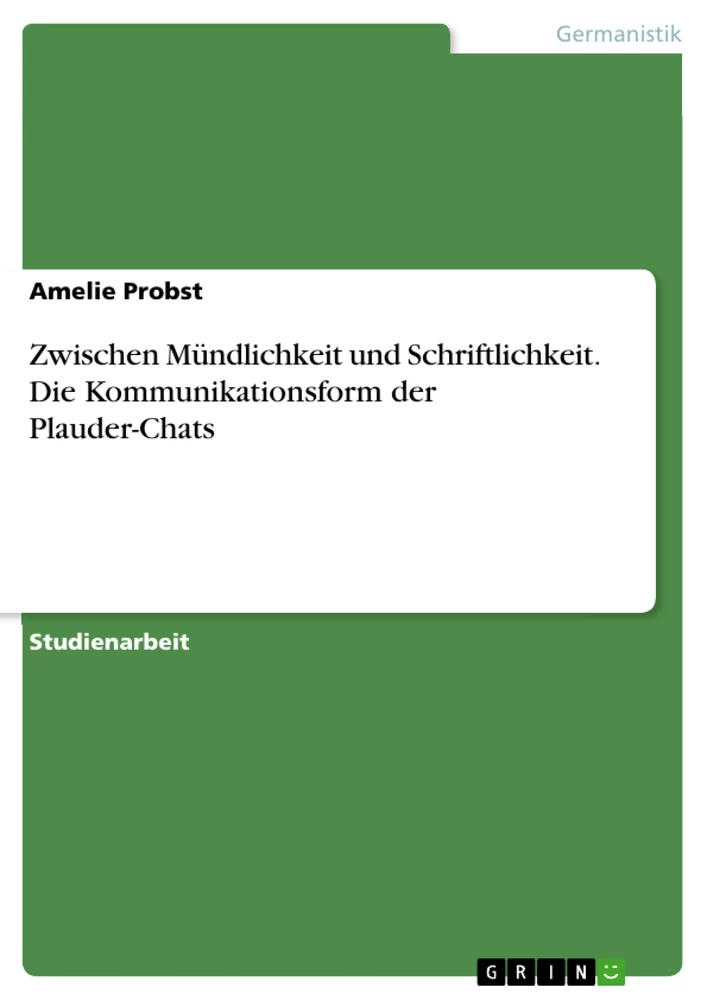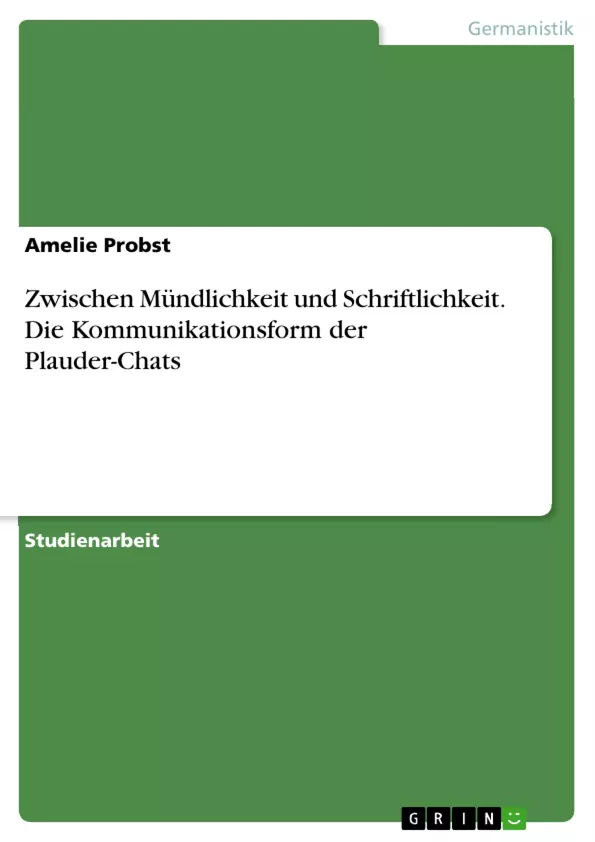Diese Arbeit befasst sich mit sogenannten Plauder-Chats. Aus Sicht der Kommunikationsgeschichte ist die Neuheit an Chats, dass die Schrift erstmals im großen Stil in Handlungsbereiche einzieht, die zuvor der mündlichen Kommunikation vorenthalten waren. Nach dem Nähe-Distanz-Modell ist die Kommunikationsform ‚Plauder-Chat‘ dem Nähepol im Bereich der medialen Schriftlichkeit zuzuordnen und enthält viele Aspekte der konzeptionellen Mündlichkeit. Auf dessen Grundlage beantwortet die Arbeit folgende Fragen: Welche Aspekte der konzeptionellen Mündlichkeit enthält der Plauder-Chat? Inwiefern orientiert sich die Kommunikationsform ‚Plauder-Chat‘ am Duktus der gesprochenen Sprache?
Tägliches E-Mail schreiben, online Zeitung lesen, chatten oder über Facebook Kontakte und Freundschaften pflegen gehört heute für die Menschen zum Alltag. Diese sogenannte ‚Online-Kommunikation‘ ist aus unserem Leben kaum noch wegzudenken. Dies ist jedoch noch nicht lange so. Erst nachdem das World Wide Web 1993 zur allgemeinen Nutzung für die Öffentlichkeit freigegeben wurde, kam es zu einem weltweiten Datenaustausch. Weblogs und Online-Communities wurden immer populärer und für diese neuen Entwicklungen entstand der Begriff des Web 2.0. Mit dem Web 2.0 wird eine neue Dimension von weltweiter Kommunikation und Interaktion im Netz durchgesetzt. Online-Kommunikation findet in einer Vielzahl verschiedener Formen und Anwendungsfelder statt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Internetbasierte Kommunikation im Spannungsfeld Mündlichkeit – Schriftlichkeit
- 2.1 Entwicklungen durch die Erfindung des Web 2.0
- 2.2 Interaktionsorientiertes vs. Textorientiertes Schreiben
- 2.3 Modell der medialen / konzeptionellen Mündlichkeit bzw. Schriftlichkeit
- 3. Die Kommunikationsform „Chat“
- 3.1 Bedeutung
- 3.2 Merkmale und Besonderheiten
- 3.3 Einordnung in das Nähe-Distanz-Modell
- 4. Aspekte konzeptioneller Mündlichkeit in Plauder-Chats
- 4.1 Korpuswahl
- 4.2 Analysekriterien
- 4.3 Analyse
- 4.3.1 Syntax
- 4.3.2 Morphologie
- 4.3.3 Phonetik
- 4.3.4 Semiotik
- 4.4 Auswertung und Interpretation der Ergebnisse
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht, inwiefern die Kommunikationsform „Plauder-Chat“ Aspekte konzeptioneller Mündlichkeit aufweist und sich am Duktus der gesprochenen Sprache orientiert. Sie analysiert dazu verschiedene Chat-Beispiele und bezieht sich auf das Nähe-Distanz-Modell von Koch und Oesterreicher.
- Konzeptionelle Mündlichkeit im Plauder-Chat
- Einfluss der gesprochenen Sprache auf den Chat-Duktus
- Analyse von Syntax, Morphologie, Phonetik und Semiotik in Chat-Beispielen
- Anwendung des Nähe-Distanz-Modells auf die Chat-Kommunikation
- Entwicklungen der internetbasierten Kommunikation im Kontext von Web 2.0
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema internetbasierte Kommunikation ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Ausmaß konzeptioneller Mündlichkeit in Plauder-Chats. Sie positioniert die Arbeit im Kontext der Kommunikationsgeschichte und erwähnt das Nähe-Distanz-Modell als analytisches Werkzeug. Die Arbeit skizziert den Forschungsweg und die Methodik, die zur Beantwortung der Forschungsfrage eingesetzt werden.
2. Internetbasierte Kommunikation im Spannungsfeld Mündlichkeit – Schriftlichkeit: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklungen internetbasierter Kommunikation, insbesondere im Kontext des Web 2.0. Es wird der Einfluss der neuen Technologien auf Schreibpraktiken und die Entstehung neuer Schreibstile diskutiert. Ein Schwerpunkt liegt auf der Abgrenzung zwischen interaktionsorientiertem und textorientiertem Schreiben und der Erklärung des Nähe-Distanz-Modells von Koch und Oesterreicher, welches als theoretischer Rahmen für die spätere Analyse dient. Der rasante Erfolg von Plattformen wie WhatsApp und Facebook wird als Beleg für die zunehmende Bedeutung schriftlicher Kommunikation in informellen, dialogischen Kontexten angeführt.
Schlüsselwörter
Plauder-Chat, Internetkommunikation, konzeptionelle Mündlichkeit, mediale Mündlichkeit, Nähe-Distanz-Modell, interaktionsorientiertes Schreiben, textorientiertes Schreiben, Web 2.0, Syntax, Morphologie, Phonetik, Semiotik, Chat-Korpus, Dortmunder Chat-Korpus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema "Konzeptionelle Mündlichkeit im Plauder-Chat"
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht, inwieweit die Kommunikationsform „Plauder-Chat“ Aspekte konzeptioneller Mündlichkeit aufweist und sich am Duktus der gesprochenen Sprache orientiert. Sie analysiert Chat-Beispiele und bezieht sich auf das Nähe-Distanz-Modell von Koch und Oesterreicher.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Konzeptionelle Mündlichkeit im Plauder-Chat, Einfluss der gesprochenen Sprache auf den Chat-Duktus, Analyse von Syntax, Morphologie, Phonetik und Semiotik in Chat-Beispielen, Anwendung des Nähe-Distanz-Modells auf die Chat-Kommunikation und Entwicklungen der internetbasierten Kommunikation im Kontext von Web 2.0.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Internetbasierte Kommunikation im Spannungsfeld Mündlichkeit – Schriftlichkeit, Die Kommunikationsform „Chat“, Aspekte konzeptioneller Mündlichkeit in Plauder-Chats und Fazit. Jedes Kapitel beinhaltet eine detaillierte Analyse spezifischer Aspekte der Chat-Kommunikation.
Wie ist die Methodik der Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit verwendet qualitative Methoden. Sie analysiert Chat-Beispiele (Korpus) anhand von Kriterien der Syntax, Morphologie, Phonetik und Semiotik. Das Nähe-Distanz-Modell von Koch und Oesterreicher dient als theoretischer Rahmen für die Analyse und Interpretation der Ergebnisse.
Welche Rolle spielt das Nähe-Distanz-Modell von Koch und Oesterreicher?
Das Nähe-Distanz-Modell dient als analytisches Werkzeug, um die Merkmale der Chat-Kommunikation im Hinblick auf Mündlichkeit und Schriftlichkeit einzuordnen und zu interpretieren. Es hilft, den Grad der Nähe oder Distanz zwischen den Kommunikationspartnern zu bestimmen.
Welche Aspekte der Sprache werden in der Analyse betrachtet?
Die Analyse betrachtet die Syntax (Satzbau), Morphologie (Wortbildung), Phonetik (Lautlehre) und Semiotik (Zeichenlehre) der Chat-Kommunikation, um den Grad der konzeptionellen Mündlichkeit zu bestimmen.
Welche Bedeutung hat Web 2.0 im Kontext der Arbeit?
Web 2.0 wird als wichtiger Kontextfaktor betrachtet, der die Entwicklung internetbasierter Kommunikation und den Aufstieg interaktionsorientierter Schreibformen beeinflusst hat. Die Arbeit untersucht, wie Web 2.0 die Art und Weise verändert hat, wie Menschen online kommunizieren.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Plauder-Chat, Internetkommunikation, konzeptionelle Mündlichkeit, mediale Mündlichkeit, Nähe-Distanz-Modell, interaktionsorientiertes Schreiben, textorientiertes Schreiben, Web 2.0, Syntax, Morphologie, Phonetik, Semiotik, Chat-Korpus, Dortmunder Chat-Korpus.
Was ist das Fazit der Arbeit?
(Das Fazit ist im bereitgestellten HTML-Code nicht explizit zusammengefasst. Es würde die Schlussfolgerungen der durchgeführten Analyse der konzeptionellen Mündlichkeit in Plauder-Chats enthalten.)
- Quote paper
- Amelie Probst (Author), 2018, Zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Die Kommunikationsform der Plauder-Chats, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/498038