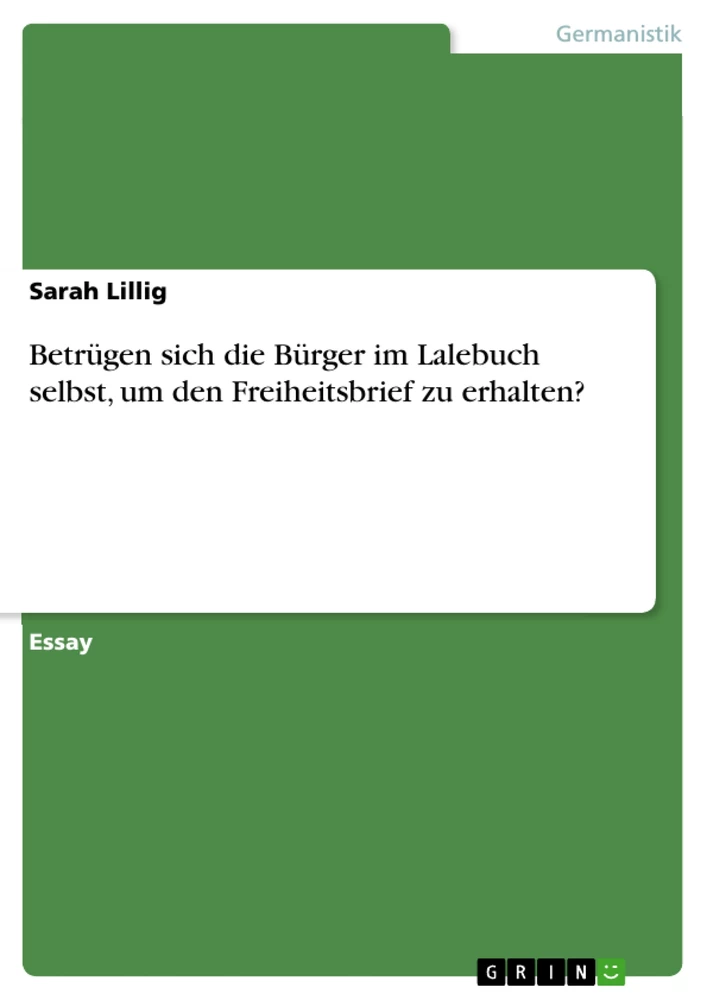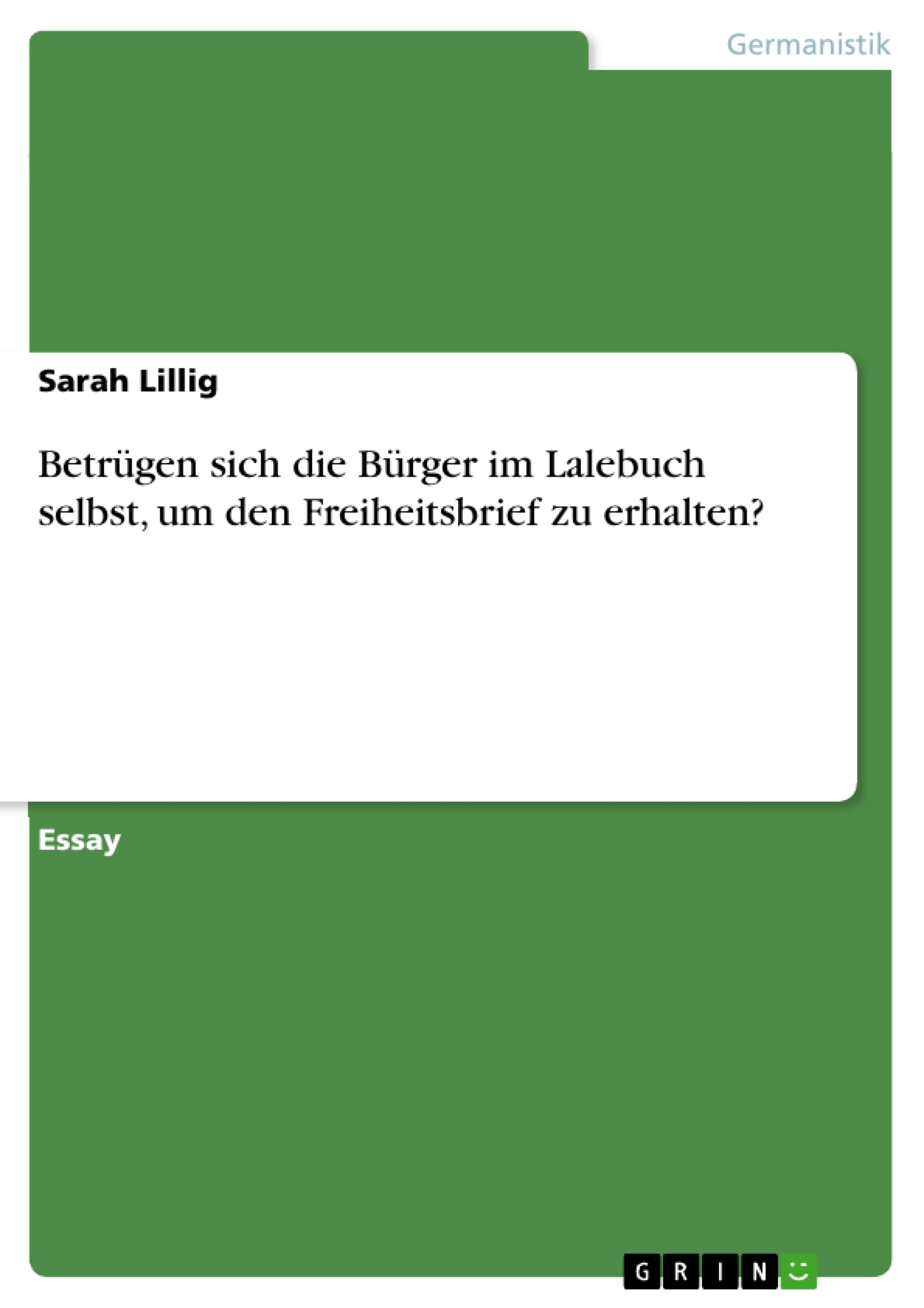Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob man den Bürgern im Lalebuch Selbstbetrug vorwerfen kann, um den Freiheitsbrief zu erhalten, ob sie also mit kaltem Kalkül handeln, oder ob ihre Torheit im Laufe der Handlung von ihnen Besitz ergreift, sodass sie für ihre Taten nicht mehr zurechnungsfähig sind.
Um die zentrale Fragestellung differenziert beantworten zu können ist eine nähere Beleuchtung der Annahme, ob die Lalen nun jemals weise waren, es immer waren, oder es darauf keine eindeutige Antwort gibt, unausweichlich.
Anhand hinzugezogener Hypothesen verschiedener Sprachwissenschaftler sowie entsprechend angeführter Beispiele aus den Kapiteln 6, 26, und 28 zeige ich mit der Methode der Gegenüberstellung verschiedene Deutungsansätze auf und beantworte auf Basis meiner Rechercheergebnisse die Frage nach selbstbetrügerischen Tendenzen in der Narrenfigur des Lalen und inwiefern ihre Weisheit, beziehungsweise Narrheit damit einhergeht.
Abschließend werde ich noch einmal auf die ursprüngliche Fragestellung eingehen und die gewonnenen Untersuchungsergebnisse in einem persönlichen Fazit zusammenführen sowie einen Ausblick formulieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Hans-Rudolph Veltens Diskursanalyse
- Gert Hübners Herangehensweise
- Andreas Bässlers Sichtweise
- Hans-Jürgen Bachorskis Ergebnisse
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay analysiert die Frage, ob sich in der Figur des Lalen ein selbstbetrügerischer Konsens erkennen lässt. Es wird untersucht, welche Folgen ein solcher Selbstbetrug haben könnte, wobei der Schwerpunkt auf der Analyse der Weisheit bzw. Narrheit der Lalen liegt. Die Untersuchung basiert auf verschiedenen Interpretationen von Sprachwissenschaftlern und analysiert ausgewählte Beispiele aus dem Lalebuch.
- Die Rolle des Lalen als Narr
- Die Ambivalenz von Weisheit und Narrheit
- Die Frage nach dem Selbstbetrug
- Die Interpretation des Lalebuchs aus verschiedenen Perspektiven
- Die Bedeutung von Kontext und Perspektive
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung des Essays vor und skizziert den methodischen Ansatz. Im Hauptteil werden verschiedene Perspektiven auf die Figur des Lalen diskutiert. Die Analyse der Diskursanalyse von Hans-Rudolph Velten zeigt, dass die Lalen in eine Abwärtsspirale der Narrheit geraten, die sie in die Abhängigkeit treibt. Gert Hübner hingegen bezweifelt die angeborene Weisheit der Lalen und sieht in ihrer Narrheit eine Habitualisierung, die zu einem Verlust der eigenen Werte führt. Andreas Bässler analysiert die Wechselbeziehung von Weisheit und Narrheit und kommt zu dem Schluss, dass die Lalen in einem Schwebezustand zwischen beiden Polen stehen. Hans-Jürgen Bachorski betrachtet die Lalen als gesellschaftskritische Figuren, die sich gegen die Konventionen ihrer Zeit stellen.
Schlüsselwörter
Lalebuch, Narrheit, Weisheit, Selbstbetrug, Diskursanalyse, Habitualisierung, Ambivalenz, Gesellschaftskritik, Kontext, Perspektive, Interpretation.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Analyse des Lalebuchs?
Die Arbeit untersucht, ob die Bürger (Lalen) aus Selbstbetrug und Kalkül handeln oder ob sie tatsächlich ihrer Narrheit verfallen sind.
Was ist das Ziel der Lalen in der Erzählung?
Die Bürger versuchen oft, einen „Freiheitsbrief“ zu erhalten oder zu bewahren, was als Motiv für ihre Taten dient.
Waren die Lalen ursprünglich weise?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Hypothesen, ob die Lalen jemals weise waren oder ob ihre Narrheit eine bewusste Inszenierung ist.
Welche wissenschaftlichen Perspektiven werden herangezogen?
Es werden Diskursanalysen und Sichtweisen von Sprachwissenschaftlern wie Hans-Rudolph Velten, Gert Hübner und Andreas Bässler gegenübergestellt.
Ist das Lalebuch eine reine Narrengeschichte?
Nein, die Analyse zeigt, dass in der Figur des Lalen auch gesellschaftskritische Tendenzen und eine Ambivalenz zwischen Weisheit und Narrheit stecken.
- Citar trabajo
- Sarah Lillig (Autor), 2019, Betrügen sich die Bürger im Lalebuch selbst, um den Freiheitsbrief zu erhalten?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/498661