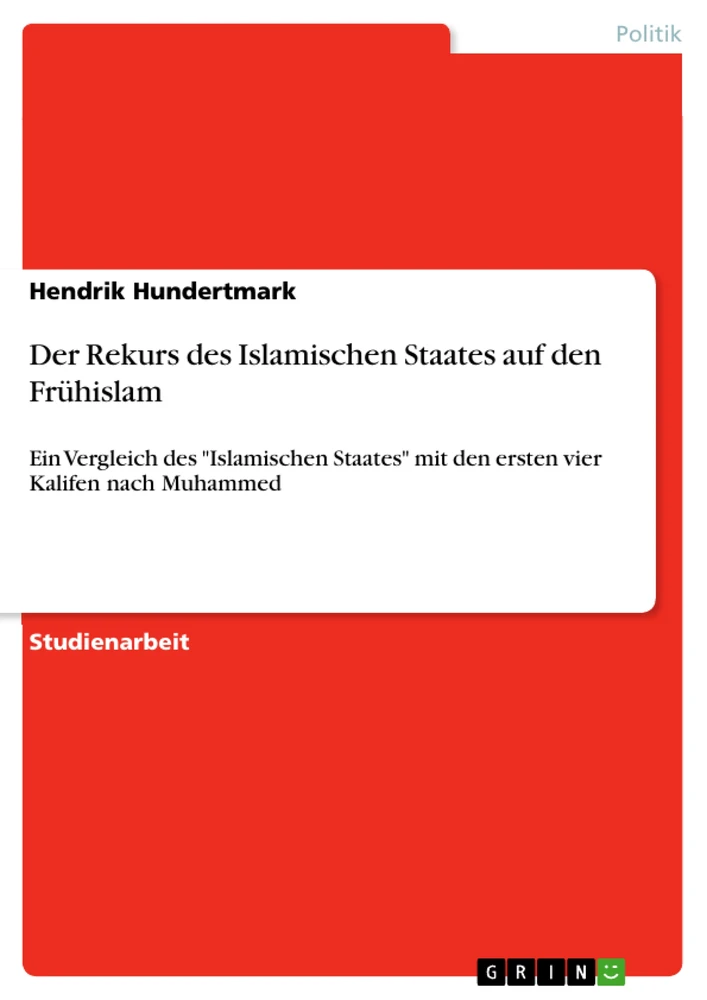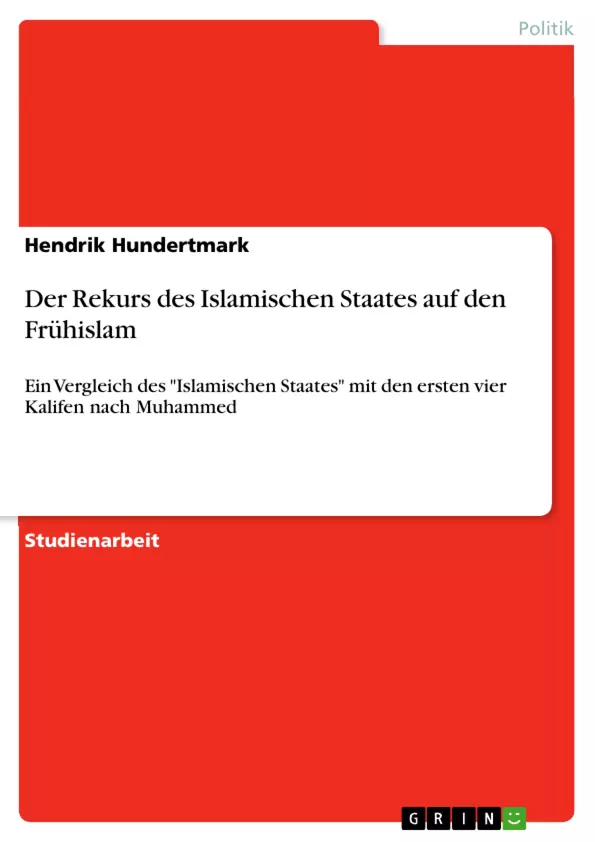Der Islamische Staat hat sich immer wieder auf die Zeit des Frühislams berufen. Hierbei im Besonderen auf die Zeit der vier rechtsgeleiteten Kalifen. Dies nicht ohne Grund, denn diese Zeit gilt als Ideal und wird verklärt im Islam. Die Arbeit beschäftigt sich einerseits mit dem Frühislam, andererseits mit dem Islamischen Statt, um zu analysieren, inwieweit hier Parallelen zu finden sind.
Hintergrund dieses Sujets ist, dass der Rekurs auf vergangene religiöse Traditionen durch islamische Fundamentalisten oftmals rekonstruiert ist, es sich also um "invented traditions" handelt (Tibi 1995: 17). Mit der aufgeworfenen Forschungsfrage soll thematisiert werden, ob der vom islamischen Staat beanspruchte Rekurs auf die Zeit der "vier rechtgeleiteten Kalifen" eine Rückkehr zu dieser Zeit ist oder diese beanspruchte Rückkehr lediglich vom Islamischen Staat konstruiert wird.
Als theoretischer Hintergrund für dies Analyse sollen die Ausführungen Holger Zapfs zum politischen Denken und zur Staatlichkeit im Islam dienen, insbesondere die Ausarbeitungen zum Frühislam.
Im Folgenden wird die Zeit der "vier rechtgeleiteten Kalifen" aus einer politisch-historischen Perspektive erörtert, um in einem zweiten Schritt den Islamischen Staat zu thematisieren. Dieser wird sowohl von seiner Entwicklung seit der Gründung ausgehend betrachtet als auch vonseiner Organisationsstruktur in dem ausgerufenen Kalifat. Nach der Betrachtung dieser beiden Gegenstandsbereiche wird ein Vergleich zwischen der Zeit der "vier rechtgeleiteten Kalifen"und dem Islamischen Staat der Gegenwart gezogen. Im Fazit erfolgt die abschließende Beurteilung hinsichtlich der aufgeworfenen Forschungsfrage.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die frühislamische Zeit der „vier rechtgeleiteten Kalifen“ aus politisch-historischer Perspektive
- Die Entwicklung des „Islamischen Staates“ seit dem Ausruf zum Kalifat und seine Organisationsstruktur
- Vergleich der Zeit der „vier rechtgeleiteten Kalifen“ mit dem Islamischen Staat
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem islamischen Staat in Syrien und Irak und untersucht, inwiefern dieser eine Rückkehr in die Zeit der „vier rechtgeleiteten Kalifen“ repräsentiert. Die Arbeit analysiert die vom Islamischen Staat beanspruchte Verbindung zur Frühislamischen Zeit und hinterfragt die Relevanz dieser Verbindung im Kontext islamischer Traditionen und des modernen Islamismus.
- Die Zeit der „vier rechtgeleiteten Kalifen“ als Referenzpunkt für den Islamischen Staat
- Die Konstruktion von Tradition im Kontext islamischen Fundamentalismus
- Die Organisationsstruktur und Ideologie des Islamischen Staates
- Vergleichende Analyse der Zeit der „vier rechtgeleiteten Kalifen“ und des Islamischen Staates
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Kapitel stellt den Islamischen Staat und seinen Anspruch auf die Nachfolge der „vier rechtgeleiteten Kalifen“ in den Kontext des Arabischen Frühlings und des syrischen Bürgerkriegs. Die Forschungsfrage thematisiert die Frage, ob der Islamische Staat tatsächlich eine Rückkehr zu dieser Zeit repräsentiert oder ob es sich um eine konstruierte Verbindung handelt.
- Die frühislamische Zeit der „vier rechtgeleiteten Kalifen“ aus politisch-historischer Perspektive: Dieses Kapitel beleuchtet die Zeit der ersten vier Kalifen nach dem Tod Muhammads, wobei der Fokus auf die politischen und historischen Gegebenheiten sowie die Ideale dieser Zeit liegt.
- Die Entwicklung des „Islamischen Staates“ seit dem Ausruf zum Kalifat und seine Organisationsstruktur: Dieses Kapitel behandelt die Entstehung und Entwicklung des Islamischen Staates, einschließlich seiner Organisationsstruktur und der zentralen Elemente seiner Ideologie.
Schlüsselwörter
Islamischer Staat, „vier rechtgeleitete Kalifen“, frühislamische Zeit, Kalifat, Islamischer Fundamentalismus, Arabischer Frühling, Syrien, Irak, „invented traditions“, politische Ideologie, Organisationsstruktur, Vergleichende Analyse.
Häufig gestellte Fragen
Inwieweit bezieht sich der Islamische Staat auf den Frühislam?
Der Islamische Staat (IS) beruft sich massiv auf die Zeit der "vier rechtgeleiteten Kalifen", um seine Herrschaft zu legitimieren und als ideale islamische Staatsform darzustellen.
Was sind "invented traditions" im Kontext des IS?
Der Begriff beschreibt Traditionen, die von modernen Fundamentalisten konstruiert oder "erfunden" werden, um den Anschein einer historischen Kontinuität zu erwecken, die in der Realität oft so nicht existierte.
Wer waren die "vier rechtgeleiteten Kalifen"?
Es handelt sich um die ersten vier Nachfolger des Propheten Muhammad (Abū Bakr, ʿUmar, ʿUṯmān und ʿAlī), deren Regierungszeit im sunnitischen Islam als vorbildlich und idealisiert gilt.
Welche Rolle spielt die Organisationsstruktur des IS?
Die Arbeit analysiert, wie der IS moderne bürokratische Strukturen mit pseudohistorischen Titeln und Ämtern kombiniert, um den Anspruch eines wiederauferstandenen Kalifats zu untermauern.
Ist der IS eine tatsächliche Rückkehr zum Frühislam?
Die Untersuchung hinterfragt kritisch, ob es sich um eine echte Rückkehr handelt oder ob der IS lediglich selektive historische Elemente nutzt, um eine moderne, totalitäre Ideologie religiös zu verbrämen.
- Quote paper
- Hendrik Hundertmark (Author), 2015, Der Rekurs des Islamischen Staates auf den Frühislam, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/498937