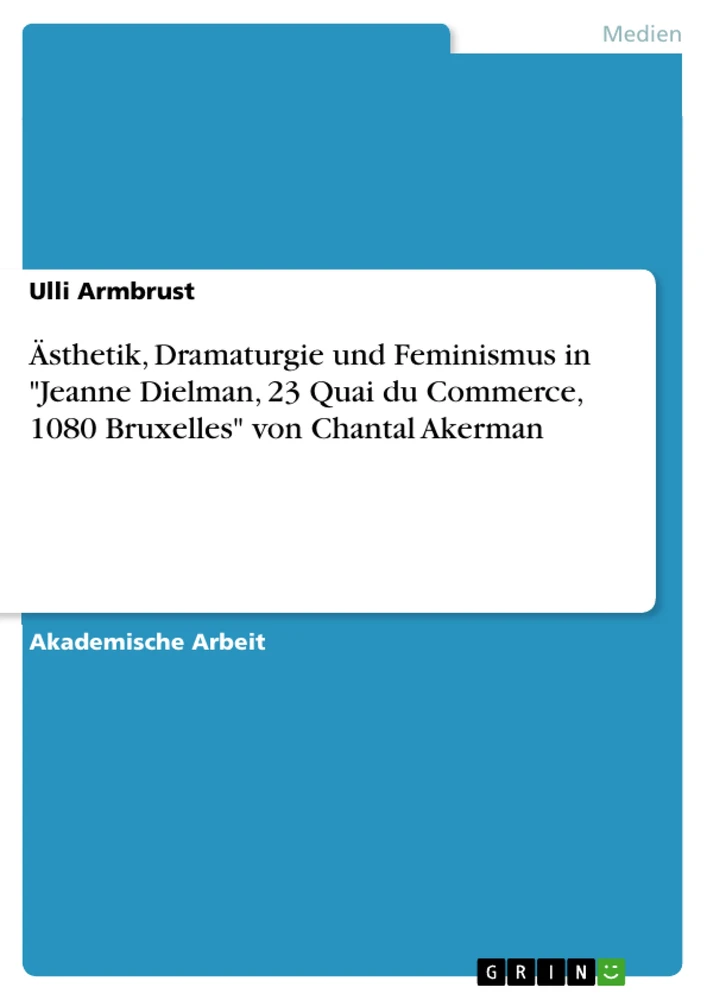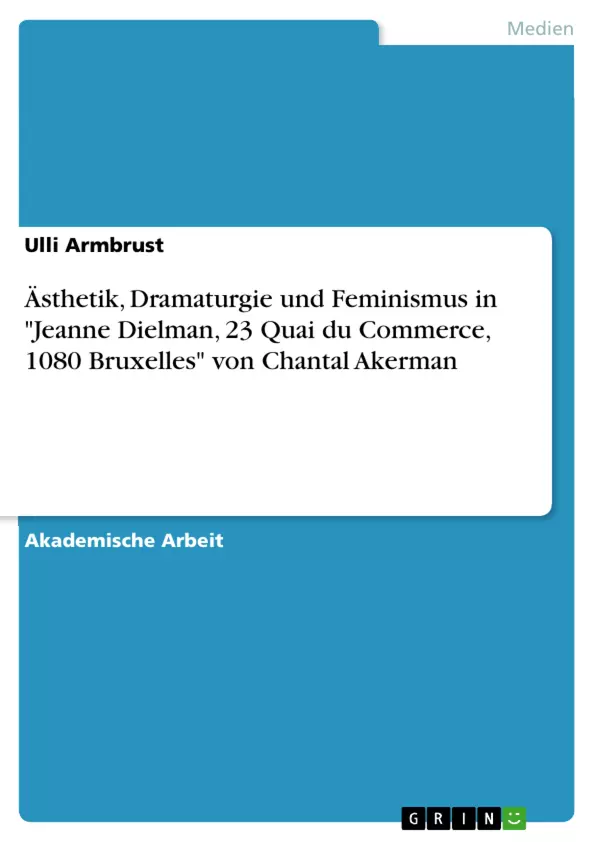In dieser Seminararbeit wird aus einem medienästhetischen Blickwinkel analysiert, wie Akermans unkonventioneller Nutzen der filmtechnischen Mittel das in Hollywood etablierte patriarchische Sehsystem dekonstruiert und gleichzeitig aufgezeigt werden, warum eine medienästhetische Filmanalyse auch in feministischen Theorien von Relevanz ist.
Die Disziplin der Medienästhetik definiert sich als "eine historisch und theoretisch orientierte Darstellung und Analyse der Wahrnehmungsformen audiovisueller Medien. [...] Sie verfolgt die Entwicklung audiovisueller Wahrnehmungsformen [...] unter produktionsästhetischen Aspekten". Genau auf diesen produktionsästhetischen Aspekten soll der Fokus der Ausführungen liegen: auf filmtechnischer Ebene ebenso wie auf der Gegenstandsebene und die Verbindung beider durch die Mise en Scène und die Montage.
Medienwissenschaftlich betrachtet wird hierbei die Komposition audiovisueller Medien bezüglich ihrer Funktion als ein werteorganisierendes und -übermittelndes Medium und die mediale Wirkung auf den Betrachter.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundsätze der Medienästhetik
- Feminismus und die feministische Filmtheorie
- Laura Mulvey: Visual Pleasure and Narrative Cinema
- JEANNE DIELMAN, 23 QUAI DU COMMERCE, 1080 BRUXELLES
- Medienästhetische Analyse
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert Chantal Akermans Film "Jeanne Dielman, 23 quai du commerce, 1080 Bruxelles" aus medienästhetischer Perspektive. Ziel ist es, aufzuzeigen, wie Akermans unkonventioneller Umgang mit filmtechnischen Mitteln das in Hollywood etablierte patriarchische Sehsystem dekonstruiert. Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Medienästhetik und feministischer Filmtheorie.
- Dekonstruktion des patriarchischen Sehsystems in Hollywood
- Medienästhetische Analyse von Akermans Filmtechnik
- Bedeutung langer Einstellungen und fehlender Kamerabewegungen
- Verknüpfung von Medienästhetik und feministischer Filmtheorie
- Analyse der Darstellung weiblicher Subjektivität im Film
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt Chantal Akermans Film "Jeanne Dielman, 23 quai du commerce, 1080 Bruxelles" vor und vergleicht ihn mit Orson Welles' "Citizen Kane". Sie hebt die Bedeutung des Films für die feministische Filmtheorie hervor und skizziert die medienästhetische Analyse des Alltags im Film, die im Fokus der Arbeit steht. Die Arbeit untersucht, wie Akermans filmtechnische Mittel das Hollywood-Kino und dessen patriarchisches Sehsystem dekonstruieren.
Grundsätze der Medienästhetik: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Medienästhetik dar, indem es die wichtigsten Parameter der Filmanalyse nach Ralf Schnell erläutert. Es werden technische Aspekte wie Montage, Mise-en-scène, Kameraeinstellungen und -bewegungen als entscheidende Faktoren für die ästhetische Wirkung hervorgehoben. Schnell betont die Bedeutung der *wie*-Frage (Wie wird etwas gezeigt?) gegenüber der *was*-Frage (Was wird gezeigt?). Die Kameraposition als Mittel zur Akzentuierung von Machtverhältnissen wird ebenfalls diskutiert.
Feminismus und die feministische Filmtheorie: Dieses Kapitel beleuchtet die Relevanz des Feminismus und der feministischen Filmtheorie für die Analyse von "Jeanne Dielman". Es werden die wichtigsten Strömungen und Ansätze der feministischen Filmtheorie der 1960er und 70er Jahre erörtert, wobei der Schwerpunkt auf Laura Mulveys psychoanalytischem Ansatz liegt. Mulveys Kritik am Hollywood-Kino als patriarchalischem System und ihre Forderung nach einem bewussten Umgang mit Filmbildern werden beschrieben. Der Film wird im Kontext der sexuellen Ungleichheit und der Darstellung der Frau als filmisches Objekt im Hollywood-Kino betrachtet.
Laura Mulvey: Visual Pleasure and Narrative Cinema: Dieses Kapitel analysiert Laura Mulveys Aufsatz "Visual Pleasure and Narrative Cinema" und seine Relevanz für die Interpretation von "Jeanne Dielman". Mulveys Bezug auf Freuds Theorien zur Schaulust und Phallozentrismus wird erläutert, ebenso ihre Kritik am voyeuristischen Aspekt des traditionellen Kinos. Es wird gezeigt, wie Mulvey die Konstruktion der Frau als erotisches Objekt im Hollywood-Kino kritisiert und ihre Forderung nach einer Veränderung der filmischen Produktions- und Rezeptionsweisen im Kontext von "Jeanne Dielman" diskutiert.
Schlüsselwörter
Medienästhetik, Feministische Filmtheorie, Chantal Akerman, Jeanne Dielman, Laura Mulvey, Hollywood-Kino, Patriarchisches Sehsystem, Filmtechnik, Mise-en-scène, Montage, Kameraeinstellungen, Schaulust, Phallozentrismus.
Häufig gestellte Fragen zu "Jeanne Dielman, 23 quai du commerce, 1080 Bruxelles": Medienästhetische Analyse eines feministischen Meisterwerks
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert Chantal Akermans Film "Jeanne Dielman, 23 quai du commerce, 1080 Bruxelles" aus medienästhetischer Perspektive. Im Fokus steht die Dekonstruktion des in Hollywood etablierten patriarchischen Sehsystems durch Akermans unkonventionellen Umgang mit filmtechnischen Mitteln.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Medienästhetik und feministischer Filmtheorie. Sie zeigt auf, wie Akermans Filmtechnik, insbesondere lange Einstellungen und fehlende Kamerabewegungen, das traditionelle Hollywood-Kino herausfordert und die weibliche Subjektivität anders darstellt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Wichtige Themen sind die Dekonstruktion des patriarchischen Sehsystems in Hollywood, die medienästhetische Analyse von Akermans Filmtechnik, die Bedeutung langer Einstellungen und fehlender Kamerabewegungen, die Verknüpfung von Medienästhetik und feministischer Filmtheorie sowie die Analyse der Darstellung weiblicher Subjektivität im Film.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf den Grundsätzen der Medienästhetik nach Ralf Schnell, der die Bedeutung technischer Aspekte wie Montage, Mise-en-scène und Kameraführung betont. Zusätzlich werden wichtige Strömungen der feministischen Filmtheorie der 1960er und 70er Jahre, insbesondere der psychoanalytische Ansatz von Laura Mulvey, herangezogen.
Welche Rolle spielt Laura Mulveys "Visual Pleasure and Narrative Cinema"?
Mulveys Aufsatz "Visual Pleasure and Narrative Cinema" spielt eine zentrale Rolle. Die Arbeit erläutert Mulveys Kritik am voyeuristischen Aspekt des traditionellen Kinos, ihre Analyse des Schaulust- und Phallozentrismus und ihre Forderung nach einer Veränderung der filmischen Produktions- und Rezeptionsweisen. Der Einfluss dieser Theorien auf die Interpretation von "Jeanne Dielman" wird ausführlich diskutiert.
Wie wird der Film "Jeanne Dielman" im Kontext des Hollywood-Kinos betrachtet?
Der Film wird als Gegenentwurf zum traditionellen Hollywood-Kino verstanden. Die Arbeit zeigt, wie Akermans Filmtechnik das patriarchalische Sehsystem des Hollywood-Kinos dekonstruiert und alternative Möglichkeiten der filmischen Darstellung weiblicher Subjektivität aufzeigt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, Grundsätze der Medienästhetik, Feminismus und feministische Filmtheorie, Laura Mulvey: Visual Pleasure and Narrative Cinema und einer abschließenden Zusammenfassung (Fazit).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Medienästhetik, Feministische Filmtheorie, Chantal Akerman, Jeanne Dielman, Laura Mulvey, Hollywood-Kino, Patriarchisches Sehsystem, Filmtechnik, Mise-en-scène, Montage, Kameraeinstellungen, Schaulust, Phallozentrismus.
- Citation du texte
- Ulli Armbrust (Auteur), 2019, Ästhetik, Dramaturgie und Feminismus in "Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles" von Chantal Akerman, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/498969