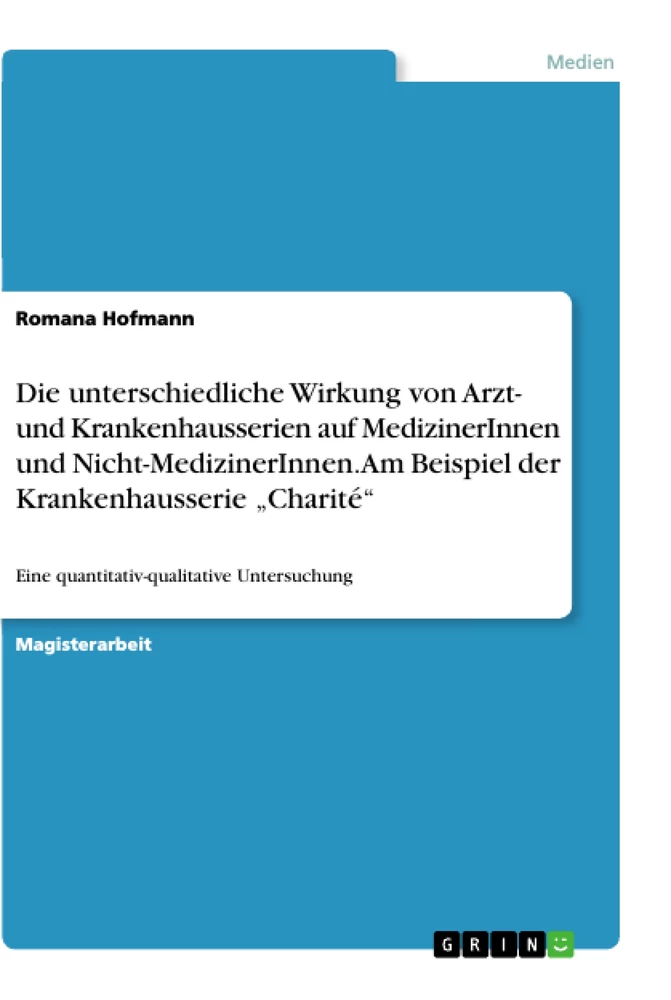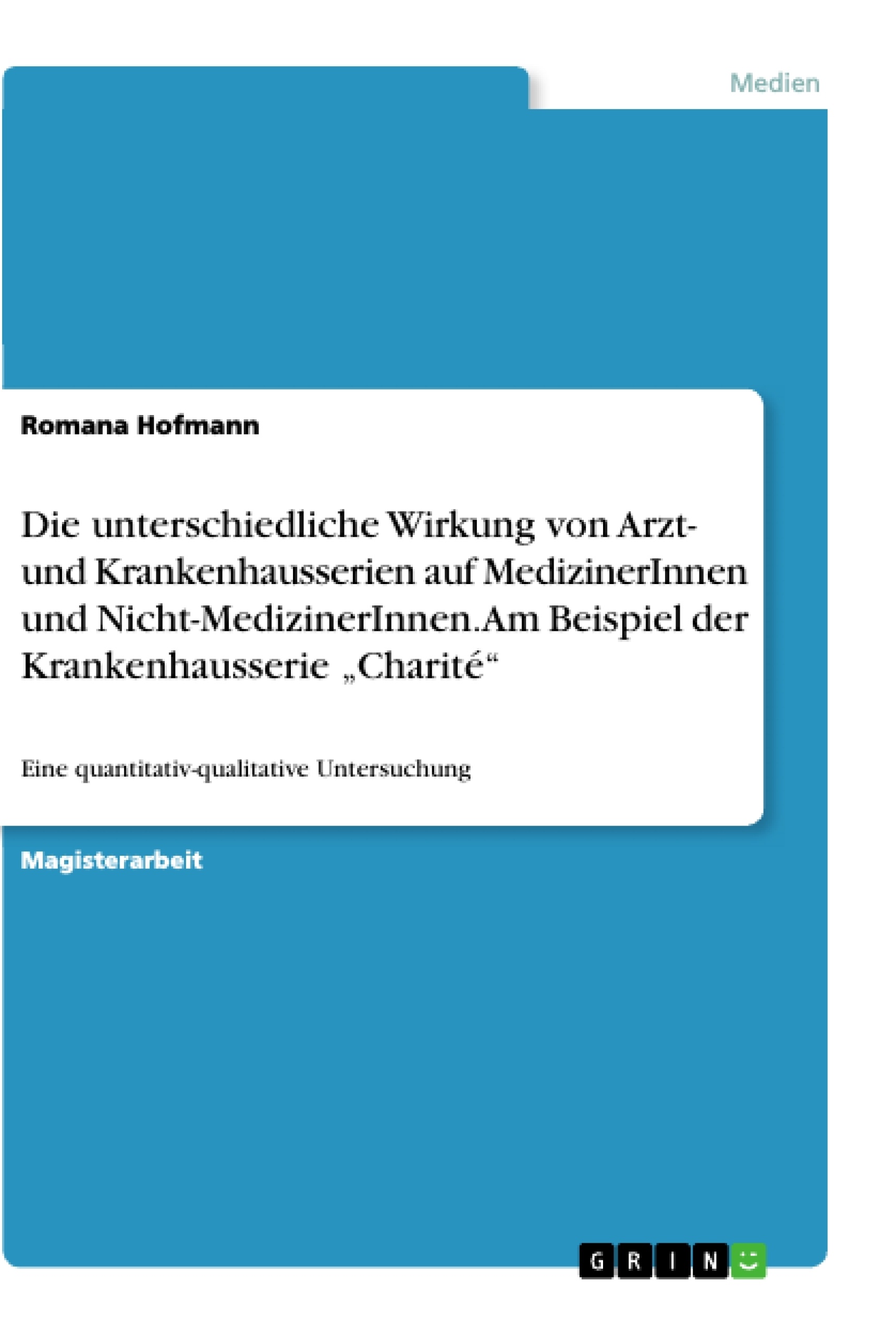Ziel der vorliegenden wissenschaftlichen Arbeit ist es, sich den vielfältigen Fragestellungen, die aus der Rezeption von Krankenhausserien hervorgehen, aus zwei verschiedenen Standpunkten zu widmen: zum einen aus dem von (werdenden) MedizinerInnen und zum anderen aus dem von Nicht-MedizinerInnen.
Entertainment-Education an sich wird bereits seit mehreren Jahrzehnten in der Kommunikationswissenschaft ausführlich erforscht und es wurde auch mehrfach nachgewiesen, dass die Verbindung von Unterhaltung und Bildung gut funktioniert.
So kann beispielsweise durch ein gut gewähltes Narrativ das Arztbild verbessert werden, oder aber auch die Ansprüche auf das Gesundheitssystem angehoben werden. Sowohl die Geschlechterrolle in der Ärzteserie als auch die Auswirkung der Darstellung der Frau in diesem Format auf die Entertainment-Education-Botschaft sind allerdings bisher wenig bis gar nicht erforscht. Der Universitätsprofessor und Mediziner Jürgen Schäfer ist dafür bekannt, dass er die Ärzteserie "Dr. House" in seinen Unterricht einbaut. Er und viele seiner FachkollegInnen sind der Meinung, dass Ärzteserien durchaus "großes Potenzial bei der Gesundheitsaufklärung" haben.
Fazit: Obwohl größtenteils sehr sorgfältig recherchiert wurde, da in den USA auch medizinische Beratung für Drehbuchautoren angeboten wird, was im deutschsprachigen Raum fehlt, kam es inhaltlich natürlich trotzdem in manchen Punkten zu Kritik aufgrund der Dramatik oder dem Hauptaugenmerk auf den (Liebes-)Narrativen, abseits des klinischen Alltags. Marion Esch, eine Medienwissenschaftlerin der Technischen Universität Berlin, kritisiert Ähnliches an deutschen Ärzteserien und ist der Meinung, dass Fernsehunterhaltung auch Bildung sein sollte. Außerdem spricht sie sich deutlich gegen das dargestellte Frauenbild in deutschen Arztserien aus. So sei ein weiblicher Chefarzt unvorstellbar, "und wenn eine Frau richtig Karriere macht, ist sie schnell eine Rabenmutter". Inwiefern sich das dargestellte Rollenbild, sowohl der Ärztin als auch des Arztes in Serien, von dem realen Bild eines/einer MedizinerIn unterscheidet und inwiefern sich dieses Rollenbild im Laufe der Zeit verändert hat, wird in Kapitel 6 genauer erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 1.1. ERKENNTNISINTERESSE
- 1.2. FORSCHUNGSLEITENDE FRAGESTELLUNGEN
- 1.3. AUFBAU DER ARBEIT
- 2. GESUNDHEIT UND GESUNDHEITSKOMMUNIKATION
- 2.1. GESUNDHEIT
- 2.2. GESUNDHEITSKOMMUNIKATION
- 3. MEDIENFORSCHUNG
- 3.1. SYMBOLISCHER INTERAKTIONISMUS
- 3.2. MEDIENNUTZUNG
- 3.2.1. Der Uses- and Gratification-Approach
- 3.2.2. Der handlungstheoretische Nutzenansatz
- 3.2.3. Der Information-Utility-Ansatz
- 4. INFORMATION UND UNTERHALTUNG
- 4.1. INFORMATION
- 4.2. UNTERHALTUNG
- 4.3. DAS ZUSAMMENSPIEL
- 4.4. ENTERTAINMENT EDUCATION
- 5. DAS SERIENGENRE ARZT-/KRANKENHAUSSERIE
- 5.1. DEFINITIONEN UND MERKMALE
- 5.2. GESCHICHTLICHE ENTWICKLUNG VON ARZT-/KRANKENHAUSSERIEN
- 5.3. DIE KRANKENHAUSSERIE „CHARITÉ“
- 5.4. EINFLUSS VON ARZT-/KRANKENHAUSSERIEN AUF DIE REZIPIENTINNEN
- 6. ROLLENVERSTÄNDNIS UND ROLLENFLEXIBILITÄT
- 6.1. DIE ROLLE ALLGEMEIN
- 6.2. DIE ROLLE DES ARZTES/ DER ÄRZTIN IN DER REALITÄT
- 6.3. DIE ROLLE DES ARZTES/ DER ÄRZTIN IN DER SERIE
- 7. DIE VERWISSENSCHAFTLICHUNG DER MEDIZIN
- 8. METHODIK
- 8.1. ERHEBUNGSMETHODEN
- 8.2. DATENERHEBUNGSINSTRUMENT GRUPPENDISKUSSION
- 8.2.1. Definition und Anwendungsbereiche
- 8.2.2. Vorteile und Nachteile einer Gruppendiskussion
- 8.2.3. Die Gruppe
- 8.2.4. Ablauf und Leitfaden
- 8.2.5. Datenerfassung und Transkription
- 8.3. DATENERHEBUNGSINSTRUMENT FRAGEBOGEN
- 8.4. UNTERSUCHUNGSDESIGN
- 8.4.1. Wahl der Methode
- 8.4.2. Konzeption der Gruppendiskussion
- 8.4.3. Ablauf und Leitfaden
- 8.4.4. Wahl des Filmmaterials
- 8.4.5. Konzeption des Fragebogens
- 8.5. AUSWERTUNGSVERFAHREN
- 8.5.1. Gruppendiskussionen
- 8.5.2. Standardisierte Auswertung des Fragebogens
- 8.6. SAMPLEBESCHREIBUNG
- 8.6.1. Rekrutierung der ProbandInnen
- 8.6.2. Sample
- 9. ERGEBNISSE
- 9.1. DESKRIPTIVSTATISTISCHE ERGEBNISSE
- 9.1.1. Informationsverhalten
- 9.1.2. Nutzung von Krankenhausserien + Charité
- 9.1.3. ÄrztInnenbild
- 9.1.4. Gesundheitsvorsorge
- 9.1.5. Geschlechtsrollenverständnis
- 9.2. AUSWERTUNG DER GRUPPENDISKUSSION
- 9.3. HYPOTHESEN
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Unterschiede in der Rezeption von Krankenhausserien zwischen Mediziner*innen und Nicht-Mediziner*innen. Die Studie konzentriert sich auf die erste Staffel der Serie „Charité“ und nutzt eine quantitativ-qualitative Methode, bestehend aus Gruppendiskussionen und Fragebögen. Die Arbeit analysiert das Gesundheits- und Informationsverhalten der beiden Gruppen sowie deren Rollenverständnis und Einstellungen zu verschiedenen medizinischen Ansätzen.
- Rezeption von Krankenhausserien durch Mediziner*innen und Nicht-Mediziner*innen
- Gesundheits- und Informationsverhalten beider Gruppen
- Rollenverständnis von Ärzt*innen in der Serie und in der Realität
- Einstellungen zu Schulmedizin und Alternativmedizin
- Geschlechterrollen im Kontext der Medizin
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Arbeit untersucht die unterschiedlichen Perspektiven von Mediziner*innen und Nicht-Mediziner*innen auf Krankenhausserien, speziell auf „Charité“. Sie formuliert zentrale und untergeordnete Forschungsfragen, die mittels qualitativer (Gruppendiskussionen) und quantitativer (Fragebögen) Methoden beantwortet werden sollen. Das Erkenntnisinteresse liegt in der Erforschung der unterschiedlichen Rezeptions- und Verhaltensweisen beider Gruppen im Kontext von Gesundheitskommunikation.
2. Gesundheit und Gesundheitskommunikation: Dieses Kapitel beleuchtet den komplexen Begriff „Gesundheit“ und verschiedene Definitionsversuche, von der Abwesenheit von Krankheit bis hin zu einem ganzheitlichen Wohlbefinden. Es wird die Bedeutung der Gesundheitskommunikation, der Austausch von Wissen und Meinungen zwischen Akteuren des Gesundheitswesens und der Bevölkerung, diskutiert und die verschiedenen Kommunikationswege (persönlich, Peer-Kommunikation, Medien) beleuchtet. Die zunehmende Bedeutung des Internets als Informationsquelle wird kritisch betrachtet.
3. Medienforschung: Kapitel 3 beschreibt die theoretischen Grundlagen der Arbeit. Der symbolische Interaktionismus wird als Ausgangspunkt für das Verständnis der Rolle von Individuen in der Gesellschaft und deren Interpretation von Medienbotschaften herangezogen. Es werden verschiedene Ansätze der Mediennutzung vorgestellt: Uses-and-Gratification-Approach, handlungstheoretischer Nutzenansatz und Information-Utility-Ansatz. Diese Ansätze liefern den Rahmen für die Analyse der Medienrezeption von Krankenhausserien.
4. Information und Unterhaltung: Das Kapitel analysiert das Zusammenspiel von Information und Unterhaltung in der Medienkommunikation. Es werden die traditionellen Gegensätze der beiden Konzepte aufgebrochen und der Begriff Entertainment-Education eingeführt. Es wird erörtert, wie Unterhaltungsformate zur Vermittlung von Gesundheitsinformationen genutzt werden können und welche Faktoren den Erfolg solcher Strategien beeinflussen. Die Herausforderungen und Beispiele von Entertainment-Education-Projekten werden präsentiert.
5. Das Seriengenre Arzt-/Krankenhausserie: Kapitel 5 befasst sich mit dem Genre der Arzt- und Krankenhausserie. Es wird die historische Entwicklung, die typischen Merkmale und die Relevanz für die Rezipient*innen diskutiert. Es wird der Wandel des Arztbildes von einer heroischen zu einer realistischeren Darstellung analysiert und der Einfluss dieser Darstellung auf das Publikum beleuchtet. Die Serie „Charité“ wird als Untersuchungsgegenstand vorgestellt.
6. Rollenverständnis und Rollenflexibilität: Dieses Kapitel erörtert das soziologische Konzept der „Rolle“ und analysiert das Rollenverständnis von Ärzt*innen in der Realität und in Krankenhausserien. Es werden die Erwartungen an Ärzt*innen, Intra- und Interrollenkonflikte sowie die geschlechtsspezifische Ausprägung der Rolle diskutiert. Die historische und aktuelle Entwicklung der Arztrolle wird im Detail beschrieben.
7. Die Verwissenschaftlichung der Medizin: Kapitel 7 beleuchtet die Verwissenschaftlichung der Medizin seit dem späten 19. Jahrhundert. Es werden die Entwicklung der naturwissenschaftlichen Medizin, die Herausforderungen des Dualismus zwischen objektiver Erkenntnis und subjektiver Patientenversorgung sowie die verschiedenen medizinischen Ansätze (Schulmedizin, Alternativmedizin, Komplementärmedizin) erläutert.
8. Methodik: Dieses Kapitel beschreibt das methodische Vorgehen der Studie. Die Wahl der leitfadengestützten Gruppendiskussion und des ergänzenden Fragebogens wird begründet. Die Durchführung der Studie, die Zusammensetzung der Stichprobe, die Auswertung der Daten mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring und die statistischen Auswertungsverfahren werden detailliert dargestellt.
9. Ergebnisse: Kapitel 9 präsentiert die Ergebnisse der Studie. Die deskriptivstatistischen Ergebnisse des Fragebogens werden zunächst dargestellt, gefolgt von einer detaillierten Analyse der Gruppendiskussionen, geordnet nach Kategorien. Die Ergebnisse werden mit Bezug auf die Forschungsfragen interpretiert und Hypothesen aufgestellt.
Schlüsselwörter
Gesundheitskommunikation, Entertainment Education, Krankenhausserien, Arztbild, Rollenverständnis, Mediziner*innen, Nicht-Mediziner*innen, „Charité“, Schulmedizin, Alternativmedizin, Informationsverhalten, Gesundheitsverhalten, Geschlechterrollen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Rezeption von Krankenhausserien
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die Unterschiede in der Rezeption von Krankenhausserien, insbesondere der Serie „Charité“, zwischen Mediziner*innen und Nicht-Mediziner*innen. Sie analysiert das Gesundheits- und Informationsverhalten beider Gruppen, ihr Rollenverständnis von Ärzt*innen und ihre Einstellungen zu verschiedenen medizinischen Ansätzen.
Welche Methoden wurden in der Studie angewendet?
Die Studie verwendet eine quantitativ-qualitative Methode. Es wurden leitfadengestützte Gruppendiskussionen mit Mediziner*innen und Nicht-Mediziner*innen durchgeführt und ergänzende Fragebögen eingesetzt. Die Daten wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring und deskriptiv-statistischen Verfahren ausgewertet.
Welche Forschungsfragen werden in der Arbeit behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage untersucht die Unterschiede in der Rezeption von Krankenhausserien zwischen den beiden Gruppen. Untergeordnete Fragen befassen sich mit dem Gesundheits- und Informationsverhalten, dem Rollenverständnis von Ärzt*innen (in der Serie und der Realität), den Einstellungen zu Schul- und Alternativmedizin sowie dem Geschlechterrollenverständnis im medizinischen Kontext.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf den symbolischen Interaktionismus, um die Interpretation von Medienbotschaften zu verstehen. Zusätzlich werden verschiedene Ansätze der Mediennutzung herangezogen, darunter der Uses-and-Gratification-Approach, der handlungstheoretische Nutzenansatz und der Information-Utility-Ansatz.
Welche Aspekte der Gesundheitskommunikation werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet den komplexen Begriff „Gesundheit“ und verschiedene Definitionsversuche. Es wird die Bedeutung der Gesundheitskommunikation, die verschiedenen Kommunikationswege (persönlich, Peer-Kommunikation, Medien) und die zunehmende Rolle des Internets als Informationsquelle diskutiert.
Wie wird das Genre der Arzt-/Krankenhausserie behandelt?
Die Arbeit analysiert die historische Entwicklung, die typischen Merkmale und die Relevanz von Arzt-/Krankenhausserien für die Rezipient*innen. Der Wandel des Arztbildes und der Einfluss der Serien auf das Publikum werden untersucht. Die Serie „Charité“ dient als Fallbeispiel.
Wie wird das Rollenverständnis von Ärzt*innen analysiert?
Die Arbeit untersucht das Rollenverständnis von Ärzt*innen in der Realität und in der Serie „Charité“. Es werden Erwartungen an Ärzt*innen, Intra- und Interrollenkonflikte sowie die geschlechtsspezifische Ausprägung der Rolle diskutiert.
Wie wird die Verwissenschaftlichung der Medizin behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Verwissenschaftlichung der Medizin seit dem späten 19. Jahrhundert, die Entwicklung der naturwissenschaftlichen Medizin, den Dualismus zwischen objektiver Erkenntnis und subjektiver Patientenversorgung und die verschiedenen medizinischen Ansätze (Schulmedizin, Alternativmedizin, Komplementärmedizin).
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse umfassen deskriptivstatistische Auswertungen des Fragebogens und eine qualitative Inhaltsanalyse der Gruppendiskussionen. Die Ergebnisse werden mit Bezug auf die Forschungsfragen interpretiert und Hypothesen aufgestellt. Die Analyse konzentriert sich auf das Informationsverhalten, die Nutzung von Krankenhausserien, das Ärzt*innenbild, die Gesundheitsvorsorge und das Geschlechterrollenverständnis.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Gesundheitskommunikation, Entertainment Education, Krankenhausserien, Arztbild, Rollenverständnis, Mediziner*innen, Nicht-Mediziner*innen, „Charité“, Schulmedizin, Alternativmedizin, Informationsverhalten, Gesundheitsverhalten, Geschlechterrollen.
- Quote paper
- Romana Hofmann (Author), 2019, Die unterschiedliche Wirkung von Arzt- und Krankenhausserien auf MedizinerInnen und Nicht-MedizinerInnen. Am Beispiel der Krankenhausserie „Charité“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/499053