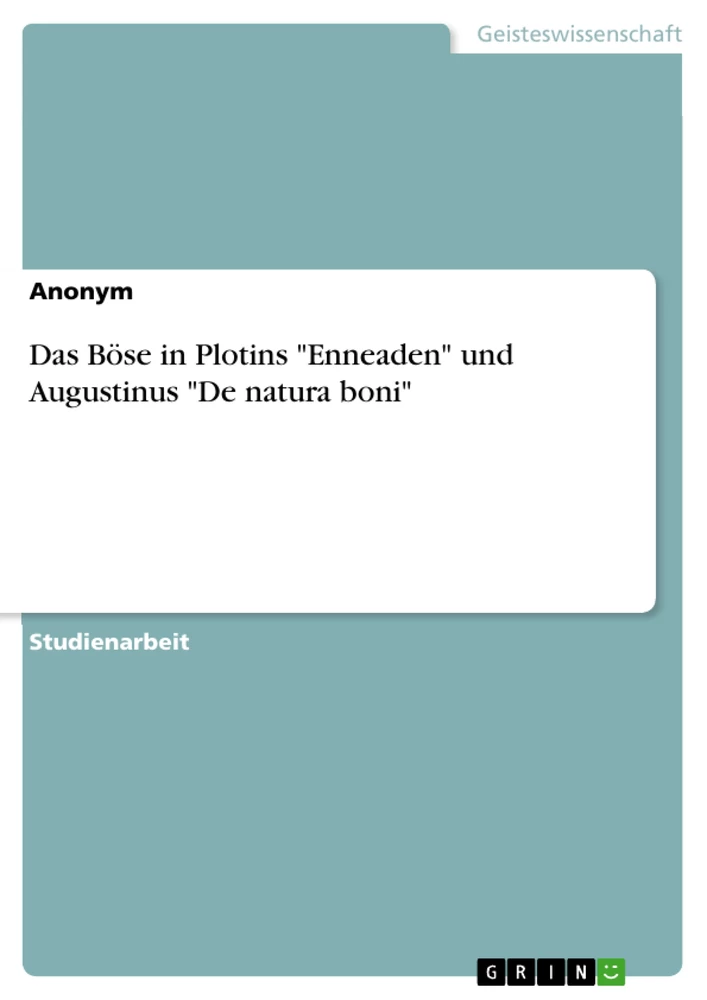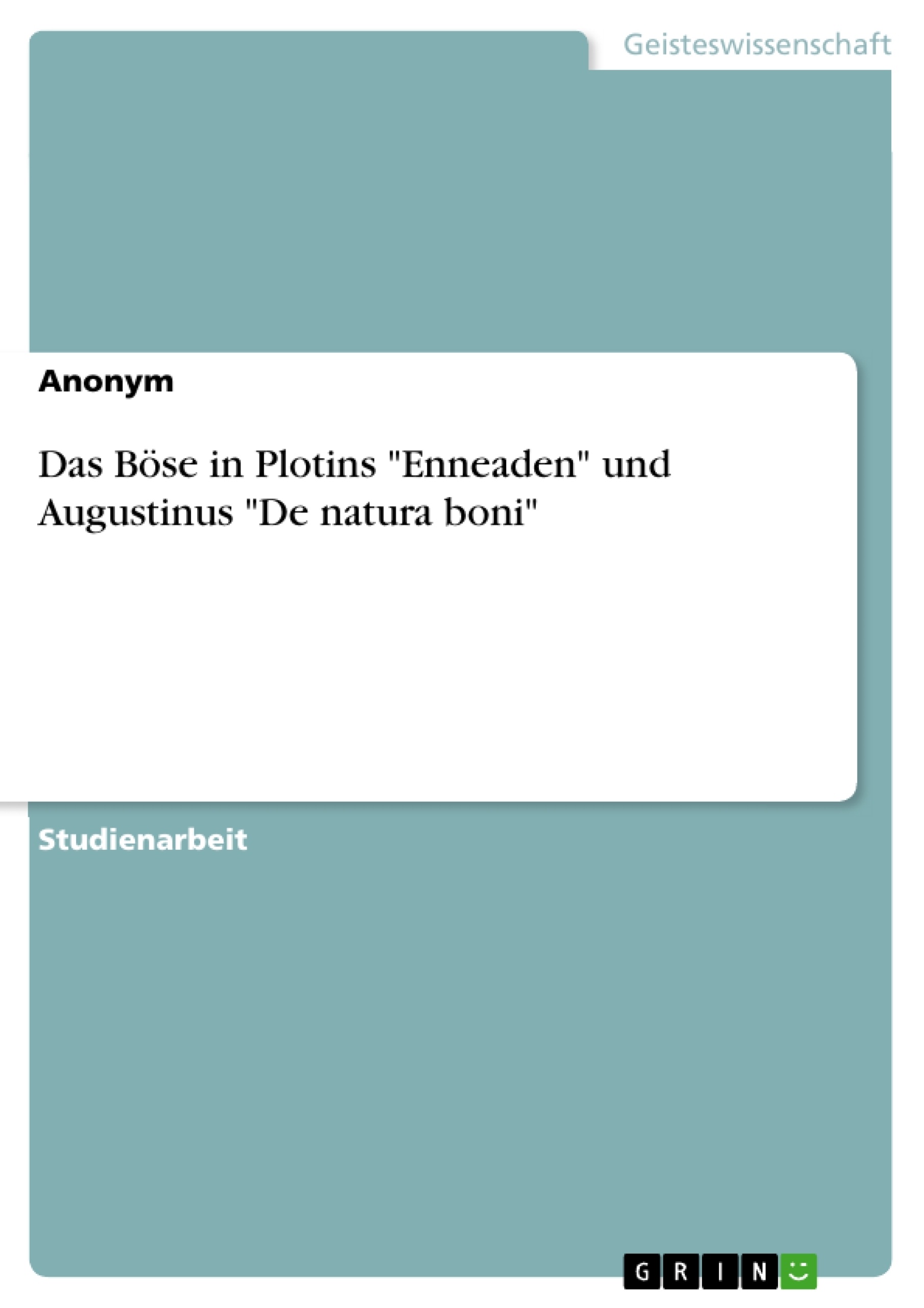Diese Arbeit beschäftigt mit zwei Denkern, die sich zur Thematik des Bösen geäußert haben, dem Neuplatoniker Plotin und dem Philosophen Augustinus. Diese beiden Darstellungen, die miteinander abgewogen werden sollen, zeigen zwei unterschiedliche Herangehensweisen an das Böse. Die "Enneaden" des Plotin oder die "De natura Boni" des Augustinus liegen zeitlich zwar nah beieinander, doch veranschaulichen diese Darstellungen, wie komplex die Thematik des Bösen doch ist. Plotin zeigt uns eine Möglichkeit auf, das Böse in der materiellen Welt zu verankern und wie die Menschen von ihren materiellen Begierden geblendet werden. Augustinus wiederum argumentiert mit der freien Entscheidung, die Gott den vernunftbegabten Menschen gegeben hat, ob wir uns gut oder böse verhalten sollen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Böse
- Plotin
- Das κακó
- Notwendigkeit des Bösen?
- Augustinus
- Das malum
- Die Hyle
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage nach dem Bösen in der Philosophie, und zwar anhand der Werke von Plotin und Augustinus. Das Ziel ist es, die unterschiedlichen Herangehensweisen der beiden Denker zu dieser Thematik aufzuzeigen und ihre jeweiligen Antworten auf die Frage „Woher kommt das Böse?“ zu analysieren.
- Die Definition des Bösen in der Philosophie
- Die Rolle des κακó bei Plotin und des malum bei Augustinus
- Die Bedeutung der Hyle in Augustinus' Philosophie
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Plotin und Augustinus
- Die Bedeutung des Themas „Böses“ in der Geschichte der Philosophie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema „Das Böse“ ein und beleuchtet die Bedeutung und die verschiedenen Positionen zur Frage des Bösen in der Geschichte der Philosophie. Kapitel 1 widmet sich der Klärung des Begriffs „Böses“ in der Philosophie und stellt verschiedene Thesen und Antithesen zur Definition des Bösen vor. Kapitel 2 befasst sich mit Plotins Konzept des Bösen, insbesondere dem „κακó“, und untersucht, ob das Böse in seiner Philosophie notwendig ist. Kapitel 3 beschäftigt sich mit Augustinus' Philosophie des Bösen, insbesondere mit dem „malum“ und der „Hyle“. Die Arbeit soll im letzten Kapitel die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Plotin und Augustinus im Hinblick auf ihre jeweiligen Positionen zum Thema „Das Böse“ hervorheben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Begriffen „Böses“, „κακó“, „malum“, „Hyle“, „Theodizee“, „Neuplatonismus“, „Augustinus“, „Plotin“ und „Philosophie“. Dabei stehen die philosophischen Konzepte der beiden Denker Plotin und Augustinus im Fokus, wobei die Untersuchung ihrer jeweiligen Positionen zum Thema „Das Böse“ im Vordergrund steht.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die zentralen Unterschiede zwischen Plotin und Augustinus bezüglich des Bösen?
Plotin verankert das Böse primär in der materiellen Welt und der Hyle, während Augustinus das Böse als Ergebnis der freien Entscheidung des Menschen (malum) interpretiert, die Gott ihm gegeben hat.
Welche Rolle spielt der Begriff „Hyle“ bei Augustinus?
In Augustinus' Philosophie wird die Hyle im Kontext der Entstehung des Bösen und der Materie untersucht, wobei er sich kritisch mit neuplatonischen Ansätzen auseinandersetzt.
Was bedeutet „κακó“ in Plotins Enneaden?
Das κακó bezeichnet bei Plotin das Prinzip des Bösen, das oft mit der Materie und dem Mangel an Form oder Gutem gleichgesetzt wird.
Ist das Böse laut Plotin in der Welt notwendig?
Die Arbeit untersucht, ob das Böse als notwendiger Bestandteil der hierarchischen Weltordnung Plotins angesehen werden muss, um die Abgestufterheit des Seins zu erklären.
Wie definiert Augustinus das „malum“?
Augustinus definiert das malum (das Böse) nicht als eigenständige Substanz, sondern als Beraubung des Guten (privatio boni), die durch den Fehlgebrauch des freien Willens entsteht.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2015, Das Böse in Plotins "Enneaden" und Augustinus "De natura boni", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/499088