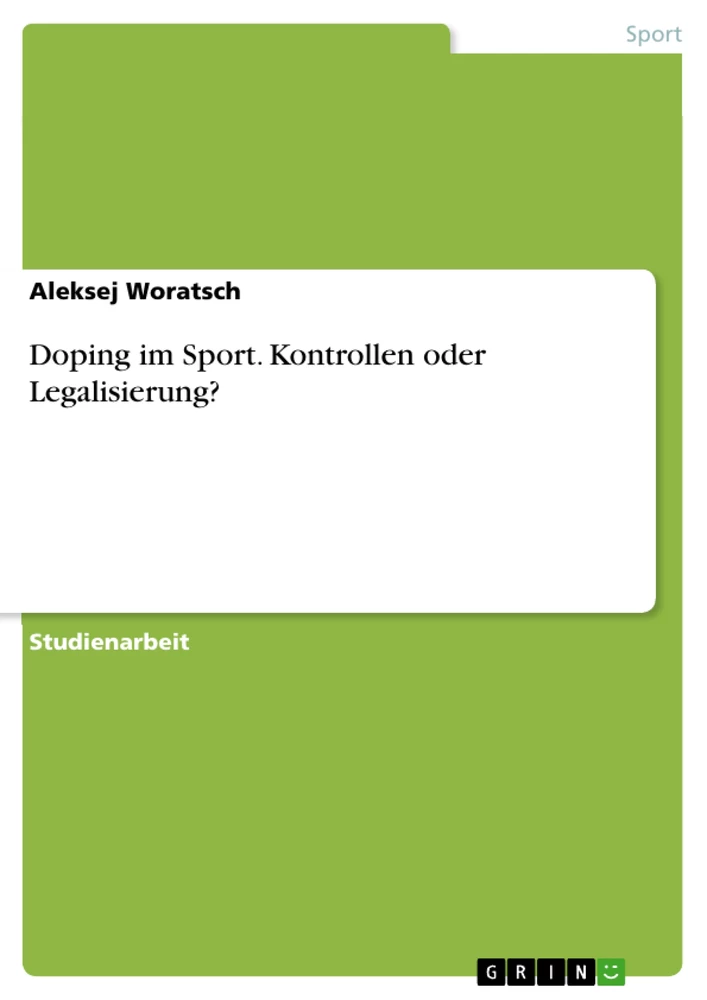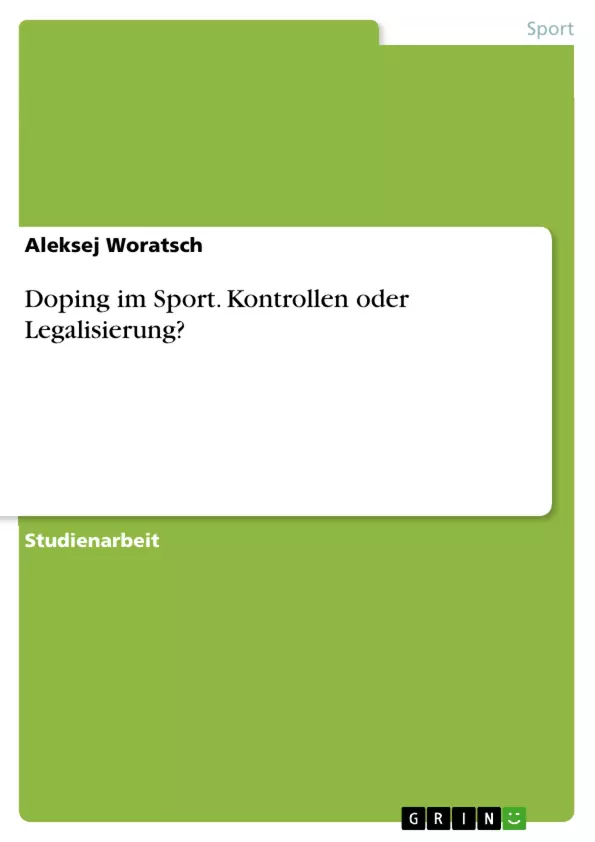In dieser Arbeit geht es um Doping im Leistungssport. Zunächst werden die Definition und der Ursprung des Dopings thematisiert. Anschließend nennt der Autor Antriebsgründe beziehungsweise Motivationsgründe von Athleten, die für das Doping ausschlaggebend sind. Der Fokus liegt hierbei auf dem, auf verschiedenen Ebenen vorkommenden, Leistungsdruck. Danach werden die Risiken des Dopings beleuchtet. Mit Hilfe der Nennung eines Extremfalls werden die biologischen Nebenwirkungen aufgeführt. Der Autor beleuchtet außerdem die Folgen des Dopings für den Leistungssport und die Folgen des Missbrauchs für den Normalbürger.
Abschließend werden die Erfahrungen des ehemaligen Profiradsportlers Tyler Hamilton, die er in seinem Buch "Die Radsport Mafia" schildert, beleuchtet. Anhand dessen wird ersichtlich, inwiefern Anti-Doping Agenturen wie der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) die Hände gebunden sind. Der Autor verdeutlicht, dass die derzeitige Anti-Doping Politik kaum bis keinerlei Wirkung hat, da Athleten sowie Mediziner stetig Wege finden, Dopingkontrollen zu bestehen beziehungsweise zu umgehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition und Ursprung des Dopings
- Motivation
- Risiken des Dopings
- Dopingkontrollen und deren Probleme
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung befasst sich mit der Problematik des Dopings im Leistungssport und beleuchtet dessen Ursachen, Folgen und die Herausforderungen, die sich aus Dopingkontrollen ergeben.
- Definition und Ursprung des Dopings
- Motivationsgründe für Doping
- Risiken von Doping für Athleten und die Gesellschaft
- Die Ineffizienz der aktuellen Anti-Doping-Politik
- Die Frage nach der Sinnhaftigkeit von Dopingkontrollen und der Legalisierung von Doping
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Der Text stellt die Relevanz des Themas Doping im Kontext von Leistungssport und gesellschaftlichem Druck auf Schönheitsideale dar. Die Ausarbeitung fokussiert auf Doping im Leistungssport und verfolgt eine systematische Herangehensweise, die mit der Definition und dem Ursprung des Dopings beginnt.
Definition und Ursprung des Dopings
Dieses Kapitel definiert Doping anhand der Vorgaben der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) und beleuchtet die historische Entwicklung des Dopings, beginnend im 18. Jahrhundert mit Aufputschmitteln im Pferdesport.
Motivation
Dieses Kapitel analysiert die Motivationsgründe für Doping, insbesondere den gesellschaftlichen Druck auf Sportler hinsichtlich Leistungserfolgs und die damit verbundene Dopingspirale. Es beleuchtet sowohl intrinsische als auch extrinsische Faktoren, die Athleten zum Medikamentenmissbrauch treiben.
Risiken des Dopings
Dieses Kapitel diskutiert die Risiken des Dopings für den Körper und die Gesellschaft. Es beleuchtet die biologischen Nebenwirkungen des Dopings und analysiert die Folgen des Missbrauchs von Dopingmitteln, sowohl im Sport als auch im Alltag.
Schlüsselwörter
Doping im Leistungssport, WADA, Motivation, Risiken, Dopingkontrollen, Legalisierung, Leistungssteigerung, Medikamentenmissbrauch, Gesellschaftlicher Druck, Anti-Doping-Politik.
- Quote paper
- Aleksej Woratsch (Author), 2017, Doping im Sport. Kontrollen oder Legalisierung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/499406