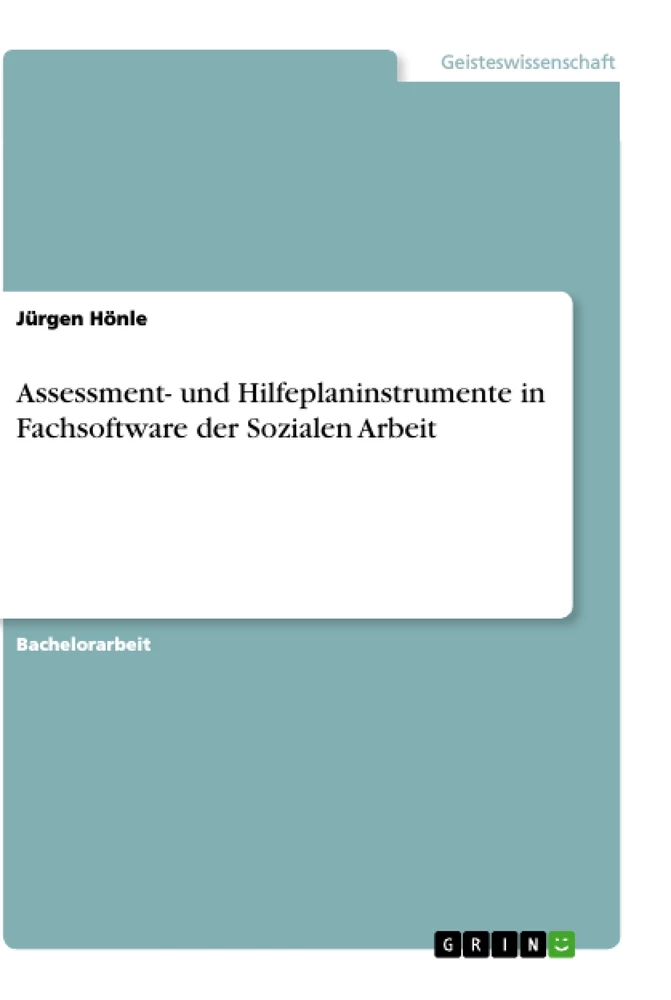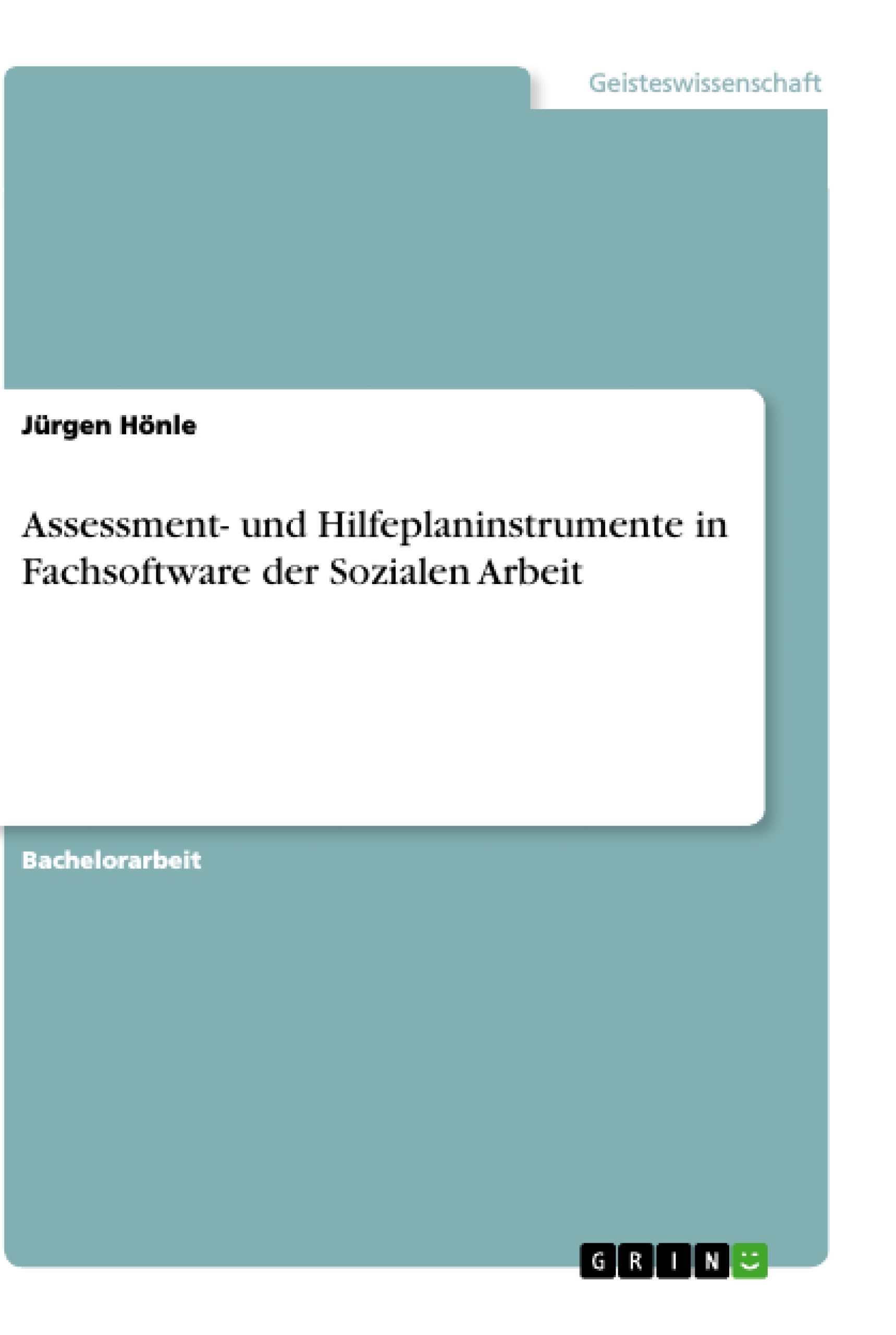Die Arbeit befasst sich mit IT-gestützten Assessment- und Hilfeplaninstrumenten in der Sozialen Arbeit, insbesondere im Bereich der ambulanten Suchtkrankenhilfe. Die Konzeption sowie die Programmimplementierung eines Instrumentariums, das sich sowohl an fachlichen Standards als auch an den Hilfeprozessen der Praxis orientiert, wird vorgestellt. Dadurch soll eine bessere IT-Unterstützung und weitere Professionalisierung der direkten Klientenarbeit ermöglicht werden.
Durch eine elektronische Abbildung und Dokumentation von Arbeitsabläufen kann die Qualität, Effektivität und Effizienz der Sozialarbeit auf unterschiedlichen Ebenen wesentlich verbessert werden.
Inhaltsverzeichnis
- VORWORT
- ZIEL UND VORGEHENSWEISE DER ARBEIT
- ERSTE THEMATISCHE ANNÄHERUNG
- Klärung der zentralen Begrifflichkeiten
- Grenzen, Risiken und Chancen IT-gestützter Instrumente
- Allgemeine Anforderungskriterien an ein Instrument
- RECHTLICHE, THEORETISCHE UND METHODISCHE GRUNDLAGEN
- Rechtlicher Rahmen
- Theoretischer Rahmen
- Erklärungsmodell der Sucht
- Lebens- und Problemlagen der Zielgruppe
- Zielformulierungen der ambulanten Suchthilfe
- Methodischer Rahmen
- Assessment
- Planung und Evaluation
- KONZEPTION DES ASSESSMENT- UND HILFEPLANINSTRUMENTS
- Kriterien und Klassifikation der Problembereiche
- Kriterien und Klassifikation der Änderungsmotivation
- IMPLEMENTIERUNG UND ANWENDUNG
- Kurzbeschreibung des Programms Horizont 4.0
- Übertragung der Konzeption in die Programmstruktur
- Exemplarische Anwendung des Instruments
- FAZIT UND AUSBLICK
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Konzeption und Implementierung von IT-gestützten Assessment- und Hilfeplaninstrumenten in der ambulanten Suchthilfe. Ziel ist die Entwicklung eines Instrumentariums, das sowohl fachliche Standards als auch die Hilfeprozessen in der Praxis berücksichtigt. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen und Chancen der IT-gestützten Arbeit in der Sozialen Arbeit und untersucht, wie die Komplexität der Suchtproblematik und der Hilfeplanung in Softwarelösungen sinnvoll abgebildet werden kann.
- Relevanz von Assessment- und Hilfeplaninstrumenten in der Suchthilfe
- Analyse der Anforderungen und Herausforderungen der IT-gestützten Arbeit in der Sozialen Arbeit
- Entwicklung eines Konzepts für ein IT-gestütztes Assessment- und Hilfeplaninstrument
- Übertragung des Konzepts in die Programmstruktur der Fachsoftware Horizont 4.0
- Exemplarische Anwendung des Instruments in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Klärung der zentralen Begrifflichkeiten und einer Analyse der Grenzen, Risiken und Chancen von IT-gestützten Instrumenten in der Sozialen Arbeit. Kapitel 2 beleuchtet den rechtlichen, theoretischen und methodischen Rahmen der ambulanten Suchthilfe. Hier werden Erklärungsmodelle der Sucht sowie Lebens- und Problemlagen der Zielgruppe behandelt. Kapitel 3 widmet sich der Konzeption des Assessment- und Hilfeplaninstruments und definiert die Kriterien und Klassifikationen der Problembereiche und der Änderungsmotivation. Kapitel 4 beschreibt die Implementierung und Anwendung des Instruments in der Fachsoftware Horizont 4.0 und zeigt anhand von Beispielen die praktische Anwendung des Instruments auf.
Schlüsselwörter
Assessment, Hilfeplanung, Suchthilfe, IT-gestützte Instrumente, Fachsoftware, Horizont 4.0, ambulante Suchtkrankenhilfe, Erklärungsmodell der Sucht, Lebens- und Problemlagen, Änderungsmotivation.
Häufig gestellte Fragen
Was sind IT-gestützte Assessment-Instrumente in der Sozialarbeit?
Es handelt sich um Softwarelösungen, die Sozialarbeiter dabei unterstützen, die Problemlagen und Ressourcen von Klienten systematisch zu erfassen und zu dokumentieren.
Wie hilft die Fachsoftware „Horizont 4.0“ in der Suchthilfe?
Die Software bildet den gesamten Hilfeprozess digital ab – von der Erstanamnese über die Hilfeplanung bis hin zur Evaluation der Ergebnisse.
Welche Vorteile bietet die elektronische Dokumentation?
Sie verbessert die Qualität, Effektivität und Effizienz der Sozialarbeit, ermöglicht eine bessere Übersicht über Fallverläufe und erleichtert die Professionalisierung der Klientenarbeit.
Was wird unter „Änderungsmotivation“ im Assessment verstanden?
Das Instrument klassifiziert, wie bereit ein Klient ist, sein Verhalten (z.B. Suchtmittelkonsum) zu ändern, um die passenden pädagogischen Maßnahmen auszuwählen.
Gibt es Risiken bei der Nutzung von IT in der Sozialen Arbeit?
Die Arbeit thematisiert auch Grenzen und Risiken, wie etwa den Datenschutz oder die Gefahr, dass die Technik die persönliche Beziehung zum Klienten überlagert.
- Citar trabajo
- Jürgen Hönle (Autor), 2010, Assessment- und Hilfeplaninstrumente in Fachsoftware der Sozialen Arbeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/499415