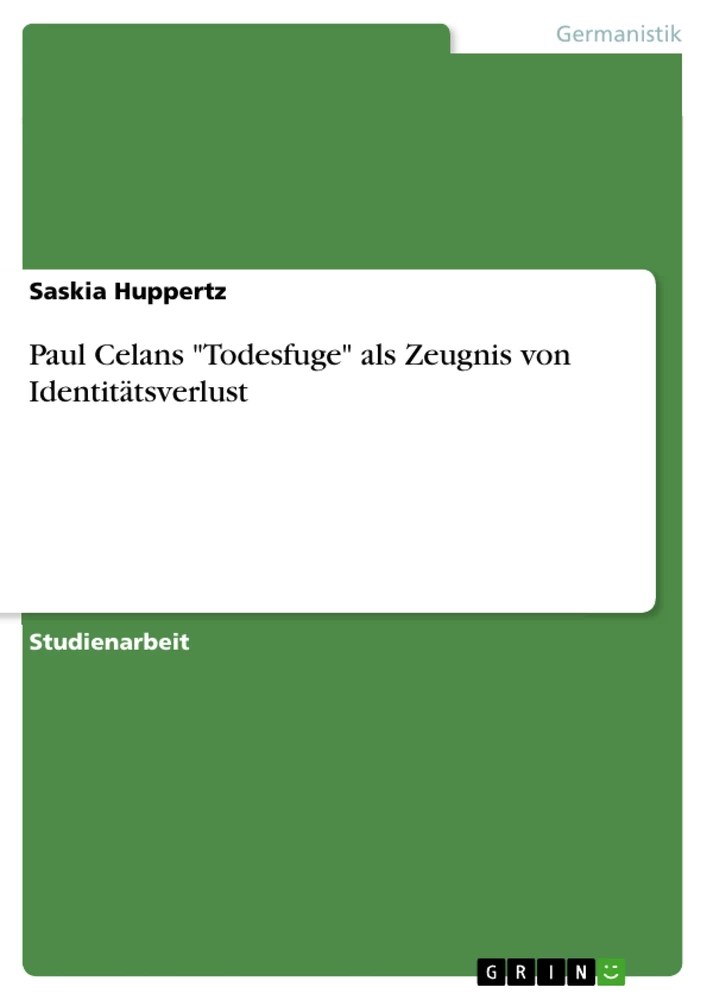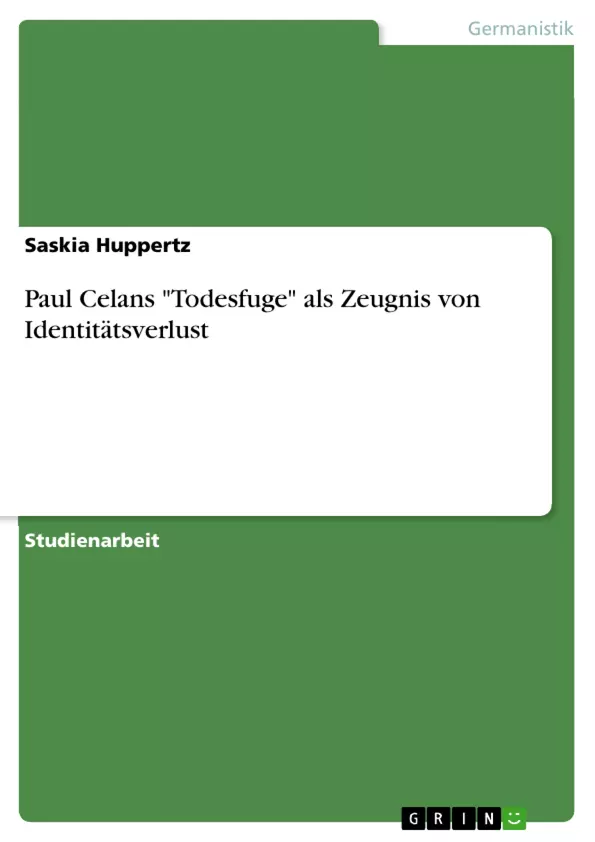In einer Zeit, in der die Öffentlichkeit sich der Amnesie hingab, um die Verbrechen, die während des Holocausts begangen worden waren, hinter sich lassen zu können, statuierte Celan mit der ersten Veröffentlichung des Gedichtes "Todesfuge" 1947 ein Exempel gegen das Vergessen.
Die vieldimensionale Art und Weise, in der das Gedicht ungeniert die Greuel des Holocausts und das damit verbundene Schicksal der europäischen Juden, das zugleich sein eigenes war, verbalisiert und damit zurück in das öffentliche Gedächtnis rief (und immer noch ruft), entfachte einen Orkan unter den Kritikern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Czernowitz - die „östlichste\" Metropole der Bukowina hatte einen auffallend „,westlichen“ Charakter
- 1.1 Der Verlust von Eltern und Heimat leiten bei Celan einen Identitätskonflikt ein, der in „Todesfuge“ deutlich zutage tritt
- 1.2 Das Wiedertreffen mit Immanuel Weißglas und anderen Dichterkollegen in Czernowitz 1944 regen die Entstehung von „Todesfuge“ an
- 2. Die Prägung durch das Czernowitz der 1920er und 1930er Jahre bilden erste Voraussetzungen für die Entstehung von „Todesfuge“
- 3. Die „Todesfuge“ ist Zeugnis des Leidens
- 4. Ergebnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Entstehungsgeschichte von Paul Celans Gedicht „Todesfuge“ und beleuchtet die spezifischen Entwicklungen im Leben des Autors, die maßgeblich zu dessen Entstehung beigetragen haben.
- Die Rolle von Czernowitz als kultureller und historischer Kontext für Celans Werk
- Die Bedeutung der Familiengeschichte und der frühen Prägungen für Celans Lyrik
- Die Auswirkungen des Holocausts und die sprachliche Verarbeitung des Leids in „Todesfuge“
- Die Verwendung der deutschen Sprache im Kontext der Shoah
- Die Verbindung von Geschichtswissenschaft und Literatur in der Analyse von „Todesfuge“
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 beleuchtet die kulturhistorische Entwicklung von Czernowitz bis zum Fall der Habsburgermonarchie 1918 und analysiert die besondere Attraktivität der Bukowina für die jüdische Bevölkerung. Kapitel 2 befasst sich mit biographischen Aspekten Celans und untersucht die prägenden Einflüsse seiner Kindheit und Jugend in Czernowitz. Es wird gezeigt, wie die spezifischen Entwicklungen der 1920er und 1930er Jahre den Grundstein für seine spätere Lyrik und insbesondere für die Entstehung der „Todesfuge“ legten.
Schlüsselwörter
Paul Celan, Todesfuge, Czernowitz, Bukowina, Holocaust, deutsche Sprache, Literatur, Geschichtswissenschaft, interdisziplinäre Forschung, Entstehungsgeschichte, biografische Analyse.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Thema der Analyse von Celans „Todesfuge“?
Die Arbeit untersucht das Gedicht als Zeugnis von Identitätsverlust und als sprachliche Verarbeitung der Gräuel des Holocausts.
Welche Rolle spielt die Stadt Czernowitz für das Werk?
Czernowitz war Celans Heimat und prägte ihn kulturell. Der Verlust dieser Heimat und seiner Eltern leitete einen Identitätskonflikt ein, der in der „Todesfuge“ sichtbar wird.
Wann wurde die „Todesfuge“ erstmals veröffentlicht?
Das Gedicht wurde erstmals im Jahr 1947 veröffentlicht und wirkte als Exempel gegen das Vergessen der Shoah.
Wie verarbeitet Celan das Leid sprachlich?
Celan nutzt die deutsche Sprache – die Sprache der Täter – um das Schicksal der europäischen Juden zu verbalisieren und ins öffentliche Gedächtnis zurückzurufen.
Welche Einflüsse regten die Entstehung des Gedichts 1944 an?
Das Wiedertreffen mit Dichterkollegen wie Immanuel Weißglas in Czernowitz nach den Kriegswirren gilt als wichtiger biografischer Impuls.
- Quote paper
- Saskia Huppertz (Author), 2018, Paul Celans "Todesfuge" als Zeugnis von Identitätsverlust, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/499812