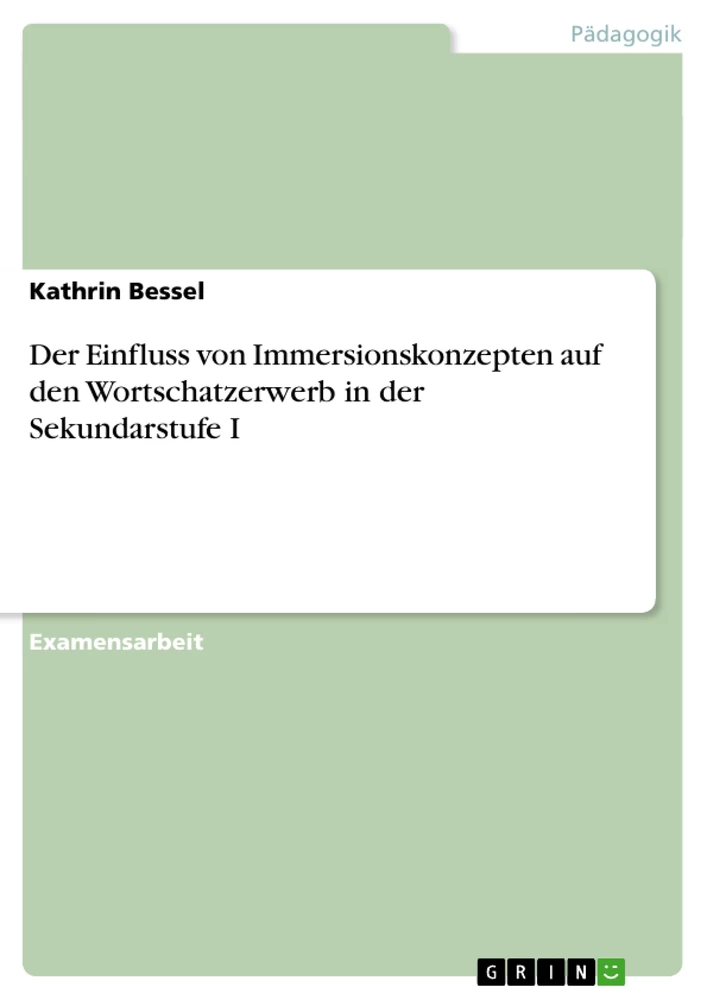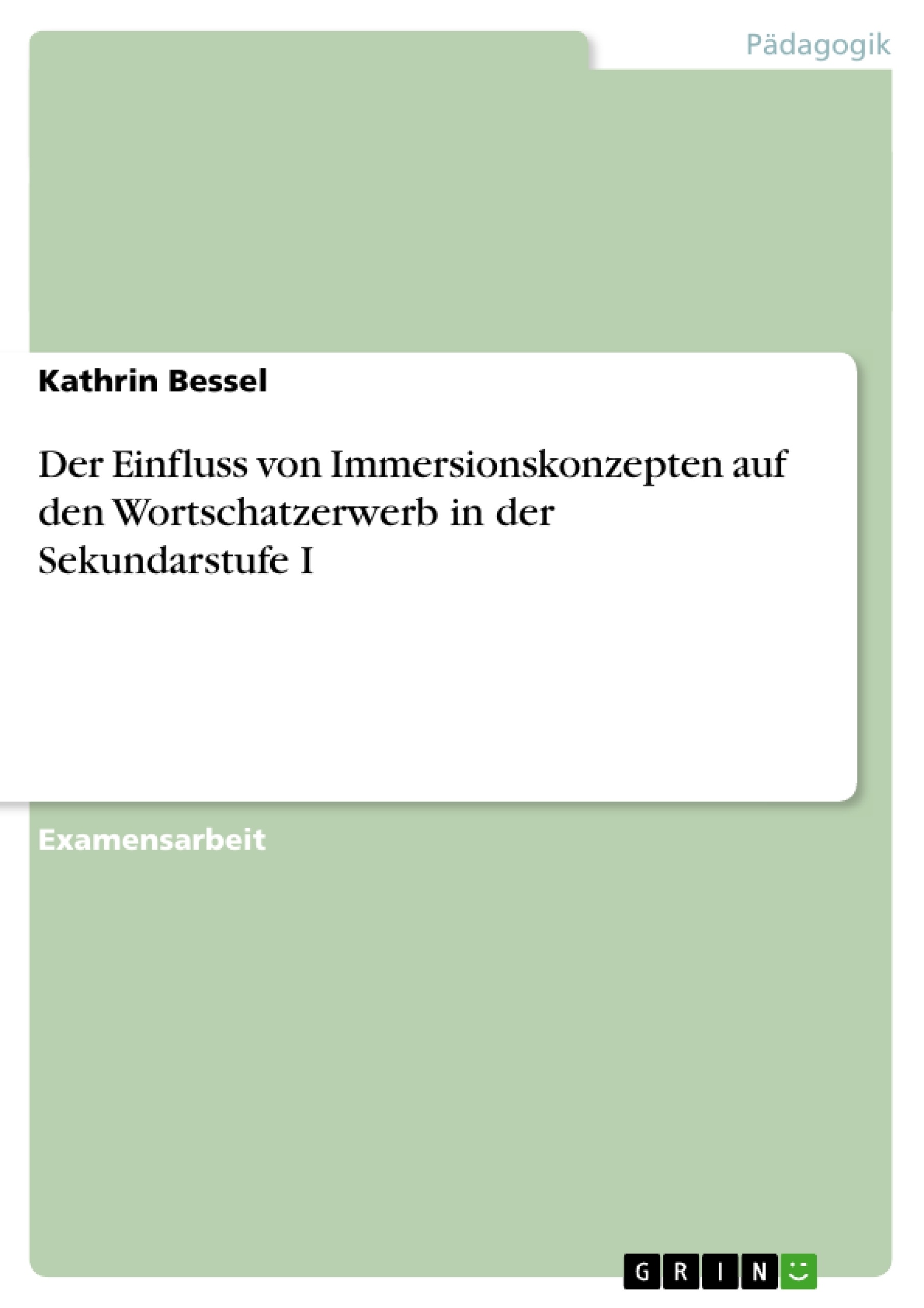Mit der im Mai 2004 erfolgten EU-Erweiterung um 12 weitere Staaten ist auch die Sprachenvielfalt der Europäischen Union bereichert worden. In den nun 25 Mitgliedsstaaten wird in insgesamt 20 Amtssprachen und über 60 so genannten Regional- oder Minderheitensprachen kommuniziert. Eine dieser Sprachen zur alleinigen Amtssprache zu erklären ist weder vorgesehen noch würde es dem Subsidiaritätsprinzip der EU gerecht werden, denn die Bewahrung der Sprachenvielfalt in der Europäischen Union ist ebenso wichtig wie Erhalt und Förderung der kulturellen Vielfalt und mit Artikel 22 der „Charter of Fundamental Rights of the European Union“ sogar gesetzlich festgelegt: „The Union shall respect cultural, religious and linguistic diversity“.
Neben ihrem Erhalt ist auch die Förderung der Mehrsprachigkeit als „wesentliches Element [...] der europäischen Identität“ erklärtes Ziel der Europäischen Union. So wird im Weißbuch von 1995 formuliert, dass die Bürger Europas drei Gemeinschaftssprachen beherrschen sollten, zwei weitere also neben ihrer Muttersprache. Dies soll neben einer Stärkung des Zugehörigkeitsgefühls zur EU gewährleisten, dass die Unionsbürger die Chancen der EU nutzen und sich frei im europäischen Binnenmarkt bewegen können.
Diese Ziele werden von einer Mehrheit der Europäer befürwortet. 72% der Befragten erklärten, dass sie Kenntnisse in Fremdsprachen für nützlich halten und 53% geben an, neben ihrer Muttersprache mindestens eine weitere Sprache zu sprechen. Jedoch lediglich 26% besitzen Kenntnisse in insgesamt drei Sprachen.
Auch wenn dieses Ergebnis nicht entmutigen muss, so bleibt es vom Ziel des Weißbuchs zunächst weit entfernt.
Entsprechend trifft man auch in Deutschland auf die Forderung nach einer Erweiterung des derzeitigen Spektrums der in den Schulen angebotenen Sprachen. Schüler sollen nach Möglichkeit mehr als eine Fremdsprache erlernen und dabei ein hohes sprachliches Niveau erreichen können.
Gemäß den Zielen der EU soll Mehrsprachigkeit dabei kein Privileg der Elite darstellen und innerhalb der Schulzeit zu erreichen sein, ohne dass der Stundenanteil des Fremdsprachenunterrichts (FU) auf Kosten anderer Fächer erhöht wird und langfristig zusätzlicher Zeitaufwand für Schüler und Lehrer entsteht. Diesem Wunsch kommen Immersion (IM) und bilingualer Unterricht (BIU) entgegen, da hier anstelle, bzw. über den FU hinaus, in Sachfächern, wie z. B. Geographie oder Mathematik, die Fremdsprache als Unterrichtssprache eingesetzt wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINLEITUNG
- 2 IMMERSION
- 2.1 Begriffsbestimmung
- 2.2 Konzeptionen
- 2.2.1 Beginn und Intensität von IM
- 2.2.1.1 Early Immersion
- 2.2.1.2 Delayed Immersion
- 2.2.1.3 Late Immersion
- 2.2.2 Additive Immersion
- 2.2.2.1 Reziproke Immersion (Two-way immersion)
- 2.2.2.2 Doppelte Immersion (Double Immersion)
- 2.2.2.3 Intensive English
- 2.2.2.4 Immersion in Modulen
- 2.2.3 Subtraktive Immersion
- 2.3 Vorbehalte gegenüber Immersion und Mehrsprachigkeit
- 2.4 Leistungsfähigkeit von Immersion
- 2.4.1 Resultate für die L1
- 2.4.1.1 Kommunikative Kompetenzen
- 2.4.1.2 Rezeptive und produktive Kompetenzen
- 2.4.1.3 Fachwissen
- 2.4.2 Resultate für die L2
- 2.4.2.1 Rezeptive Kompetenzen
- 2.4.2.2 Produktive Kompetenzen
- 2.4.2.3 Kommunikative Kompetenzen
- 2.4.3 Weitere Ergebnisse
- 2.5 Zusammenfassung
- 3 WORTSCHATZ: ORGANISATION UND ERWERB
- 3.1 Das mentale Lexikon
- 3.1.1 Leistung des mentalen Lexikons
- 3.1.2 Zur Organisation des mentalen Lexikon
- 3.1.3 Zugriff auf Lexikoneinträge
- 3.1.3.1 Wortproduktion
- 3.1.3.2 Worternkennung
- 3.1.3.3 Back-up store und lexical tool-kit
- 3.2 Wortschatzerwerb
- 3.2.1 L1-Wortschatzerwerb
- 3.2.1.1 Labelling
- 3.2.1.2 Packaging
- 3.2.1.3 Network-building
- 3.2.2 Wortbedeutung
- 3.2.2.1 Fixed vs. fuzzy meaning
- 3.2.3 Besonderheiten des L2-Wortschatzerwerbs
- 3.2.3.1 Lexikalische Kompetenz
- 3.2.3.2 Deklaratives und prozedurales Wissen
- 3.2.3.3 Die Hürde der Idiomatik
- 3.3 Das mehrsprachige mentale Lexikon
- 3.3.1 Zwei Lexika - zwei Funktionsweisen?
- 3.3.2 Zwei Lexika – integriert oder separat?
- 3.4 Zusammenfassung
- 4 WORTSCHATZERWERB IM BIU
- 4.1 Einbettung des Kapitels in den Kontext der Arbeit
- 4.2 Mündlicher Wortschatz bilingual und konventionell unterrichteter Schüler im Vergleich
- 4.2.1 Methodisches Vorgehen
- 4.2.1.1 Vergleichsgruppen
- 4.2.1.2 Produktionstest ADD
- 4.2.1.3 Raster zur Wortschatzanalyse
- 4.2.2 Ergebnisse des ADD-Tests
- 4.2.2.1 Umfang des Wortschatzes
- 4.2.2.2 Lexikalische Fehler
- 4.2.2.3 Inputressourcen
- 4.2.2.4 Kontextuelle Äquivalente
- 4.2.2.5 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 4.3 Bedeutung von BIU für den Wortschatzerwerb
- 4.3.1 Ein Plus an spracherwerbsrelevanten Aspekten
- 4.3.1.1 Input und Output
- 4.3.1.2 Verknüpfungen im mentalen Lexikon
- 4.3.1.3 Authentizität und Kontextualisierung
- 4.4 Zusammenfassung
- 5 FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von Immersionskonzepten auf den Wortschatzerwerb in der Sekundarstufe I. Sie analysiert die Funktionsweise von Immersionsprogrammen und ihre Auswirkungen auf die sprachliche Entwicklung von Schülern, insbesondere im Hinblick auf den Wortschatzerwerb.
- Begriffsbestimmung und Konzeptionen von Immersion
- Wortschatzerwerbsprozesse im Vergleich zwischen einsprachigen und mehrsprachigen Lernerfahrungen
- Bewertung der Effizienz von Immersionskonzepten für den Wortschatzerwerb in der Sekundarstufe I
- Analyse der Rolle von Input und Output in Immersionsprogrammen
- Die Bedeutung von Kontextualisierung und Authentizität im Wortschatzerwerb
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung - Einführung in das Thema und die Forschungsfrage
- Kapitel 2: Immersion - Definition, Konzeptionen und Leistungsfähigkeit
- Kapitel 3: Wortschatz: Organisation und Erwerb - Erläuterung der Funktionsweise des mentalen Lexikons und Wortschatzerwerbsprozessen
- Kapitel 4: Wortschatzerwerb im BIU - Untersuchung des Wortschatzerwerbs in bilingualen Immersionsprogrammen
Schlüsselwörter
Immersion, Wortschatzerwerb, Sekundarstufe I, Bilingualer Unterricht, Mehrsprachigkeit, Mentales Lexikon, Input, Output, Authentizität, Kontextualisierung
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Immersion im Fremdsprachenunterricht?
Immersion (Sprachbad) bedeutet, dass eine Fremdsprache als Arbeitssprache in Sachfächern wie Geographie oder Mathematik genutzt wird, anstatt sie nur als Unterrichtsfach zu behandeln.
Was ist der Unterschied zwischen „Early“ und „Late Immersion“?
Early Immersion beginnt bereits im Kindergarten oder der Grundschule, während Late Immersion erst in der Sekundarstufe (z. B. ab Klasse 7 oder 9) einsetzt.
Wie funktioniert das mentale Lexikon bei mehrsprachigen Personen?
Das Gehirn organisiert Wörter in Netzwerken. Bei Mehrsprachigen stellt sich die Frage, ob die Lexika separat oder integriert gespeichert sind und wie der Zugriff auf Lexikoneinträge erfolgt.
Welche Vorteile bietet bilingualer Unterricht (BIU) für den Wortschatz?
BIU führt zu einem größeren Wortschatzumfang, besserer Idiomatik und stärkeren Verknüpfungen im mentalen Lexikon durch authentische und kontextualisierte Sprachverwendung.
Was ist reziproke Immersion (Two-way immersion)?
Hierbei werden Schüler mit unterschiedlichen Muttersprachen gemeinsam unterrichtet, sodass beide Gruppen voneinander lernen und jeweils die Sprache der anderen Gruppe erwerben.
- Quote paper
- Kathrin Bessel (Author), 2004, Der Einfluss von Immersionskonzepten auf den Wortschatzerwerb in der Sekundarstufe I, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49984