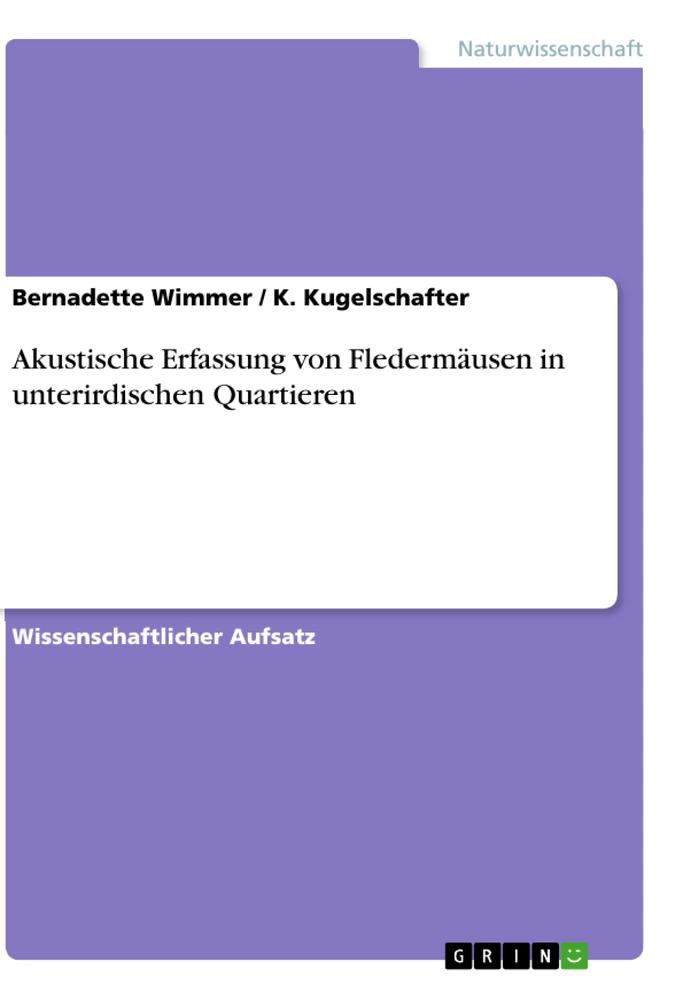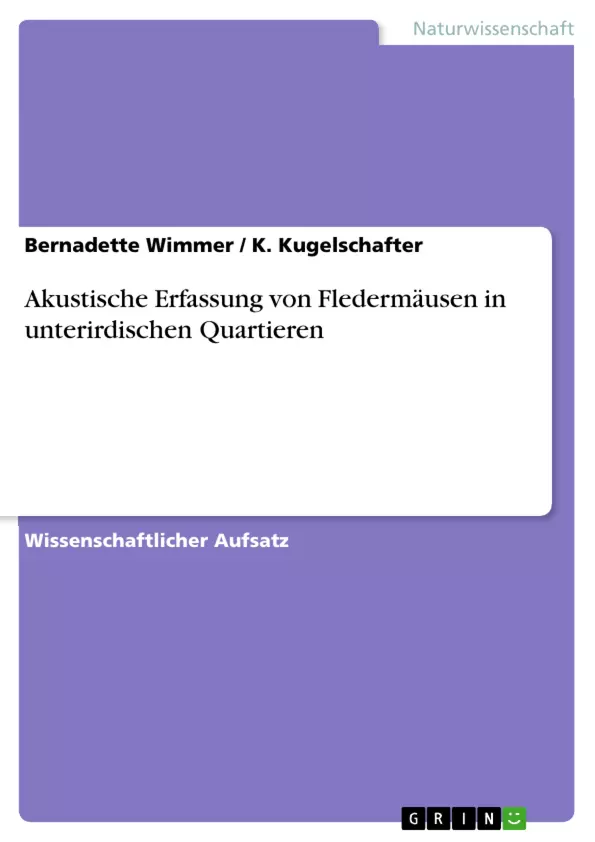In der vorliegenden Untersuchung werden bei Fotomonitoring-Untersuchungen akustische Referenzaufnahmen verschiedener Fledermausarten gewonnen und Rufparameter vermessen. Ziel ist es, eine brauchbare Bestimmungshilfe für Rufe an unterirdischen Quartieren zu schaffen. Es werden Chancen und Grenzen akustischer Erhebungen an unterirdischen Quartieren aufgezeigt und Empfehlungen für das Untersuchungsdesign gegeben. Dabei stellt die akustische Langzeit-Erfassung von Fledermäusen in unterirdischen Quartieren je nach Fragestellung eine sinnvolle Ergänzung oder sogar Alternative zu herkömmlichen Nachweis-Methoden dar. Um neben der Aktivität auch die Artzusammensetzung erfassen zu können, ist jedoch eine intensivere Kenntnis der Rufe der verschiedenen Fledermausarten an diesen Quartieren Voraussetzung.
Inhalt
Zusammenfassung...1
1. Einleitung...1
2. Methodik...2
3. Ergebnisse...5
4. Diskussion...40
5. Ausblick...42
6. Literatur...43
Zusammenfassung:
Die akustische Langzeit-Erfassung von Fledermäusen wurde in den letzten Jahren technisch enorm weiterentwickelt und stellt auch an unterirdischen Quartieren je nach Fragestellung eine sinnvolle Ergänzung oder sogar Alternative zu herkömmlichen Methoden dar. Um neben der Aktivität auch die Artzusammensetzung erfassen zu können, ist jedoch eine intensivere Kenntnis der Rufe der verschiedenen Fledermausarten an diesen Quartieren Voraussetzung. In der vorliegenden Untersuchung wurden bei Fotomonitoring-Untersuchungen akustische Referenzaufnahmen verschiedener Arten gewonnen und Rufparameter vermessen. Ziel war es, eine brauchbare Bestimmungshilfe für Rufe an unterirdischen Quartieren zu schaffen. Es werden Chancen und Grenzen akustischer Erhebungen an unterirdischen Quartieren aufgezeigt und Empfehlungen für das Untersuchungsdesign gegeben.
1. Einleitung
Akustische Dauerbeobachtungsmethoden können an unterirdischen Quartieren rel. effizient und störungsarm eingesetzt werden. Der gleichzeitige Vergleich der Intensität sowie des jahreszeitliches Verlaufes der Aktivität ermöglicht Aussagen zur Funktion und Bedeutung der Quartiere in einem Untersuchungsraum. Dabei stehen den Vorteilen der Methodik aber auch Nachteile gegenüber:
Vorteile:
- nahezu störungsfreie Methode
- ermöglicht Erkenntnisse auch über nicht betretbare Hohlräume
- keine Begehungen in gefährlichen Bereichen notwendig
- Aussagen zur Quartierfunktion möglich
- Vergleich der Aktivität an verschiedenen Quartieren möglich
Nachteile:
- Diebstahlgefahr für die Geräte
- Technik leidet durch Nässe
- hoher Aufwand für die manuelle Lautanalyse
- Unterscheidbarkeit mancher Arten schwierig oder unmöglich
- keine Aussagen zu Individuenzahlen möglich
Um Aussagen über die Artenzusammensetzung an den Quartieren treffen zu können, ist eine detaillierte Kenntnis von Ortungs- und Sozialrufen erforderlich. Die vorliegende Arbeit hat deshalb das Ziel, eine für Freilanduntersuchungen brauchbare Bestimmungshilfe zu schaffen.
1.1 Ortungsrufe
Aufgrund der spezifischen akustischen Erfordernisse nutzen Fledermäuse zur Nahorientierung meist kürzere Rufe in kürzeren Rufabständen und häufig in etwas höheren Frequenzbereichen als im freien Flug (z. B. Skiba, 2003). In der echoreichen Umgebung von Quartieren kommt hinzu, dass die Rufe oft relativ leise sind, vielleicht um lautstarke Echos von den Wänden zu vermeiden. Bei der Artbestimmung der Ortungsrufe an unterirdischen Quartieren erscheinen zunächst die Myotis-Arten besonders problematisch. Zur Nahorientierung nutzen Myotis-Arten extrem kurze, oft in einem höheren Frequenzbereich beginnende Rufe. Für Freiland-Aufnahmen hilfreiche Unterscheidungsmerkmale wie Ruflänge, Knicke, Hauptfrequenz und Rufabstand sind auf diese Situation i. d. R. nicht übertragbar. Selbst im Freiland leicht unterscheidbare Arten wie Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus), Braunes Langohr (Plecotus auritus) und Nordfledermaus (Eptesicus nilssonii) können aufgrund der Anpassung an die gleiche Rufsituation eine verblüffende Ähnlichkeit aufweisen (siehe 3.).
Jedoch soll in der vorliegenden Arbeit auch die gegenteilige These untersucht werden: Lassen sich die Ortungsrufe mancher Arten vielleicht sogar besser unterscheiden als im Freiland, wenn eine für alle Arten gleiche standardisierte Einflugssituation die artspezifischen Nahortungsrufe bzw. den artspezifischen idealen Hörbereich in dieser Situation erkennbar macht?
1.2 Sozialrufe
Da an Quartieren verstärkt Sozialrufe geäußert werden und diese häufig artspezifischer als die Ortungsrufe sind, erweitert deren Kenntnis die Möglichkeiten zur Artbestimmung. Während die Ortungsrufe unserer Fledermausarten im Freiland bereits gut untersucht sind, gibt es nur wenige Veröffentlichungen über die Vielfalt der Sozialrufe (z. B. Pfalzer, 2002, Middleton et. al., 2014). Soziallaute werden i. d. R. dadurch definiert, dass sie dem Zweck der Kommunikation dienen (z. B. Dawkins & Krebs, 1981). In der Praxis ist die Abgrenzung von Ortungs- und Sozialrufen jedoch nicht immer eindeutig (s. a. Barataud, 2015): Ortungsrufe können Informationen für andere Fledermäuse enthalten wie z. B. Buzz-Rufe, Informationen zum Geschlecht (z. B. Jones et al. 1992) usw.. Umgekehrt dienen Rufe, die in der Literatur als Sozialrufe beschrieben werden, auch der Echo-Orientierung: Beim Kreisen in Höhleneingängen können die Bogenrufe ("Spazierstockrufe") der Wasserfledermaus die üblichen Ortungsrufe ersetzen und dienen somit auch der Orientierung (vgl. Abb. 8G). Außerdem sind zahlreiche Übergangsformen von Sozial- und Ortungsrufen zu beobachten (vgl. Abb. 6 u. 7). Über die Funktion von Rufen, gerade wenn sie in Ruheposition ausgesendet werden, kann oftmals nur spekuliert werden, da hierzu noch wenig detaillierte Untersuchungen vorliegen. Nicht alle Rufe, die untypisch aussehen, müssen eine soziale Funktion haben. Beispielsweise könnten manche "misslungen" anmutenden Laute ruhender Kleiner Hufeisennasen auch der Vorbereitung auf den bevorstehenden Ausflug dienen („Naseputzen“, "Einstimmen", vgl. Abb. 58). Insbesondere wenn Beobachtungen zu einem sozialen Geschehen während der Rufaufzeichnung fehlen, liegt es im Auge des Betrachters, ob ein ungewöhnlicher Ruf als eine Variation eines Ortungsrufs oder als Sozialruf eingestuft wird.
Eine jahreszeitliche Häufung bestimmter Sozialrufe und das Vortragen komplexer "Gesänge" können jedoch Hinweise auf soziales Geschehen am Quartier sein.
2. Methodik
2.1 Aufnahmetechnik und Quartiere
Die Referenzrufe wurden an 10 Höhlen- und Stolleneingängen mit Batcordern aufgenommen. Die Artzuordnung erfolgte über zeitgleiche Fotos der ein- bzw. ausfliegenden Fledermäuse (zur Fotomonitoring- und Lichtschrankentechnik siehe Kugelschafter, 1995 u. 2009). Die unterschiedlich individuenreichen Winterquartiere wurden z. T. im Spätsommer/Herbst, z. T. im Winter und Frühjahr beprobt. Die Quartiere verteilen sich über Bayern (Angerlloch, Silberberg, Eck), Hessen (Grube Abendstern, Langhecke, Rosengartenstollen, Tiefgangstollen) und Baden-Württemberg (Hessenloch, Knappengrund, Tunnel Calw). Eine Artzuordnung von Rufen anhand der Fotos erfolgte, wenn zeitgleiche Rufe anderer Arten ausgeschlossen werden konnten (3 Min. vor und nach dem Durchflugereignis keine Registrierungen von anderen Fledermausarten an der Fotofalle). Die Durchflugöffnungen waren - bedingt durch die Lichtschrankeninstallation - an jedem Quartier 38 cm hoch, die Breite variierte zwischen 50 - 250 cm. Hallenartige Räume befinden sich lediglich beim Quartier Silberberg in direkter Nähe zur Lichtschranke, ansonsten erfolgten die Aufnahmen in rel. engen Gangsituationen im Abstand von wenigen Metern zum Eingang. Im Tunnel Calw, einem ca. 6 m hohem Eisenbahntunnel, wurden in weiterer Entfernung von der Lichtschranke Lautaufnahmen gewonnen (Auswertung hier nur für Zwerg- und Nordfledermaus, die gleichzeitige Anwesenheit von Verwechslungsarten konnte mit Hilfe des Fotomonitoringsystems
ausgeschlossen werden). Für die Nordfledermaus wurden auch einige Rufe aus dem Stollen Eck herangezogen, der nicht mit einer Fotofalle ausgestattet wurde, aber vollständig über Sichtkontrollen abgesucht werden kann und ein regelmäßiges Winterquartier für die Art darstellt.
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 1: Lichtschranke in typischem Aufbau am Quartier Langhecke, Batcorder und einfliegendes Großes Mausohr
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 2: Installation einer Kamera und schematische Darstellung der ChiroTec- Fledermaus-Fotofalle
Für die Bearbeitung der akustisch gut identifizierbaren Kleine Hufeisennase (Rhinolophus hipposideros) wurden auch Rufe aus verschiedenen weiteren unterirdischen Quartieren der Arten ausgewertet, die nicht mit Lichtschranken ausgestattet waren.
Die Rufaufnahmen erfolgten mit Batcordern der Firma Ecoobs mit einer Samplerate von
500 kHz (weitere technische Daten unter www.ecoobs.de). Mit einer möglichst wenig selektiven Aufnahmeeinstellung am Batcorder gelangen bei den meisten Fotos zeitgleiche Rufaufnahmen (threshold -36 db, quality 26 - 28). Die Stromversorgung des Batcorders erfolgte mit 12 V-Langzeit-Akkus. Echoreduzierende Maßnahmen kamen nur im Nahbereich des Mikrofons in Form verschieden großer Felle zum Einsatz. Der Batcorder sollte lt. Bedienungsanleitung in mind. 2 m Entfernung zu Wänden und sonstigen schallreflektierenden Gegenständen aufgestellt werden. Aufgrund der Engräumigkeit der Stollen und Höhleneingänge und der Aufnahmesituation an der Lichtschranke konnten diese Vorgaben an acht von neun Quartieren jedoch nicht erfüllt werden (Ausnahme: Tunnel Calw).
2.2 Auswerte-Technik
Aus den mit Fotos verifizierten Ortungsrufen wurden mit dem Programm bcAnalyze je nach Umfang der gewonnenen Daten pro Art 100 - 600 ausreichend laute Ortungsrufe ausgewählt und manuell vermessen. Da Echos von den nahen Wänden und der Lichtschranke die automatisierten Rufvermessungsergebnisse häufig unbrauchbar machten und die automatisierte Lautanalyse auf Referenz-Aufnahmen aus dem Freiland basiert, erwies sich die Verwendung der automatisierten Lautanalyse als unzureichend. Die Gewinnung von Meßwerten über die automatisierte Lautanalyse wurde mit Batcorder- Aufnahmen (Programm bcAdmin) sowie mit Batlogger-Aufnahmen (Programm BatExplorer) getestet. Viele Rufe wurden aufgrund von Echos und/oder geringer Lautstärke nicht automatisiert vermessen. Außerdem ergaben sich in beiden Programmen sehr viele Fehlvermessungen.
Vor dem Hintergrund, dass angesichts der Reflektionen und der geringen Lautstärke der Rufe unter Freilandbedingungen kaum idealtypische Aufnahmen gewonnen werden können, wurden für die vorliegende Bestimmungshilfe nicht nur ideale Referenzaufnahmen für die manuelle Rufvermessung ausgewählt, sondern auch durchschnittlich gute Aufnahmen. Beispielsweise kann jedoch bei leiseren Aufnahmen die vermessene Startfrequenz unter der tatsächlichen Startfrequenz liegen, auch verstärkt durch die atmosphärische Abschwächung.
Die manuelle Vermessung umfaßt die Start- (SF) und Endfrequenz (EF) sowie die Hauptfrequenz (HF). Die Differenz von Start- und Endfrequenz ergibt die Breite des genutzten Frequenzbandes in kHz (FB). Die Breite des Frequenzbandes jedes einzelnen Rufes wurde als weiteres Bestimmungsmerkmal aufgenommen, da es bei der Unterscheidung der Myotis-Arten eine gewisse Orientierungshilfe bietet (vgl. Barataud, 2015). Die Hauptfrequenz wurde nicht für jeden Einzelruf, sondern auf der Grundlage ganzer Sequenzen bestimmt (Sequenzen ohne Sozialrufe und ohne final buzz), um Fehlbestimmungen aufgrund von Auslöschungen in echoreicher Umgebung auszumitteln. Der Rufabstand erwies sich bei der engräumigen Orientierung als meist recht kurz und nicht artspezifisch. Die Ruflänge verkürzt sich ebenfalls gegenüber den Freilandrufen, ist jedoch für die Unterscheidung einiger Arten in unterirdischen Quartieren ein brauchbares Merkmal. Es wurden deshalb bei diesen Arten die Ergebnisse der automatisierten Lautanalyse für die Ruflänge herangezogen.
Die Darstellung in Sonagrammen erfolgte mit dem Programm bcAnalyze unter Verwendung eines 7-term Harris-Fensters mit einer FFT von 1024 samples und einer Überlappung von 96,9 % sowie einer Verstärkung des thresholds um den Wert 1. Die geringe Empfindlichkeit des Batcorder-Mikrofons bei 76 kHz bildet sich in den Sonagrammen ab und ist gerätebedingt.
Sozialrufe werden beispielhaft als Sonagramme dargestellt. Aufgrund der hohen Variabilität und der geringen Anzahl der gewonnenen Aufnahmen wurde auf die Vermessung von Start- und Endfrequenzen von Sozialrufen verzichtet. Alle während der Untersuchung nachgewiesenen Sozialruftypen der jeweiligen Arten werden in repräsentativen Beispielen dargestellt. Da jedoch nicht an allen Quartieren ganzjährig Aufnahmen gemacht wurden und von manchen Arten noch keine Nachweise von Sozialrufen gelungen sind, kann davon ausgegangen werden, dass die Vielfalt der Sozialrufe wesentlich größer ist.
3. Ergebnisse
Zunächst stellte sich die Frage, ob Fledermäuse beim Aus- und Einflug in ihre Quartiere die Echoortung nutzen. Am Quartier Angerlloch konnten von 1879 Fotos 23 Aufnahmen (1,22 %) keine Rufe zugeordnet werden. An Quartieren mit höherem Anteil von Bechsteinfledermäusen und Langohren lag dieser Anteil höher. Eine genauere Analyse der Rufaufnahmen dieser Arten legt nahe, dass die Erfassungsschwelle mit -36 db hier zu hoch angesetzt war und die geringe Erfassungsquote (ca. 50 %) wohl nicht darin begründet liegt, dass die Arten nicht orten.
3.1. Myotis-Arten
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 3: Übersicht über die Start (SF), Haupt (HF)- und Endfrequenzen (EF) von Myotis-Arten an unterirdischen Quartieren
Abb. 3 u. 4: Die Mittellinie innerhalb der Rechtecke gibt den Median an, die Grenzen des Rechtecks das Interquartil (50 % der Werte liegen in diesem Bereich). Die niedrigsten und höchsten Werte sind mit Querstrichen gekennzeichnet. Abkürzungen für die Arten: Mdau: Wasserfledermaus, Mmyo: Mausohr, Mbart: Kleine/Große Bartfledermaus, Mbec: Bechsteinfledermaus, Mema: Wimperfledermaus, Mnat: Fransenfledermaus
In Abb. 3 fällt bereits auf den ersten Blick die geringe Startfrequenz der Wasserfledermaus auf, die sie von allen anderen Arten unterscheidet. Das Mausohr hat meist eine etwas größere Ruflänge als die anderen Arten, so dass man mit etwas Erfahrung die Mausohrlaute anhand ihres typischen "schrägen Winkels" in den Sonagrammen erkennen kann. Bart- und Bechsteinfledermaus lassen sich durch ihre sehr ähnlichen Rufparameter schlecht unterscheiden. Bei der Wimperfledermaus fällt die hohe Hauptfrequenz auf. Die Fransenfledermaus deckt das breiteste Frequenzband aller Myotis-Arten ab. Ihre Hauptfrequenz ist i. d. R. nicht bestimmbar und fehlt deshalb in der Darstellung.
In Tab. 1 fällt auf, dass sich die mittlerere Breite des genutzten Frequenzbandes bei Bechstein- und Bartfledermäusen sowie dem Großen Mausohr ganz erstaunlich ähnelt, der Median-Wert umfasst bei allen drei Arten 85 - 90 kHz.
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 4: Bandbreite des für die Rufe genutzten Frequenzbandes (FB) der Myotis-Arten an unterirdischen Quartieren (Differenz zwischen Startfrequenz und Endfrequenz)
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Tab. 1: Übersicht über die ermittelten Rufparameter der Myotis-Arten in unterirdischen Quartieren n=Anzahl der vermessenen Rufe aus den verschiedenen Quartieren (Anzahl Quartiere)
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 5: Start- und Endfrequenzen der vermessenen Rufe von Myotis-Arten
Abb. 5 zeigt, dass sich die Rufe der Bechsteinfledermaus hinsichtlich ihrer Start- und Endfrequenz sehr stark mit Mausohr- und Bartfledermausrufen überlappen und zur Unterscheidung dieser Arten deshalb weitere Rufparameter herangezogen werden müssen. Zwar ist der Überlappungsbereich von Mausohr, Wimper- und Fransenfledermaus geringer, jedoch sollte die Hauptfrequenz - auch wenn Bechsteinfledermäuse am jeweiligen Quartier fehlen - als weiteres Unterscheidungsmerkmal verwendet werden. Bei der Wasserfledermaus gibt es so gut wie keinen Überlappungsbereich mit anderen Myotis-Arten, eine Startfrequenz unter 98 kHz ist ein eindeutiges und ausreichendes Merkmal.
3.1.1 Wasserfledermaus (Myotis daubentonii)
- Ortungsrufe
Datengrundlage:600 Einzelrufe aus den Quartieren Angerlloch, Grube Abendstern, Kalkabbaustollen, Knappengrund und Rosengartenstollen
Rufcharakteristik in unterirdischen Quartieren:meist laut, i. d. R. zwei Harmonische (mitunter drei), keine Haken am Rufanfang (sehr selten ganz leicht angedeutet), Auslöschungen häufig (Rufen gegen Wände). Die ermittelten Rufparameter unterscheiden nicht wesentlich von denen im Freiland (z. B. Skiba, 2003, Russo & Jones, 2001).
SF:
EF:
HF:
FB (SF - EF):
63 - 99 kHz
24 - 42 kHz
41 - 57 kHz
30 - 67 kHz
Verwechslungsgefahr:
Die Wasserfledermaus ist in unterirdischen Quartieren recht eindeutig an ihrer tiefen Startfrequenz unter 100 kHzzu erkennen. Sehr selten wurden bei Großem Mausohr und Bartfledermäusen ähnlich tiefe Startfrequenzen aufgezeichnet. Betrachtet man die
genutzte Bandbreite, umfassen Mausohr-Rufe im Minimum 70,3 kHz, während die Wasserfledermaus mit höchstens 66,6 kHz Unterschied zwischen Start- und Endfrequenz ein geringeres - in den meisten Fällen deutlich geringeres - Frequenzspektrum nutzt.
Bei Bartfledermäusen treten in unterirdischen Quartieren nur selten auch kurzbandige Rufe unter 67 kHz Bandbreite und mit tiefem Rufanfang auf. Die bisher beobachteten wasserfledermaus-ähnlichen Rufe der Bartfledermäuse beschränken sich allerdings auf Einzelrufe innerhalb einer Sequenz (vgl. Abb. 13 B). Damit sind die beiden Arten im Gegensatz zu Freilandrufen in unterirdischen Quartieren i. d. R. gut unterscheidbar.
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 6: typische Rufe der Wasserfledermaus (Sonagramm), Powerspektrum eines Rufes (zweite Harmonische deutlich erkennbar)
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 7: Rufvariationen der Wasserfledermaus:A: bis zu drei Harmonische, B: Übergänge zu Sozialrufen, C: angedeuteter Haken am Rufanfang, D: sehr tiefe SF, E: längerer Ruf mit "Myotis-Knick"
- Sozialrufe
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 8: A - C und G: variantenreicher Ruftyp "Bogenruf", D – F: Ruftyp
„Schrägstrich"
Bogenrufe sind ganzjährig an unterirdischen Quartieren nicht selten und werden vielfältig abgewandelt (vgl. Middleton et. al. 2014, Sozialruftyp C, Pfalzer 2002, Ruftyp A "Spazierstockrufe" u. C, Russ 2012, Fig. 6.21 u. 6.22, Barataud, 2015, Fig. 78 - 81). Sie werden oft in langen Rufreihen ohne Unterbrechung mit Ortungsrufen geäußert. In Abb. G sind Ortungsrufe eines zweiten Tiers im Hintergrund erkennbar. Es besteht eine gewisse Verwechslungsgefahr mit dem Ruftyp B der Mopsfledermaus, der jedoch meist 3 Harmonische aufweist und von der Mopsfledermaus im Freiland meist abwechselnd mit ihrem Ruftyp A geäußert wird (z. B. Skiba, 2003). In unterirdischen Quartieren kommt der Ruftyp B der Mopsfledermaus selten vor (vgl. 3.4).
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 9: Ruftyp "langer Ruf" der Wasserfledermaus
gefolgt von zwei Sozialrufen (vgl. Skiba 2003, Sozialruf A, Middleton et. al. 2014, Ruftyp C)
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 10: Ruftyp "flacher Ruf" der Wasserfledermaus
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 11: Ruftyp "langer Ruf" kombiniert mit Ruftyp "Bogenruf" (evtl. 2 Individuen, Verwechslungsgefahr mit "langem Ruf" der Bechsteinfledermaus, vgl. Abb. 19)
3.1.2 Großes Mausohr (Myotis myotis)
- Ortungsrufe
Datengrundlage:300 Einzelrufe aus den Quartieren Grube Abendstern, Knappengrund, Langhecke, Rosengartenstollen und Silberberg
Rufcharakteristik in unterirdischen Quartieren:Lautstärke leise bis mittel, selten laut, die meiste Lautenergie im tieferen Frequenzbereich, zweite Harmonische wenig betont und nicht immer erkennbar, Auslöschungen häufig (Rufe gegen Wände), manchmal Haken am Rufanfang. Gegenüber den Meßwerten für Freilandrufe lt. Skiba (2003) wurden auch Hauptfrequenzen über 37 kHz aufgezeichnet. Die Startfrequenz liegt in unterirdischen Quartieren i. d. R. über 100 kHz (lediglich 3 von 300 Rufen hatten eine Startfrequenz unter 100 kHz), ein Wert, den die von Skiba aufgezeichneten Freilandrufe stets wesentlich unterschritten. Russ (2012) gibt 104,5 kHz als maximale SF des Großen Mausohrs in Großbritannien an. Bei Russo & Jones (2001) liegt die Startfreqenz italienischer Mausohren ebenfalls nicht über 104,5 kHz. Der europäische Extremwert wird auf http://www.batecho.eu mit 110 kHz angegeben.
SF:
EF:
HF:
FB:
97 - 125 kHz
19 - 32 kHz
31 - 45 kHz
70 - 106 kHz
Verwechslungsgefahr:
Das Mausohr weist von allen Arten den niedrigsten Hauptfrequenzbereich auf. Viele Rufe zeigen eine auffällige Betonung der Frequenzen von ca. 25 – 70 kHz, bei einer eindeutig erkennbaren Hauptfrequenz zwischen (31) 33 - 41 (45) kHz. Wie Abb. 3 zeigt, enden 50 % der aufgenommenen Mausohr-Rufe in dem sehr engen Frequenzbereich zwischen 22 und 26 kHz. Charakteristisch sind außerdem die gegenüber den Verwechslungsarten tendenziell längeren Rufe. Bei einer automatisierten Rufvermessung von 949 Mausohrrufen aus den oben genannten unterirdischen Quartieren lagen 52 % der Rufe bei mind. 1,8 ms Ruflänge, 26 % überschritten sogar 2,0 ms. Bei der Bartfledermaus erreichten von 92 automatisiert vermessenen Rufen nur 21 % eine Länge von mind. 1,8 ms und nur 4 Einzelrufe überschritten 2,0 ms.
Von der Wasserfledermausunterscheidet sich das Große Mausohr durch eine höhere Startfrequenz (selten liegen Rufe im Überschneidungsbereich) und das breitere Frequenzband.
Die Bartfledermäusehaben eine höhere Hauptfrequenz über 50 kHz. Die Rufe der Wimperfledermaushaben ein höheres Rufende ab 35 kHz.
Eine ähnlich tiefe Endfrequenz wie das Große Mausohr hat die Fransenfledermaus , deren Rufe aber i. d. R. keine eindeutig feststellbare Hauptfrequenz haben (siehe Abb. 25) und häufig über 125 kHz beginnen.
Einen gewissen Überschneidungsbereich hat das Große Mausohr mit der Bechsteinfledermaus,da die Mausohr-Rufe in den unterirdischen Quartieren höher enden, als man das von den Freiland-Rufen der Art kennt. Sicher abgrenzbar sind Rufe des Großen Mausohrs, die unter 24 kHz enden. Bleibt eine längere Rufreihe mittellaut bis laut mit gleichförmigen etwas längeren Rufen über 1,8 ms (deshalb charakteristische "Schrägstrich-Rufform" Abb. 13!) und werden regelmäßig die tiefen Frequenzbereiche betont, handelt es sich um das Große Mausohr.
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 12: typische Rufe des Großen Mausohrs (Sonagramm), Powerspektrum einer Sequenz
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 13: Rufvariation des Großen Mausohrs: 2. Harmonische deutlich
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 14 weitere Rufvariationen des Großen Mausohrs:B u. C: Haken, D: hohe EF, E: starke Lautenergie im den tiefen Frequenzbereich bei gleichzeitiger "Vernachlässigung" des Rufanfangs
- Sozialrufe:bislang an unterirdischen Quartieren nicht festgestellt
3.1.3 Bartfledermäuse (Myotis mystacinus/brandtii)
Kleine Bartfledermaus und Brandtfledermaus wurden anhand der Fotos nicht unterschieden.
- Ortungsrufe
Datengrundlage:400 Einzelrufe aus den Quartieren Grube Abendstern, Knappengrund, Langhecke, Rosengartenstollen
Rufcharakteristik in unterirdischen Quartieren:mittlere Lautstärke bis laut, kurze, steile Rufe, meist zwei Harmonische (auch bei leisen Rufen!), häufig ungewöhnlich starke Betonung der zweiten Harmonischen, selten sehr kleine Haken am Rufanfang. Wie bereits beim Großen Mausohr liegt auch bei den Bartfledermäusen die Startfrequenz durchweg höher als im Freiland. So wurden nur wenige Einzelrufe mit einer SF unter 100 kHz aufgenommen. Skiba (2003) konnte im hindernisreichen Flug im Freiland eine Erhöhung der SF auf max. 110 kHz feststellen. Russ (2012) nahm in Großbritannien im Maximum eine SF von 101,8 kHz auf, Russo & Jones (2001) in Italien 122 kHz für die Kleine Bartfledermaus. Auch der Hauptfrequenzbereich liegt in unterirdischen Quartieren vermutlich durchschnittlich höher als im Freiland. Obrist et. al. (2004) ermittelte eine durchschnittliche Hauptfrequenz von 46,8 bzw. 45,7 kHz für die Bartfledermaus-Arten. Parsons & Jones (2000) geben für Großbritannien hingegen einen Durchschnittswert von 55,21 bzw. 57,58 kHz an, was den in der vorliegenden Untersuchung gemessenen Werten ähnelt (Median 56 kHz). Mit einer Startfrequenz von bis zu 141 kHz übertrafen die aufgenommenen Bartfledermäuse sogar den bislang in Europa gemessenen Extremwert, der auf der Seite http://www.batecho.eu mit 125 kHz angegeben ist (202 vermessene Einzelrufe und damit etwa die Hälfte der vermessenen Rufe übertrafen diesen Wert).
SF:
EF:
HF:
FB:
100 - 141 kHz
Ausnahme: wenige Einzelrufe mit
28 - 47 kHz
50 - 62 kHz
59 - 101 kHz
SF<100 kHz (Abb. 16B)
Verwechslungsgefahr:
Die Bartfledermäuse haben eine höhere Hauptfrequenz ab 50 kHz, während das Große Mausohrunter 44 kHz bleibt und häufig mit einer Endfrequenz unter 28 kHz deutlich unter der der Bartfledermäuse liegt. Auch Rufe mit einer Startfrequenz über 126 kHz sind
in diesem Überlappungsbereich den Bartfledermäusen zuzuordnen.
Die Fransenfledermausdeckt i. d. R. ein breiteres Frequenzband ab, d. h. sie endet entweder tiefer als die Bartfledermaus-Arten und/oder beginnt höher. Bei der Fransenfledermaus ist ein sehr breiter Frequenzbereich gleich betont und eine Hauptfrequenz ist nicht erkennbar.
Ein weiter Überschneidungsbereich liegt mit der Bechsteinfledermaus vor. Bei den Bartfledermäusen ist die zweite Harmonische stärker betont und deshalb fast immer
- auch bei leisen Rufen - deutlich erkennbar. Bartfledermäuse verwenden in unterirdischen Quartieren ausschließlich kurze steile Rufe. Bei der Bechsteinfledermaus sind manchmal längere Rufe mit Myotis-Knick oder - v. a. im Frühjahr - Sozialrufe in den Rufreihen enthalten. Laute Rufe sind bei der Bechsteinfledermaus eher die Ausnahme. Aufgrund der wechselnden Betonung der Rufe bei der Bechsteinfledermaus ist die Hauptfrequenz in einer längeren Rufreihe oft schwerer feststellbar als bei den Bartfledermäusen. Letztlich bleibt die Unterscheidung in unterirdischen Quartieren schwierig.
Rufe der Bartfledermaus mit hohen Endfrequenzen über 40 kHz, die damit in den Überlappungsbereich mit der Wimperfledermausreichen, treten immer wieder auf und scheinen von Einzeltieren systematisch in unterirdischen Quartieren genutzt zu werden (Netzfang am Quecksilberstollen Walchensee, Bayern, 2014). Bei diesen Bartfledermaus- Rufen ist stets der untere Teil des Rufes betont, die Wimperfledermaus zeigt eher in der Mitte der Rufe die größte Lautstärke. Dennoch erreichen die hochfrequent endenden Bartfledermäuse eine Hauptfrequenz um die 60 kHz, jedoch nicht wesentlich höher, wie es für die Wimperfledermaus typisch wäre. Bei der Wimperfledermaus liegt die Startfrequenz außerdem häufig bei über 142 kHz, was die Bartfledermaus bei den im Rahmen der Untersuchung aufgenommenen Rufen nicht erreichte.
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 15: typische Bartfledermaus-Rufe (stark betonte zweite Harmonische!), Powerspektrum einer Sequenz (Einschnürung bei 76 kHz gerätebedingt)
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 16: Rufvariationen:A: kleine Haken am Rufanfang, B: selten befindet sich zwischen typischen Rufen ein einzelner Ruf, der der Wasserfledermaus ähnelt
- Sozialrufe:bei der Untersuchung nicht festgestellt
3.1.4Bechsteinfledermaus (Myotisbechsteinii)
- Ortungsrufe
Datengrundlage:300 Einzelrufe aus den Quartieren Langhecke, Hessenloch und Rosengartenstollen
Rufcharakteristik in unterirdischen Quartieren:Extrem leise, nur bei etwa 50 % der Bechstein-Passagen wurden überhaupt Rufe aufgezeichnet. Mittellaute und laute Rufe kommen ausnahmsweise vor, jedoch sind in einer Sequenz meist nur einige wenige aufeinanderfolgende Rufe laut. Die zweite Harmonische wird meist nicht sehr betont und ist bei leisen Rufen oft nicht sichtbar. Selbst bei mittellauten Rufen ist der Rufanfang sehr leise und deshalb schwer vermessbar. Typisch sind - wie auch im Freiland - einzelne in einer Sequenz eingestreute längere Rufe mit Myotis-Knick. Sozialrufe sind v. a. im Frühjahr häufig. Die Hauptfrequenz der Rufe ist sehr uneinheitlich. Bei längeren Rufreihe ist deshalb die Haupfrequenz einer Sequenz oft kaum sinnvoll feststellbar (Abb. 17). Auch bei der Bechsteinfledermaus liegen die Startfrequenzen in unterirdischen Quartieren deutlich über den im Freiland nachgewiesenen Werten. Skiba gibt die maximaleSF mit
100 kHz an. Dieser Wert liegt knapp oberhalb des Minimums,das in unterirdischen Quartieren festgestellt wurde! Russo (2012) hingegen mißt in Großbritannien eine maximale SF von 130,9 kHz.
SF: EF: HF: FB:
99 - 146 kHz 25 - 44 kHz 38 - 69 kHz 63 - 113 kHz
Verwechslungsgefahr:
Aufgrund der überlappenden Start- und Endfrequenzen ist die akustische Unterscheidung zwischen Bart- und Bechsteinfledermäusen in unterirdischen Quartieren schwierig. Im Gegensatz zur Bechsteinfledermaus ist bei den Bartfledermäusen die zweite Harmonische fast immer - auch bei leisen Rufen - deutlich erkennbar bis stark betont . Die Bechsteinfledermaus nutzt auch längere Rufe und streut Rufe mit Myotis- Knick in die Rufreihen ein. Bei der Bartfledermaus wurden bislang nur kurze steile Rufe festgestellt. Die Rufreihen der Bartfledermaus erscheinen vergleichsweise monoton, die Hauptfrequenzen der Rufe ändern sich innerhalb einer Sequenz kaum.
Im Überschneidungsbereich zwischen Bechsteinfledermaus und Großem Mausohr sind jene Rufe dem Großen Mausohr zuzurechnen, die unter 24 kHz enden. Für Bechstein- oder Bartfledermaus spricht eine Startfrequenz über 126 kHz.
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 17: typische Rufe der Bechsteinfledermaus, Powerspektrum einer Sequenz (Einschnürung bei 76 kHz gerätebedingt)
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 18: Rufvariationen: A:eingestreute längere Ortungsrufe innerhalb einer Sequenz, B: Haken, C: längerer Ruf mit Myotis-Knick, D: Betonung des oberen Frequenz-Bereichs, E: Betonung des unteren Frequenz-Bereichs, F: zwei Tiere mit unterschiedlicher Rufform
- Sozialrufe
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 19: Ruftyp "langer Ruf" der Bechsteinfledermausin fließenden Übergängen mit verschiedener Ruflänge (vgl. Pfalzer 2002, Ruftyp A - C). Ist dem Sozialruftyp "langer Ruf" der Wasserfledermaus ähnlich (Abb. 10)!
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 20: Ruftyp "Welle" der Bechsteinfledermaus,hier in Rufreihen aneinandergereiht
3.1.5 Wimperfledermaus (Myotis emarginatus)
- Ortungsrufe
Datengrundlage:300 Einzelrufe aus den Quartieren Angerlloch und Knappengrund Rufcharakteristik in unterirdischen Quartieren: Rufanfang leise, in Sonagrammen oft schwer kenntlich, ansonsten meist leise bis mittlere Lautstärke, manchmal Haken am Rufanfang. Die zweite Harmonische ist nicht sehr dominant. Die Hauptfrequenz ist schwer ablesbar (vgl. Abb. 21 D). Es sollten deshalb mehrere besonders laute Sequenzen zum Nachweis der Wimperfledermaus vermessen werden. Gegenüber Freilandrufen ist die Hauptfrequenz, die von Skiba (2003) mit maximal 75 kHz und von Russo & Jones (2001) mit max. 76,3 kHz angegeben wird, häufig erhöht. Es konnte außerdem eine höhere maximale Startfrequenz festgestellt werden (Skiba, 2003: max. 140 kHz, Russo & Jones, 2001: max. 158,3 kHz).
SF:
EF:
HF:
FB:
112 - 168 kHz
35 - 54 kHz
49 - 98 kHz
65 - 125 kHz
Verwechslungsgefahr:
Die Wimperfledermaus verläßt über einer Endfrequenz von über 48 kHz den Überlappungsbereich mit der Bartfledermaus.Jedoch unterscheidet sie sich von dieser auch durch eine deutlich höhere Hauptfrequenz ab 62 kHz (HF Bartfledermaus bis 62 kHz). Auch Rufe mit einer Startfrequenz über 142 kHz sind in diesem Überlappungsbereich der Wimperfledermaus zuzuordnen. Bartfledermäuse können in unterirdischen Quartieren systematisch hoch endende Rufe verwenden (siehe 3.1.3.). Bei den Bartfledermäusen ist die zweite Harmonische oft lauter und deutlicher ausgeprägt als bei der Wimperfledermaus.
Bei der Fransenfledermauskommen immer wieder einzelne Rufe mit hohem Rufende vor. Es handelt sich jedoch um eingestreute Einzelrufe innerhalb von Sequenzen, die auch typische Fransenfledermaus-Rufe enthalten (vgl. Abb. 24 B).
Bei der Nymphenfledermaus wäre ebenfalls ein hohes Rufende zu erwarten. Sie wurde bislang in Sachsen-Anhalt an unterirdischen Quartieren nachgewiesen (Ohlendorf, 2008)
sowie in Höhlen in Bayern und Bulgarien, trat jedoch an den beprobten Quartieren nicht auf.
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 21: typische Rufe der Wimperfledermaus
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 22: Rufvariationen der Wimperfledermaus und Powerspektrum: A: zwei Harmonische, B u. C: Haken am Rufanfang, D: Power-Spektrum (Einschnürung bei 76 kHz gerätebedingt)
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 23: Rufvariationen der Wimperfledermaus:D: zwei Individuen mit unterschiedlichen SF und EF, E u. F: gebogene Rufe
- Sozialrufe
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 24: Ruftyp „Triller“ der Wimperfledermaus
Bislang erst zweimal konnten „Triller“ am Quartier Knappengrund in Baden- Württemberg aufgezeichnet werden, beide Aufnahmen gelangen im September.
3.1.6 Fransenfledermaus (Myotis nattereri)
- Ortungsrufe
Datengrundlage:300 Einzelrufe aus den Quartieren Grube Abendstern, Knappengrund und Silberberg
Rufcharakteristik in unterirdischen Quartieren:laut, oft sehr laut, zweite Harmonische nicht sehr betont, meist keine Peak-Frequenz feststellbar (Powerspektrum Abb. 26). Die Rufe in unterirdischen Quartieren ähneln denen im Freiland, die ebenfalls meist kurz und gerade sind. Sie decken ein sehr breites Frequenzband ab (bis zu fast 160 kHz Differenz zwischen Start- und Endfrequenz) und werden von automatisierten Lautanalyseprogrammen noch am besten von allen Myotis-Arten in unterirdischen Quartieren erkannt, zumal die lauten Rufe gut automatisiert vermessen werden. Rufe mit einem konkav gebogenen Rufverlauf sind nicht selten. Die Fransenfledermaus erreicht die höchsten Frequenzen unter den europäischen Arten. Mit dem im Rahmen dieser Untersuchung gemessenen Extremwert von 182 kHz den bisherigen Extremwert, der bei 175 kHz lag, sogar noch einmal deutlich übertroffen (www.batecho.eu).
SF: EF: HF: FB:
(103,5) 113 - 182
kHz
14 - 45 (51,3)
kHz
von ca. 24 - 70 (100) kHz gleich betont
(83) 92 - 160 kHz
Verwechslungsgefahr:
In aller Regel enden die Rufe weit unter 30 kHz, im Mittel bei 21 kHz . An unterirdischen
Quartieren kommen bei der Fransenfledermaus jedoch immer wieder einzelne hoch endende Rufe vor, die in den Überlappungsbereich mit der Wimperfledermausreichen (bis zu einer EF von 51,3 kHz). Es handelt sich dabei jedoch um Einzelrufe, wobei oft innerhalb derselben Rufsequenz wieder typische Rufe erscheinen. Für einen eindeutigen Nachweis sollten mehrere typische Rufsequenzen der Art vorliegen.
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 25: typische Rufe der Fransenfledermaus
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 26: typisches Powerspektrum der Fransenfledermaus: rel. gleichmäßig hohe Lautenergie in einem Bereich zwischen ca. 25 - 100 kHz (Einkerbung bei
75 kHz gerätebedingt)
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 27: Rufvariationen der Fransenfledermaus:Haken
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 28: weitere Rufvariationen der Fransenfledermaus: A: SF niedrig, B und C: hohe EF, konkav bogenförmiger Verlauf
- Sozialrufe
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 29: Ruftyp "Wellenrufe" der Fransenfledermaus einschl. Variationen
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 30: Ruftyp "U-förmige Rufe" der Fransenfledermaus einschl. Variationen und "Auflösung" zu Trillern
Wellenrufe werden vielfältig variiert und enden meist bei ca. 20 kHz (vgl. Pfalzer 2002, Ruftyp D, Russ 2012, Fig. 6.45, 6.46) U-Rufe: mehrfach aneinandergereiht und auch in Kombination mit Wellenrufen (vgl. Pfalzer 2002, Ruftyp A und B, Middleton et. al. 2014, Ruftyp D, Russ 2012, Fig. 6.48)
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 31: A: Ruftyp "gebogene Ortungsrufe", B: Ruftyp "tiefe Rufe" der Fransenfledermaus
C: Kombination "Wellenruf" mit Ruftyp "tiefe Rufe"
3.2 Braunes Langohr (Plecotus auritus)
- Ortungsrufe
Datengrundlage:100 Einzelrufe aus den Quartieren Grube Abendstern und Kiensteinloch. Im Quartier Kiensteinloch wurden keine Fotofallen eingesetzt. Die Zuordnung zum Braunen Langohr erfolgte, weil bei Winterquartierkontrollen im Kiensteinloch bislang nur Braune Langohren festgestellt wurden und keine Nachweise des Grauen Langohrs in dieser Höhenlage in den bayerischen Alpen vorliegen.
Rufcharakteristik in unterirdischen Quartieren:oft leise, viele Durchflüge wurden mit dem Batcorder nicht aufgezeichnet (Lautstärke geringer als Schwellenwert - 36 db). Allerdings treten auch regelmäßig laute Rufe auf. Zwei bis drei Harmonische, manchmal Betonung der zweiten Harmonischen, meist aber der ersten. Vermessungsergebnisse beziehen sich auf die erste Harmonische. Sehr variable Rufform. Gegenüber den Freilandrufen scheint sich das Ruf-Repertoire des Braunen Langohrs in unterirdischen Quartieren zu erweitern, was zu einer weiteren Spreizung der gemessenen Extremwerte führt. Die gemessene Startfrequenz der ersten Harmonischen ist gegenüber Freilandrufen erhöht (Russo & Jones, 2001: max. 57,8 kHz, Skiba, 2003: 40 kHz, Russ, 2012: 63,8 kHz).
Meßwerte für die erste Harmonische:
SF:
EF:
HF:
FB:
29 - 71 kHz
13 - 27 kHz
18 - 26 kHz
15 - 56 kHz
Verwechslungsgefahr:
Rufe mit vielen Harmonischen ähneln Sozialrufen der Mopsfledermaus .
Hoch endende Rufe könnten mit Eptesicus-Artenverwechselt werden. Das Braune Langohr hat jedoch eine niedrigere Hauptfrequenz.
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 32: typische Rufe des Braunen Langohrs
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 33: Rufariationen des Braunen Langohrs:A u. B.: starke Betonung der zweiten Harmonischen, C: Rufe mit geringer Frequenzbandbreite
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 34: Rufvariationen des Braunen Langohrs:Ortungsrufe werden mit vielen Harmonischen variiert, oft erfolgt dabei eine Betonung der ersten Harmonischen (vgl. Russ 2012, Fig. 6.129). Hier besteht Verwechslungsgefahr mit dem Sozialruftyp "konkaver Bogen" der Mopsfledermaus, siehe Abb. 48.
- Sozialrufe
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 35: Ruftyp "Welle mit Haken" des Braunen Langohrs
Einem Wellenruf folgen oft 2 - 5 hakenförmige Rufe, nach einer kurzen Pause wird wieder mit einem Wellenruf begonnen. Wellenrufe können auch fließend in einem Hakenruf enden. Hakenrufe sind der häufigste Sozialruftyp des Braunen Langohrs an unterirdischen Quartieren. Middleton et al. (2014) stellt ähnliche Rufe als Ruftyp D1 an einem Schwärmquartier im Frühjahr dar. Lange Abfolgen von Sozialrufen können mit Ortungsrufen unterbrochen oder auch ohne Unterbrechung vorgetragen werden.
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 36: Sozialruf-Variationen:A: Variation "Welle", B: Variation "Haken"
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 37: Ruftyp "langer gebogener Ruf" des Braunen Langohrs
3.3Nordfledermaus (Eptesicus nilssonii)
- Ortungsrufe
Datengrundlage:200 Rufe aus den Quartier Tunnel Calw
Rufcharakteristik in unterirdischen Quartieren:mittel bis laute Rufe mit zwei bis drei Harmonischen. Es treten sowohl kurze steile Rufe ähnlich der Breiflügelfledermaus auf, als auch längere deutlich konkave Rufe. Im Powerspektrum sehr deutlich erkennbare Hauptfrequenz. Gegenüber Freilandrufen ist die Hauptfrequenz im Durchschnitt erhöht (Skiba, 2003, gibt für Rufe im hindernisreichen Flug ein Maximum von 35 kHz an, im hindernisarmen Flug 31 kHz; Barataud, 2015, setzt die maximale Hauptfrequenz bei 32 kHz an und Obrist et. al., 2004, ermittelten einen Durchschnittswert von 29,8 kHz). Alle
vermessenen Rufe starten oberhalb Startfrequenz (45 kHz).
der
von Skiba (2003)
gemessenen maximalen
SF: EF:
47 - 72 kHz 24 - 30 kHz
HF:
30 - 38 kHz
FB:
18 - 45 kHz
Verwechslungsgefahr:
Kurze Rufe sind von der Breitflügelfledermausnicht zu unterscheiden. Möglicherweise sprechen Rufe mit einer Endfrequenz unter 23 kHz für die Breitflügelfledermaus und längere Rufe für die Nordfledermaus (siehe auch 3.4).
Die Rufe der Mopsfledermausverlaufen meist konvex oder gerade, während die der Nordfledermaus konkav geformt sind und einen kurzen konstantfrequenten Anteil aufweisen.
Hoch endende kurze Rufe des Braunen Langohrsähneln denen der Nordfledermaus. Hier sind die Rufform und die beim Braunen Langohr niedrigere Hauptfrequenz wichtige Unterscheidungsmerkmale.
Hoch beginnende kurze Rufe der Nordfledermaus könnten auf den ersten Blick denen der
Wasserfledermausähneln, haben jedoch eine tiefere Hauptfrequenz.
- Ortungsrufe
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 38: typische Rufe der Nordfledermaus, Powerspektrum, charakteristisch mit klar definierter Peak-Frequenz
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 39: Rufvariationen der Nordfledermaus:A u. B: kurzer Ruf mit niedriger SF
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 40: Ortungsrufe Nord- und Mopsfledermaus: von links: Mopsfledermaus, Nordfledermaus, Mopsfledermaus, Mopsfledermaus und Nordfledermaus fast gleichzeitig
- Sozialrufe
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 41: Ruftyp "langer Ruf" der Nordfledermaus(vgl. Pfalzer 2002, Ruftyp A, Middleton et al. 2014, Ruftyp C)
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 42: Ruftyp "Kreischen" der Nordfledermaus
3.4Breitflügelfledermaus(Eptesicusserotinus)
- Ortungsrufe
Datengrundlage:200 Einzelrufe aus dem Quartier Grube Abendstern
Rufcharakteristik in unterirdischen Quartieren:leise, mittellaute und auch seltener laute Rufe. Die bislang gewonnenen Referenzlaute sind kurz und steil, längere Rufe wie bei der Nordfledermaus traten nicht auf. Meist gibt es drei Harmonische, manchmal zwei. Der gemessene Hauptfrequenzbereich liegt in etwa innerhalb des Bereiches, der von Barataud (2015) für die engräumige Orientierung im Freiland mit 23 - 44 kHz angegeben wird und von Skiba (2003) auf 30 - 35 kHz eingegrenzt wird. Bei Russo & Jones (2001) liegt die Startfreqenz bei maximal 49,7 kHz, bei Skiba (2003) bei max. 60 kHz, diese Maximum- Angaben werden hier deutlich überschritten.
SF:
EF:
HF:
FB:
48 - 79 kHz
20 - 28 kHz
31 - 38 kHz
24 - 56 kHz
Verwechslungsgefahr:
Das Datenmaterial deutet darauf hin, dass die Rufe der Breitflügelfledermaus von den kurzen Rufen der Nordfledermaus in unterirdischen Quartieren nicht unterscheidbar sind. Eine größere Ruflänge spricht für die Nordfledermaus. Die mit Hilfe der automatisierten Lautanalyse vermessene Ruflänge der Breitflügelfledermaus beträgt höchstens 3,5 ms, während Nordfledermausrufe bis zu 5,0 ms umfassen. 31 % der 1270 vermessenen Nordfledermausrufe sind länger als 2,3 ms, während der Anteil dieser langen Rufe bei der
Breitflügelfledermaus nur bei 8,3 % liegt (insges. 501 vermessene Einzelrufe).
Sehr kurze schmalbandige Rufe (Abb. 44A) können leicht mit der Mopsfledermaus verwechselt werden! Bei einer längeren Rufreihe treten jedoch bei der Breitflügelfledermaus immer auch konkav gebogene Rufe auf, die bei der Mopsfledermaus nie als Ortungsrufe, allenfalls nur in abgewandelter Form in bestimmten Sozialruftypen vorkommen.
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 43: typische Rufe der Breitflügelfledermaus, Powerspektrum
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 44: Rufvariationen:A: kurze Rufe mit tiefem Rufanfang, B: leise zweite Harmonische, C und D: Rufe mit zwei Harmonischen, E: hoher Rufanfang, F: mehrere Harmonische, G: gebogener Rufanfang
3.5 Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)
- Ortungsrufe
Datengrundlage:100 Einzelrufe aus den Quartieren Angerlloch und Silberberg.
Rufcharakteristik in unterirdischen Quartieren:mittellaute bis laute Rufe. Der im Freiland so typische Rufwechsel kann in unterirdischen Quartieren nur selten aufgezeichnet werden.
Der von Skiba (2003) beschriebene Ruftyp A wird in unterirdischen Quartieren zu einem höher beginnenden, sehr kurzen Ruf mit meist drei Harmonischen - tiefer beginnende Rufe mit zwei Harmonischen - abgewandelt. Diese Rufe sind gerade oder leicht konvex. Der konvexe Bogen des Ruftyps B taucht nur selten auf. Ein Grund dafür könnte sein, dass sich die Tiere vorwiegend nach unten orientieren und daher den durch den Mund ausgestoßenen Ruftyp nutzen und nicht den durch die Nase ausgestoßenen nach oben gerichteten Ruftyp (vgl. Seibert et al. 2010).
Vermessungsergebnisse für Ruftyp A:
SF:
EF:
HF:
FB:
38 - 67 kHz
22 - 30 kHz
28 - 43 kHz
11 - 43 kHz
Verwechslungsgefahr:
Kurze Rufe der Mopsfledermaus können mit kurzen Rufen von Eptesicus-Arten verwechselt werden, wenn diese ebenfalls drei Harmonische aufweisen. Hier die tiefere Hauptfrequenz von Eptesicus beachten, meist ist jedoch die Rufform schon ein gutes Unterscheidungsmerkmal.
Sozialrufe der Mopsfledermaus ähneln den Rufen des Braunen Langohrs mit vielen Harmonischen (vgl. Abb. 33)
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 45: typische Rufe der Mopsfledermaus:steile Rufe des Ruftyps A (vgl. Skiba, 2003)
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 46: A - D: Variationen des von Skiba (2003) definierten Ruftyps "A" , E: Ruftyp "B" ähnelnder Ruf (selten)
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 47: Variation:Betonung der zweiten Harmonischen
- Sozialrufe
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 48: Ruftyp "Triller" der Mopsfledermaus
Variationen von „Triller“ sind rel. häufig (vgl. Middleton et al., 2014, Ruftyp C).
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 49: Ruftyp "Welle und Linie" der Mopsfledermausmit unterschiedlicher Anzahl an Harmonischen. Der letzte Ruf des 2 – 5 teiligen Trillers ist mitunter in die Länge gezogen und kann sowohl gerade als auch wellenförmig sein. Manchmal besteht die Ruffolge nur aus einem kurzen und einem langen Ruf.
Die Sozialrufe der Mopsfledermaus sind an individuenreichen Winterquartieren zwar über das gesamte Jahr hinweg immer wieder festzustellen, häufen sich jedoch während der Schwärmzeit (Abb. 50).
Sozialrufaktivität der Mopsfledermaus
Quartier Angerlloch 01.08.2010 - 15.07.2011
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 50:Aufnahmen mit Sozialrufen der Mopsfledermaus am Angerlloch im Jahreslauf
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 51: Ruftyp "konkaver Bogen" der Mopsfledermausmit vielen Harmonischen. Hier besteht Verwechslungsgefahr mit bestimmten Ortungsrufen des Braunen Langohrs. Einige dieser Rufe sehen den Sozialrufen ähnlich, die Barataud (1996) als revierabgrenzende Balzrufe von Männchen beschrieb.
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 52: Ruftyp "konvexer Bogen" der Mopsfledermausmit Triller
3.6Kleine Hufeisennase (Rhinolophushipposideros)
- Ortungsrufe
Datengrundlage:Die Sozialrufe wurden in einigen bayerischen Quartieren ohne gleichzeitiges Fotomonitoring aufgezeichnet
Rufcharakteristik in unterirdischen Quartieren:Die Hauptfrequenzen der bislang in unterirdischen Quartieren in Bayern aufgezeichneten Kleinen Hufeisennasen liegen zwischen
100 - 112 kHz. Es ist zu beachten, dass die Doppler-Shift-Kompensation in bestimmten Flugsituationen und der Dopplereffekt selbst (ca. +/- 1kHz) die vom Mikrofon aufgenommene Hauptfrequenz beeinflussen. Je nach Flugsituation nutzen Weibchen auch die tieferen Hauptfrequenzen unter 105 kHz im Rahmen der Doppler-Shift-Kompensation, während Männchen im Hauptfrequenzbereich unter 107 kHz verbleiben (eigene Beobachtungen, Netzfänge). In Höhleneingängen ist das von den Individuen genutzte Spektrum an Hauptfrequenzen jedoch nicht sehr breitbandig, weil es sich um eine konstante Nahorientierungs-Situation handelt und die Tiere nicht mit hoher Geschwindigkeit auf ein Hindernis zufliegen.
Männchen und Weibchen können unter bestimmten Bedingungen anhand der Hauptfrequenz unterschieden werden (Frühstück, 2005, Jones et al., 1992). Es gibt jedoch einen gewissen Überschneidungsbereich zwischen den Geschlechtern. Diesem Überschneidungsbereich sind
i. d. R. auch die Rufe subadulter Tiere zuzuordnen (Frühstück, 2005).
Bei Männchen, die unterirdische Quartiere ohne gleichzeitige Anwesenheit von Artgenossen alleine bewohnen, schwankt der genutzte Hauptfrequenzbereich ca. um 2 kHz. Es ist bei regelmäßig auftretenden Hauptfrequenzen über 107 kHz von der Anwesenheit von Weibchen auszugehen. I. d. R. wird die vierte Harmonische betont, es gibt wenige Aufzeichnungen mit Betonung der zweiten Harmonischen.
Vermessungsergebnisse:
HF:
100 - 112 kHz
Verwechslungsgefahr:
Andere hoch rufende Rhinolophus-Arten mit ähnlich hoher Hauptfrequenz kommen in Deutschland nicht vor.
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 53: typische Rufe: Im dargestellten Beispiel überschneidet sich ein langer Ruf eines vermutlichen Weibchens mit einem tieferen Ruf eines vermutlichen Männchens.
- Sozialrufe
An Höhlen eingängen gelingt die Aufzeichnung von Sozialrufen der Art sehr selten. In unterirdischen Quartieren können jedoch an den Hangplätzen Sozialrufe - auch tagsüber - aufgezeichnet werden. Diese Rufaufnahmen wurden als Sozialrufe eingestuft, da sich meist mehrere Individuen im Quartier aufhielten oder die Sozialrufe bei einer Begegnung zweier Tiere aufgezeichnet wurden.
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 54: Ruftyp "langgezogener Rufanfang"
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 55: Ruftyp "langgezogenes Rufende"
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 56: Variation:Betonung der zweiten Harmonischen
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 57: Ruftyp "Wellenruf" der Kleinen Hufeisennase
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 58: Ruftyp "abfallende Rufe" der Kleinen Hufeisennase
Die Rufhöhe fällt nach jedem Ruf ab. Die Ruffolge kann am Anfang, Ende oder auch mitten in einer Rufreihe auftreten. Eine Sozialruffunktion ist möglich, es könnte sich aber auch um ein
„Niesen“ handeln (Beobachtungen von Christian Dietz, mdl., 2014).
3.7 Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)
- Ortungsrufe
Datengrundlage:120 Einzelrufe aus den Quartieren Tunnel Calw und Angerlloch
Rufcharakteristik in unterirdischen Quartieren:meist laute bis sehr laute Rufe mit i. d. R. zwei Harmonischen, selten auch nur eine oder drei Harmonische. Die erste Harmonische ist stark betont mit deutlichem Schwerpunkt der Lautstärke in den tieferen Frequenzbereichen (Rufanfang wesentlich leiser). Die Hauptfrequenz ist dank des konstantfrequenten Anteils bei ausreichend lauten Rufen deutlich feststellbar und durchschnittlich höher als bei Freiland- Rufen (vgl. Russ, 2012).
Die Rufe in unterirdischen Quartieren sind gegenüber den Rufen im Freiland auch häufig kürzer, v. a. der konstantfrequente Anteil kann verkürzt sein. Dennoch traten im 6 m hohen Eisenbahntunnel Calw auch längere Rufe mit weniger hohem Rufanfang auf, die den Freiland- Rufen ähneln. Gegenüber den Freiland-Rufen liegen die Hauptfrequenzen höher (über 45 kHz). Die von Russ (2012) als Maximum angegebene Startfrequenz von 95,2 kHz wurde in unterirdischen Quartieren oft überschritten. Die Rufe sind gut identifizierbar und werden von
der automatisierten Lautanalyse auch in unterirdischen Quartieren gut erkannt.
Vermessungsergebnisse:
SF:
EF:
HF:
FB:
71 - 127 kHz
41 - 50 kHz
45 - 52 kHz
23 - 83 kHz
Verwechslungsgefahr:
Kurze Rufe mit geringem konstantfrequenten Anteil könnten mit Myotis-Arten (v. a. Wimperfledermaus) verwechselt werden. Der konstantfrequente Anteil fehlt jedoch selten völlig und die starke Betonung einer eng einzugrenzenden Hauptfrequenz bei der Zwergfledermaus wird im Powerspektrum gut sichtbar.
Eigene Erhebungen im Altmühltal bei Essing mit aufgezeichneten Hauptfrequenzen zwischen
54 - 61 kHz lassen vermuten, dass auch die Mückenfledermaus Höhleneingänge zum Schwärmen nutzt (Kastlhäng-Höhle, Obernederhöhle, Kleines Schulerloch). Von dieser Art liegen noch keine Fotonachweise mit zeitgleichen Batcorder-Aufnahmen vor.
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 59: typische Rufe der Zwergfledermaus
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 60: Rufvariationen der Zwergfledermaus:A: 3 Harmonische, B: Haken am Rufende, C: plötzlicher Lautstärken-Wechsel im Ruf, D: erster Ruf ohne konstant frequenten Anteil (selten)
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 61: Powerspektrum der Zwergfledermaus: eindeutige Hauptfrequenz, zweite Harmonische gut erkennbar (Einkerbung bei 75 kHz technisch bedingt)
- Sozialrufe
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Abb. 62: Sozialruftyp "Triller" der Zwergfledermaus:im Quartier Tunnel Calw kein erkennbarer Unterschied zu den Sozialrufen im Freiland feststellbar
4. Diskussion
4.1 Artbestimmung von Fledermausrufen an unterirdischen Quartieren
Die Kombination von Fotomonitoring mit zeitgleichen Batcorder-Aufnahmen ermöglichte an den Quartieren eine eindeutige Artzuordnung der Rufsequenzen (mit Hilfe der gewählten Vorgaben in der Methodik).
Es wurde keine Variabilität der Rufe einer Fledermausart zwischen einzelnen Quartieren erkennbar . Die Variabilität der Rufe innerhalb einer Art erwies sich als deutlich größer. Die intraspezifische Variabilität der Ortungsrufe ist häufig größer als die interspezifische, z. B. bei der Bechsteinfledermaus, der Kleinen Bartfledermaus und dem Großen Mausohr (vgl. Abb. 5).
Da die Aufnahmesituation in gewisser Weise standardisiert erfolgte, stellt sich die Frage, inwieweit die Ergebnisse auf größere oder kleinere Einflugöffnungen sowie weiträumige Hallensituationen übertragbar sind bzw. die Arten auch an anderen Einflugöffnungen ein ähnliches Rufverhalten zeigen. Die aus Quartieren ohne Fotonachweise gewonnenen Vergleichsaufnahmen legen nahe, dass zwar immer wieder einzelne besondere Ruftypen auftauchen, die regulären Ortungs- und Sozialrufe jedoch mehr oder weniger identisch sind. Die etwas großräumigeren Aufnahmesituationen im Tunnel Calw bzw. im Silberberg zeigten keine deutlichen Unterschiede im Ortungsverhalten der Fledermäuse gegenüber den engeren Stollen- und Höhleneingängen. Bei den Sozialrufen sind die vielfältigen Variationen auf bestimmte Grundtypen zurückzuführen.
Es sollte auch die Frage untersucht werden, ob sich die Ortungsrufe der Arten besser unterscheiden lassen als im Freiland , wenn eine für alle Arten gleiche standardisierte Einflugssituation die artspezifischen Nahortungsrufe bzw. den artspezifischen idealen Hörbereich in dieser Situation erkennbar macht. Zumindest die Unterscheidung von Wasser- und Bartfledermaus ist in unterirdischen Quartieren leichter als im Freiland, da die Bartfledermaus hier i. d. R. eine Startfrequenz über 100 kHz aufweist, die Wasserfledermaus jedoch darunter bleibt. Nord- und Breitflügelfledermaus sind ein Beispiel dafür, dass die Artunterscheidung in unterirdischen Quartieren noch schwieriger ist als im Freiland: Die kurzen Nahortungsrufe beider Arten ähneln sich sehr stark. Sozialrufe können eindeutig artspezifisch sein. Sozial- und Ortungsrufe von Arten können sich jedoch auch ähneln (z. B. Sozialruftyp "langer Ruf" von Wasser- und Bechsteinfledermaus, Ortungsrufe des Braunem Langohrs mit vielen Harmonischen und Sozialruftyp "konkaver Bogen" der Mopsfledermaus).
Um die Nachweissicherheit von Artbestimmungenzu erhöhen, empfiehlt es sich, ausreichend Rufmaterial über mehrere Nächte zu gewinnen und Artnachweise nicht auf wenige Sequenzen zu stützen. Für die Anwendbarkeit der Bestimmungsmerkmale ist es insbes. bei Myotis-Arten wichtig, dass die vermessenen Rufe eine ausreichende Lautstärke aufweisen. Zur Erhöhung der Nachweissicherheit kann auch ein zweites Gerät im Abstand von mind. 5 m vor dem Quartier aufgestellt werden, um zusätzlich Ortungsrufe der Arten im freien Luftraum zu gewinnen. Zum Nachweis dafür, dass diese Rufaufnahmen einen Zusammenhang mit dem Quartier haben, kann der zeitliche Zusammenhang mit parallelen Aufnahmen aus dem Quartier hergestellt werden (Ausflüge, Einflüge).
Bei akustisch schwer oder nicht unterscheidbaren Arten oder zur Verifizierung von Verdachtsfällen ist der Einsatz anderer Nachweismethoden sinnvoll (z. B. Netzfang, Winterquartierkontrollen, Lichtschranken mit Fotofallen).
4.2 Methodik von akustischen Untersuchungen an unterirdischen Quartieren
In jedem Fall ist eine wenig selektive Aufnahmeeinstellung hinsichtlich der Rufqualität an den Aufnahmegeräten zu empfehlen, da ansonsten durch Echos gestörte Rufe nicht als
Fledermausrufe erkannt und leise Rufe nicht aufgezeichnet werden. Fehlregistrierungen durch die Geräusche von Wassertropfen kann mit einer Erhöhung der Aufnahmeschwelle für die Frequenz entgegengewirkt werden (z. B. 25 kHz, aufgrund ihrer in unterirdischen Quartieren höheren Startfrequenz erreichen bei dieser Einstellung auch Langohren und Nordfledermäuse noch den überschwelligen Bereich). Gilt das Interesse nur dem Nachweis bestimmter hoch rufender Arten, kann die Triggereinstellung für die Frequenz auch zur Reduzierung des Daten- und Arbeitsaufwandes wesentlich höher angesetzt werden, für die Kleine Hufeisennase beispielsweise bei 99 kHz.
Auch wenn sich die Nutzung der automatisierten Lautanalyse im Rahmen der vorliegenden Arbeit als unzureichend erwies, ist die Vorsortierung der Aufnahmen, die sich durch die automatisierte Lautanalyse gewinnen läßt, doch ein gutes Hilfsmittel, um einen Überblick über die Daten und das mögliche Spektrum an Arten und Gattungen am Quartier zu gewinnen.
Aufgrund der i. d. R. hohen Aktivität an unterirdischen Quartieren und der daraus resultierenden Vielzahl an Rufaufnahmen sowie des manuellen Aufwandes zur Bestimmung der Sequenzen ist eine quantitative Auswertung der Rufsequenzen auf Artniveau i. d. R. nicht möglich. Allenfalls könnten halbquantitative Daten aus einer Stichprobenauswertung gewonnen werden.
Zumindest Präsenz-Datenzur Anwesenheit akustisch gut bestimmbarer Arten am Quartier sind mit Lautaufnahmen sinnvoll möglich. Beispielsweise konnten in den Jahren 2013 und 2014 bislang unbekannte Zwischenquartiere der Kleinen Hufeisennase in Franken durch ein akustisches Screening von über 200 unterirdischen Quartieren gefunden werden (Biedermann et al., 2015).
Erkenntnisse zu Bedeutung und Funktion der Quartiere bietet der Vergleich von akustischer Aktivität an verschiedenen Quartieren oder zu verschiedenen Jahreszeiten auch ohne eine Artbestimmung der Rufe. Es ist dann lediglich sicherzustellen, dass sich keine Störgeräusch-Sequenzen unter den Aufnahmen befinden. Wenn die Aktivität auf Basis der Anzahl von Sequenzen, Aufnahmesekunden oder Einzelrufen bemessen wird, entsteht das Problem, dass kreisende Flüge einzelner Individuen im Bereich des Mikrofons gegenüber kurzen Vorbeiflügen stark überrepräsentiert sind. Es empfiehlt sich, die Aktivität innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls (z. B. 3 Minuten) zu einem Einzelereignis zusammenzufassen und anschließend die Zahl dieser Ereignisse zu vergleichen.
Soll das Maß der akustischen Aktivität an unterschiedlichen Quartieren verglichen werden, ist zusätzlich zu beachten, dass die Jahreszeit und die Aufnahmesituation im Quartier das Ergebnis erheblich beeinflussen können. So kann beispielsweise die "Binnenaktivität" ab einer Entfernung von mehreren Metern zum Eingang in unterirdischen Quartieren viel höher sein als direkt am Eingang, auch wenn diese Aktivität nur durch wenige Individuen verursacht wird (vgl. Kugelschafter, 2009). Die Erfassung der Rufe wird - bedingt durch die eingeschränkte Reichweite des Mikrofons - an einem sehr hohen Portal weniger vollständig gelingen als an einem engräumigen Eingang. Die Schwärmaktivität läßt sich am besten wenige Meter vor bis wenige Meter hinter dem Eingang erfassen. Für den Vergleich von Aktivitäten ist die Aufstellung so weit wie möglich zu standardisieren und es sind die gleichen Gerätetypen und Aufnahmeeinstellungen zu verwenden.
5. Ausblick
Zur Identifikation von Massenwinterquartierensind Sichtkontrollen nicht ausreichend - insbes. hinsichtlich der versteckt überwinternden Arten Bechstein- und Fransenfledermaus (z. B. Kugelschafter, 2009). Hier könnte die akustische Überwachung gerade dort, wo Fotofallen und Lichtschranken nicht einsetzbar sind, Hinweise liefern. Um eine Vorstellung von einer ungefähren Größenordnung der Rufaktivität an Massenquartieren zu gewinnen, sollte an mehreren Quartieren mit lichtschrankenüberwachtem Bestand in einem bestimmten Referenzzeitraum die Rufaktivität bestimmt werden. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die Artenzusammensetzung an jedem Quartier anders ist und einzelne Arten eine höhere Flugaktivität an Eingängen aufweisen als andere, wodurch es zu Fehleinschätzungen kommen kann (vgl. Tab. 2). Die bisherigen Ergebnisse lassen vermuten, dass Fransenfledermäuse, Hufeisennasen und Langohren häufig in Eingängen kreisen und/oder überdurchschnittlich häufig hin- und herfliegen. Einschätzungen zur Bestandesgröße sind durch die akustische Methode deshalb voraussichtlich nur auf sehr grober Ebene möglich.
Tab. 2: Vergleich von ermittelter Individuenzahl des Winterbestandes und Anzahl Fotos von 01. - 24.03.10 im Quartier Galgenberghöhle (vgl. Kugelschafter, 2010)
Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten.
Die Phänologie des Auftretens von Sozialrufender verschiedenen Fledermausarten sollte zukünftig eingehender untersucht werden. Auch die Vielfalt der Sozialrufe an unterirdischen Quartieren ist sicher weitaus größer, als hier beschrieben. Noch unklar ist, wo und wann Sozialrufe am häufigsten geäußert werden. Ein Vergleich der Sozialrufaktivität der Bechsteinfledermaus während der Schwärmzeit am Quartier Langhecke erbrachte sowohl an der Lichtschranke am Eingang des Quartiers als auch im Schwärmbereich ca. 10 m vor dem Eingang fast keine Sozialrufe, während beim Ausflug im Frühjahr am selben Quartier regelmäßig Sozialrufe der Art aufgenommen werden konnten. Die Ergebnisse für die Kleine Hufeisennase zeigen v. a. Sozialrufe am Hangplatz im Sommer, wenn mehrere Tiere nebeneinander hängen.
Es konnte ein vertiefter Einblick in die Variationsbreite der Rufe unserer Fledermausarten sowie ihre Anpassungsfähigkeit an die spezifische Ortungssituation gewonnen werden. Bisher bekannte gemessene Extremwerte wurden bei vielen Arten überschritten. Dieses Vermögen stimmt auch nachdenklich, was die Bestimmungssicherheit in Freilandsituationen anbelangt. Das Ortungs- und Sozialrufverhalten unserer Fledermäuse ist noch lange nicht ausreichend erforscht.
6. Literatur
Barataud, M. (1996): The world of bats, Sitelle Publishers, Grenoble, 47 S.
Barataud, M. (2015): Acoustic Ecology of European Bats. Species Identification, Study of their Habitats and Foraging Behaviour. Biotope, Méze; Muséum national d´Historie naturelle, Paris, 352 S.
Biedermann, M., Karst, I., Schorcht, W. (2015) : Telemetrie und Quartiersuche der Kleinen Hufeisennase 2015, im Auftrag der Regierung von Oberfranken
Dawkins, R. & Krebs, J. R. (1981): Signale der Tiere: Information oder Manipulation? In: Öko- Ethologie, Verlag Paul Parey, Berlin, S. 222-242
Dietz, C., von Helversen O. & D. Nill (2007): Handbuch der Fledermäuse Europas und Nordwestafrikas. Kosmos Verlag, Stuttgart. 399 S.
Frühstück, K. (2005): Quartierökologie und Populationsdynamik der Kleinen Hufeisennase (Rhinolophus hipposideros) im Sommer, Diplomarbeit am Institut für Zoologie, Karl-Franzens- Universität Graz
Jones G., Gordon T. & Nightingale J. (1992): Sex and age differences in the echolocation calls of the lesser horseshoe bat. In: Mammalia, H. 56, S. 189-193
Kugelschafter, K., T. Horvath, W. Kimpel, G. Steffny & T. Volk (1995). Neue Techniken zur Überwachung von Fledermäusen. – Methoden feldökol. Säugetierforsch. 1: 373-382.
Kugelschafter, K. (2009): Qualitative und quantitative Erfassung der Fledermäuse, die zwischen Februar und Mai 2009 aus ihren Winterquartieren „Bierkeller bei Sulzthal“, „Moggasterhöhle“ bei Moggast, „Geisloch“ bei Viehhofen und „Windloch“ bei Alfeld ausfliegen, im Auftrag des Landesamtes für Umwelt Bayern
Kugelschafter, K. (2010): Erfassung der Fledermäuse, die aus ihren Winterquartieren
„Galgenberghöhle“ bei Hohenburg und „Geisloch“ bei Viehhofen ausfliegen, im Auftrag des Landesamtes für Umwelt Bayern
Middleton, N., Froud, A. & French, K. (2014): Social calls of the bats of Britain and Ireland, Pelagic Publishing, Exeter, 200 S.
Obrist M. K., Boesch, R. & Flückinger, P. F. (2004): Variablility in echolocation call design of 26 Swiss bat species: consequences, limits an optionsfor automated field identification with a synergetic pattern recognition approach, Mammalia 68 (4): 307 - 322.
Parsons, S. & Jones, G. (2000): Acoustic identification of twelve species of echolocating bat by discriminant function analysis and artificial neural networks, J. Exp. Biol. 203: 2641 - 2656
Pfalzer, G. (2002): Inter- und intraspezifische Variabilität der Soziallaute heimischer Fledermausarten, Diss. am Fachbereich Biologie der Univ. Kaiserslautern, 251 S.
Russ, J. (2012): British Bat Calls - A Guide to Species Identification, Pelagic Publishing, Exeter, 192 S.
Russo, D. & Jones, G. (2002): Identification of twenty-two bat species (Mammalia: Chiroptera) from Italy by analysis of time-expanded recordings of echolocation calls. J. Zool., Lond. 258: 91- 103.
Seibert, A.-M., Koblitz, J., DenzinGer, A. & Schnitzler, H-U. (2010): The scanning behaviour of free ranging Barbastella barbastellus, Universität Tübingen
Skiba, R. (2003): Europäische Fledermäuse, Westarp Wissenschaften-Verlagsgesellschaft, Hohenwarsleben, 212 S.
Ohlendorf, B. & Funkel, C. (2008): Zum Vorkommen der Nymphenfledermaus Myotis alcathoe von Helversen & Heller, 2001, in Sachsen-Anhalt. – Nyctalus (N.F.) 13 (2-3): 99-114.
Ohlendorf, B., Francke, R., Meisl, F., Schmidt, S., Woiton, A. & Hinkel, A. (2008): Nachweise der Nymphenfledermaus (Myotis alcathoe) in Sachsen. – Nyctalus (N.F.) 13 (2-3): 118-121.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel dieser Studie über Fledermäuse in unterirdischen Quartieren?
Ziel der Studie ist es, eine brauchbare Bestimmungshilfe für Fledermausrufe in unterirdischen Quartieren zu erstellen. Dies soll durch akustische Referenzaufnahmen verschiedener Arten und Vermessung ihrer Rufparameter erreicht werden.
Welche Vorteile bietet die akustische Langzeit-Erfassung von Fledermäusen an unterirdischen Quartieren?
Die Methode ist nahezu störungsfrei, ermöglicht Erkenntnisse über nicht betretbare Hohlräume, macht keine Begehungen in gefährlichen Bereichen notwendig, ermöglicht Aussagen zur Quartierfunktion und den Vergleich der Aktivität an verschiedenen Quartieren.
Welche Nachteile hat die akustische Langzeit-Erfassung von Fledermäusen an unterirdischen Quartieren?
Es besteht Diebstahlgefahr für die Geräte, die Technik leidet durch Nässe, es ist ein hoher Aufwand für die manuelle Lautanalyse erforderlich, die Unterscheidbarkeit mancher Arten ist schwierig oder unmöglich, und es sind keine Aussagen zu Individuenzahlen möglich.
Was sind Ortungsrufe und Sozialrufe und wie unterscheiden sie sich?
Ortungsrufe dienen der Nahorientierung und Echoortung, während Sozialrufe der Kommunikation dienen. Die Abgrenzung ist jedoch nicht immer eindeutig, da Ortungsrufe auch Informationen für andere Fledermäuse enthalten können und umgekehrt Sozialrufe auch der Echo-Orientierung dienen können.
Welche Aufnahmetechnik wurde für die Referenzrufe verwendet?
Die Referenzrufe wurden an Höhlen- und Stolleneingängen mit Batcordern aufgenommen. Die Artzuordnung erfolgte über zeitgleiche Fotos der ein- bzw. ausfliegenden Fledermäuse.
Wie erfolgte die Auswertung der akustischen Daten?
Aus den mit Fotos verifizierten Ortungsrufen wurden mit dem Programm bcAnalyze Einzelrufe manuell vermessen. Eine automatisierte Lautanalyse erwies sich als unzureichend aufgrund von Echos und geringer Lautstärke.
Welche Myotis-Arten wurden in der Studie untersucht?
Die Studie untersuchte Wasserfledermaus (Myotis daubentonii), Großes Mausohr (Myotis myotis), Kleine/Große Bartfledermaus (Myotis mystacinus/brandtii), Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii), Wimperfledermaus (Myotis emarginatus) und Fransenfledermaus (Myotis nattereri).
Welche Rufparameter wurden für die Myotis-Arten ermittelt?
Es wurden Startfrequenz (SF), Endfrequenz (EF), Hauptfrequenz (HF) und die Breite des genutzten Frequenzbandes (FB) vermessen. Der Rufabstand erwies sich bei der engräumigen Orientierung als meist recht kurz und nicht artspezifisch.
Was ist charakteristisch für die Rufe der Wasserfledermaus in unterirdischen Quartieren?
Die Wasserfledermaus ist recht eindeutig an ihrer tiefen Startfrequenz unter 100 kHz zu erkennen.
Was ist charakteristisch für die Rufe des Großen Mausohrs in unterirdischen Quartieren?
Das Mausohr weist den niedrigsten Hauptfrequenzbereich auf, viele Rufe zeigen eine Betonung der Frequenzen von ca. 25 – 70 kHz, und die Rufe sind tendenziell länger als bei den anderen Arten.
Was ist charakteristisch für die Rufe der Bartfledermäuse in unterirdischen Quartieren?
Die Bartfledermäuse haben eine höhere Hauptfrequenz ab 50 kHz, und die zweite Harmonische ist stark betont.
Was ist charakteristisch für die Rufe der Bechsteinfledermaus in unterirdischen Quartieren?
Die Bechsteinfledermaus gibt sehr leise Rufe von sich, die zweite Harmonische wird meist nicht sehr betont, und es gibt einzelne eingestreute längere Rufe mit Myotis-Knick.
Was ist charakteristisch für die Rufe der Wimperfledermaus in unterirdischen Quartieren?
Die Rufe der Wimperfledermaus haben ein hohes Rufende ab 35 kHz, und die Hauptfrequenz ist schwer ablesbar, aber häufig erhöht.
Was ist charakteristisch für die Rufe der Fransenfledermaus in unterirdischen Quartieren?
Die Fransenfledermaus deckt ein sehr breites Frequenzband ab und hat meist keine Peak-Frequenz feststellbar im Powerspektrum.
Welche Ergebnisse wurden hinsichtlich der Variabilität der Rufe zwischen einzelnen Quartieren erzielt?
Es wurde keine Variabilität der Rufe einer Fledermausart zwischen einzelnen Quartieren erkennbar. Die intraspezifische Variabilität der Ortungsrufe erwies sich als deutlich größer.
Was ist bei der Methodik von akustischen Untersuchungen an unterirdischen Quartieren zu beachten?
Eine wenig selektive Aufnahmeeinstellung hinsichtlich der Rufqualität an den Aufnahmegeräten wird empfohlen, da ansonsten durch Echos gestörte Rufe nicht als Fledermausrufe erkannt und leise Rufe nicht aufgezeichnet werden.
Was ist bei der quantitativen Auswertung von Rufsequenzen zu beachten?
Aufgrund der hohen Aktivität an unterirdischen Quartieren und der daraus resultierenden Vielzahl an Rufaufnahmen sowie des manuellen Aufwandes zur Bestimmung der Sequenzen ist eine quantitative Auswertung der Rufsequenzen auf Artniveau i. d. R. nicht möglich.
- Citar trabajo
- Bernadette Wimmer (Autor), K. Kugelschafter (Autor), 2015, Akustische Erfassung von Fledermäusen in unterirdischen Quartieren, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/500418