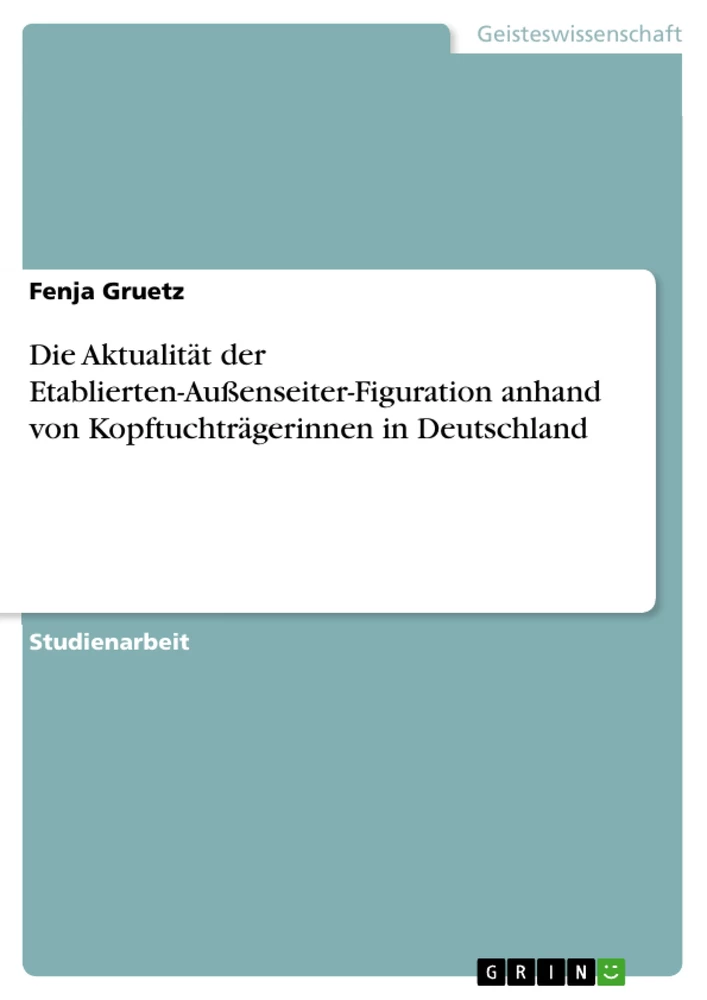Die Hausarbeit beschäftigt sich mit der Etablierten-Außenseiter-Figuration von Norbert Elias. Nach einer Auseinandersetzung mit seiner Studie wird diese auf die aktuelle Situation von Kopftuchträgerinnen in Deutschland bezogen und auf seine Übertragbarkeit untersucht.
Zunächst werden die grundsätzlichen Erkenntnisse der Theorie dargestellt, wobei der Fokus auf den intergruppalen Prozessen zweier Zonen und ihrem Umgang miteinander liegt. Der zweite Abschnitt des zweiten Kapitels konzentriert sich auf den Begriff der Stigmatisierung in Bezug auf Fremdheit. Im darauffolgenden Kapitel wird die Theorie von Etablierten-Außenseiter-Beziehungen auf das Verhältnis zwischen der Mehrheitsgesellschaft in Deutschland und dort lebenden Musliminnen, die das Merkmal des Kopftuchs aufweisen, bezogen. Dabei liegt der Fokus auf der gesellschaftlichen Figuration und Stigmatisierung. Die rechtlichen und religiösen Grundlagen werden außen vor gelassen und die Bedeutung des Kopftuchs wird vernachlässigt, da sie für die Anwendung der thematisierten Theorie eine untergeordnete Rolle einnimmt. Im vierten Kapitel wird in einem Fazit zusammengefasst, inwieweit die Theorie von Elias auf diese Konstellation zutrifft und welche Unterschiede auftreten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- „Etablierte und Außenseiter“ von Norbert Elias (1965)
- Ergebnisse der Studie bezüglich intergruppaler Gruppenbeziehungen
- Die Stigmatisierung von Fremdgruppen
- Stigmatisierung von Kopftuchträgerinnen in Deutschland
- Bilder von dem Islam und dem Kopftuch
- Ausgrenzung und Stigmatisierung von Kopftuchträgerinnen
- Vergleich der Figurationen und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die von Norbert Elias entwickelte Etablierten-Außenseiter-Figuration und untersucht, ob diese auf die heutige Situation von Kopftuchträgerinnen in Deutschland übertragbar ist. Die Arbeit befasst sich mit der Ausgrenzung und Stigmatisierung von Fremdgruppen durch eine etablierte Mehrheitsgesellschaft.
- Analyse der Etablierten-Außenseiter-Figuration nach Elias
- Anwendung der Theorie auf die Situation von Kopftuchträgerinnen in Deutschland
- Untersuchung von Ausgrenzung und Stigmatisierungsprozessen
- Vergleich der Figurationen und Feststellung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Problemstellung vor und erläutert die Relevanz der Etablierten-Außenseiter-Figuration für die aktuelle Situation von Kopftuchträgerinnen in Deutschland.
„Etablierte und Außenseiter“ von Norbert Elias (1965)
Dieses Kapitel präsentiert die grundlegenden Erkenntnisse der Etablierten-Außenseiter-Theorie von Norbert Elias. Der Fokus liegt auf der Analyse der intergruppalen Beziehungen zwischen Etablierten und Außenseitern im Kontext der von Elias durchgeführten Studie in Winston Parva.
Stigmatisierung von Kopftuchträgerinnen in Deutschland
In diesem Kapitel wird die Theorie von Etablierten-Außenseiter-Beziehungen auf das Verhältnis zwischen der deutschen Mehrheitsgesellschaft und Kopftuchträgerinnen in Deutschland bezogen. Der Schwerpunkt liegt auf der gesellschaftlichen Figuration und Stigmatisierung von Kopftuchträgerinnen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die folgenden Schlüsselwörter: Etablierte-Außenseiter-Figuration, Norbert Elias, Stigmatisierung, Kopftuchträgerinnen, Ausgrenzung, Fremdgruppen, Mehrheitsgesellschaft, intergruppale Beziehungen, gesellschaftliche Figuration.
- Quote paper
- Fenja Gruetz (Author), 2018, Die Aktualität der Etablierten-Außenseiter-Figuration anhand von Kopftuchträgerinnen in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/500440