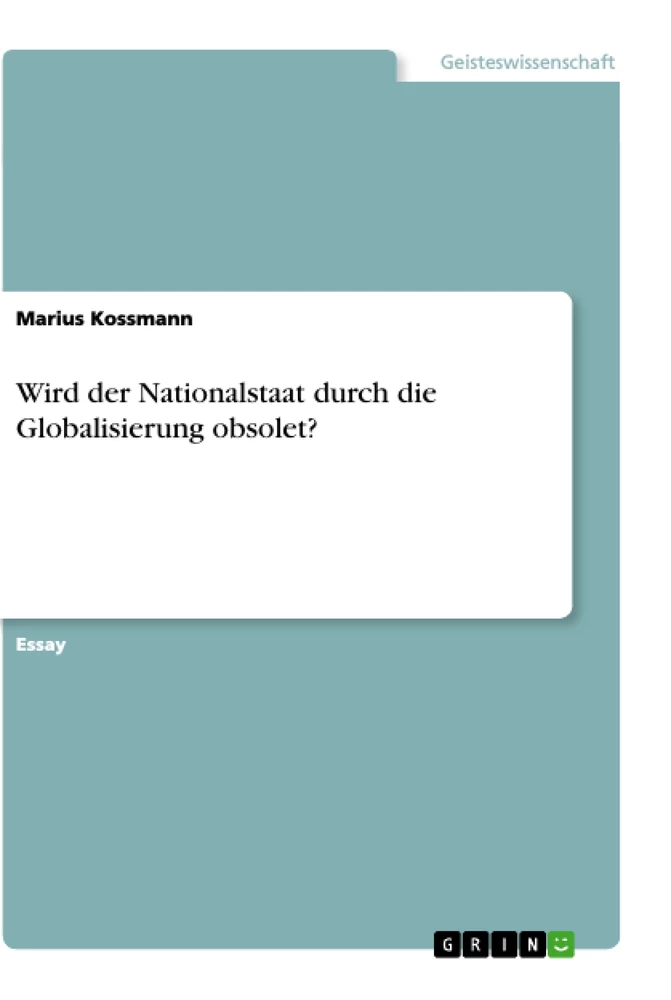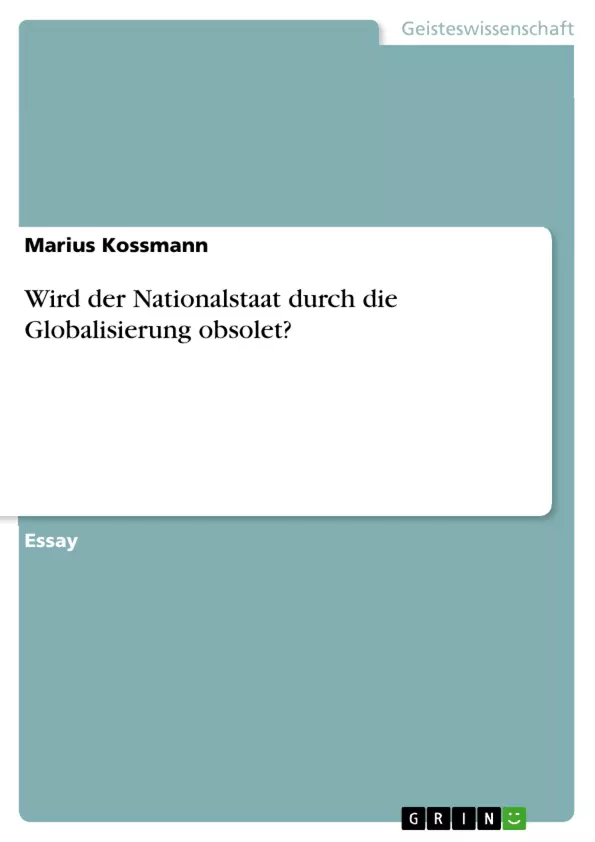Waren, Daten und Geld fließen zeit- und grenzenlos ungehindert durch die Welt, doch der Mensch orientiert sich immer noch an nationalstaatlichen Grenzen, er folgt seiner Verfassung und bei Sportevents unterstützt er seine Nationalmannschaft und singt die Hymne seiner Nation.
Heute ist die Anzahl der Nationalstaaten in Europa und auf der Welt höher als je zuvor. Aber dennoch beschwören viele Autoren immer wieder den Anachronismus des Nationalstaates und sein Ende durch die Denationalisierung. Seit Beginn des 21. Jahrhunderts scheint es so, dass die Nationalstaaten an Boden verlieren, kein Land der Welt kann noch eine eigene Wirtschaftspolitik ohne äußeren Einfluss gestalten.
Die Auswirkungen der Globalisierung soll zum Ende des nationalstaatlichen Regierens führen und den Nationalstaat als politische Organisationsform obsolet machen. Eben dieser Behauptung bedarf es im weiteren Verlauf des Essays eine Auseinandersetzung und Gegenüberstellung beider Begriffe und ihrer derzeitigen Wahrnehmung mit dem jeweiligen historischen Kontext.
Inhaltsverzeichnis
- Wird der Nationalstaat durch die Globalisierung obsolet?
- Der Begriff des Nationalstaates
- Die äußeren und inneren Aspekte der Nationalstaatsbildung
- Der moderne Staat
- Globalisierung und der Nationalstaat
- Der Verfassungsstaat in der Globalisierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay untersucht die These, dass die Globalisierung den Nationalstaat obsolet macht. Er analysiert den Begriff des Nationalstaates, seine Entstehung und seine gegenwärtige Bedeutung im Kontext der Globalisierung. Dabei werden verschiedene Theorien und Perspektiven betrachtet.
- Definition und historische Entwicklung des Nationalstaates
- Innere und äußere Aspekte der Nationalstaatsbildung
- Der Einfluss der Globalisierung auf den Nationalstaat
- Der moderne Verfassungsstaat und seine Herausforderungen
- Verschiedene Theorien zum Verhältnis von Globalisierung und Staatlichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Wird der Nationalstaat durch die Globalisierung obsolet?: Der einleitende Abschnitt stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Obsoleszenz des Nationalstaates im Zuge der Globalisierung. Er kontrastiert den ungehinderten globalen Fluss von Waren, Daten und Geld mit der anhaltenden Relevanz nationalstaatlicher Grenzen und Identitäten. Die These vom bevorstehenden Ende des Nationalstaates wird als Ausgangspunkt für eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem Begriff und seiner historischen Entwicklung eingeführt. Die unterschiedlichen Auffassungen und Theorien werden als Grundlage für die weitere Analyse vorgestellt.
Der Begriff des Nationalstaates: Dieses Kapitel beleuchtet die Schwierigkeiten bei der Definition des Nationalstaates. Es präsentiert unterschiedliche Definitionen, die auf kultureller Homogenität (UNESCO-Ansatz) oder auf politischer Partizipation und Souveränität (Dann) beruhen. Die Grenzen und Probleme dieser Definitionsansätze werden anhand von Beispielen wie Polen unter kommunistischer Herrschaft oder Spanien unter Franco aufgezeigt, welche die hohen Anforderungen der Definitionen nicht erfüllen. Die geschlechterneutrale Betrachtung der Definitionen wird kritisch hinterfragt und führt zu der Einsicht, dass der Zeitpunkt des Erreichens von Nationalstaatlichkeit schwer zu bestimmen ist.
Die äußeren und inneren Aspekte der Nationalstaatsbildung: Dieses Kapitel differenziert zwischen inneren und äußeren Aspekten der Nationalstaatsbildung. Die inneren Aspekte, wie die strukturelle Integration und homogene Bewusstseinsbildung innerhalb eines Territoriums, erweisen sich als schwer zu definieren, wie das Beispiel Frankreichs zeigt. Im Gegensatz dazu sind die äußeren Aspekte, insbesondere die internationale Anerkennung als unabhängiger Akteur, leichter zu identifizieren. Der Kapitel beschreibt die drei Wege zur Entstehung von Nationalstaaten: revolutionäre Verselbständigung, hegemoniale Vereinigungen und evolutionäre Autonomisierung. Die Zunahme der Nationalstaaten im 20. Jahrhundert wird im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Nationalismus und der Ablösung der Fürstensouveränität erläutert.
Der moderne Staat: Dieses Kapitel definiert den modernen Staat als eine Einheit mit abgegrenztem Gebiet, anerkannten Bürgern und eigenen Gesetzen. Es betont die Bedeutung von Freiheits-, Beteiligungs- und sozialen Rechten der Bürger, sowie die rechtstaatliche Bindung der Staatsgewalt. Die Legitimation des Staates gründet in einer anerkannten Verfassung, die demokratische Strukturen festlegt. Die dynamische und flexible Natur des modernen Staates und die gesellschaftliche Mitverantwortung für seine Aufgaben werden hervorgehoben, im Gegensatz zu einer konstanten Staatsaufgabe. Die Zugehörigkeit zu einem Staat wird als fremdbestimmt durch Geburt oder ethnische Herkunft beschrieben.
Globalisierung und der Nationalstaat: Dieses Kapitel analysiert die Beziehung zwischen Globalisierung und Nationalstaat. Es zeigt die Divergenz zwischen dem ungehinderten globalen Fluss von Daten, Waren und Kapital und der anhaltenden Relevanz nationalstaatlicher Identitäten und Grenzen auf. Der Begriff „Globalisierung“ wird in seiner Vielschichtigkeit und Uneinheitlichkeit beleuchtet. Es werden zwei gegensätzliche Positionen vorgestellt: die Globalisierungsthese, die den Nationalstaat als ohnmächtig gegenüber globalen Kräften sieht, und die Politisierungsthese, die den Aufstieg neuer transnationaler Akteure betont. Die Positionen von Held/McGrew und Czerny werden skizziert.
Der Verfassungsstaat in der Globalisierung: Der letzte Abschnitt analysiert die Resilienz des Verfassungsstaates in einer globalisierten Welt. Die relative Jugend des Verfassungsstaates im historischen Kontext wird mit seiner Stabilität durch die Anerkennung von Grund- und Menschenrechten kontrastiert. Das Kapitel diskutiert die Frage nach der Relevanz eines möglichen Machtverlustes des Staates und ob dieser vom Aussterben bedroht ist. Die Notwendigkeit der Anpassung an veränderte gesellschaftliche Bedingungen wird betont, und Ansätze wie Denationalisierung, Supervisionsstaat und Postdemokratie werden als mögliche Folgen der Globalisierung erwähnt, wobei die Einschränkung gemacht wird, dass Postdemokratie kein staatstheoretischer Ansatz ist.
Schlüsselwörter
Nationalstaat, Globalisierung, Souveränität, Verfassungsstaat, Nationalismus, Denationalisierung, Politische Partizipation, Globalisierungsthese, Politisierungsthese, Moderner Staat, Risikogesellschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Essay: "Wird der Nationalstaat durch die Globalisierung obsolet?"
Was ist der zentrale Gegenstand des Essays?
Der Essay untersucht die These, ob die Globalisierung den Nationalstaat obsolet macht. Er analysiert den Begriff des Nationalstaates, seine Entstehung und seine heutige Bedeutung im Kontext der Globalisierung, unter Berücksichtigung verschiedener Theorien und Perspektiven.
Welche Themen werden im Essay behandelt?
Der Essay behandelt die Definition und historische Entwicklung des Nationalstaates, die inneren und äußeren Aspekte seiner Bildung, den Einfluss der Globalisierung darauf, den modernen Verfassungsstaat und seine Herausforderungen sowie verschiedene Theorien zum Verhältnis von Globalisierung und Staatlichkeit. Konkret werden Themen wie Souveränität, Nationalismus, Denationalisierung und die Rolle transnationaler Akteure diskutiert.
Wie ist der Essay aufgebaut?
Der Essay gliedert sich in Kapitel, die die Forschungsfrage schrittweise bearbeiten. Er beginnt mit der zentralen Fragestellung zur Obsoleszenz des Nationalstaates, beleuchtet anschließend den Begriff des Nationalstaates selbst, seine Entstehung (innere und äußere Aspekte), charakterisiert den modernen Staat und analysiert schließlich das Verhältnis von Globalisierung und Nationalstaat, inklusive der Rolle des Verfassungsstaates in der globalisierten Welt. Schlüsselbegriffe und eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel runden den Essay ab.
Welche Definitionen des Nationalstaates werden diskutiert?
Der Essay präsentiert verschiedene Definitionen des Nationalstaates, darunter Ansätze, die auf kultureller Homogenität (UNESCO-Ansatz) oder politischer Partizipation und Souveränität (Dann) beruhen. Die Grenzen und Probleme dieser Definitionen werden anhand von Beispielen wie Polen unter kommunistischer Herrschaft oder Spanien unter Franco veranschaulicht. Die geschlechterneutrale Betrachtung der Definitionen wird kritisch hinterfragt.
Wie werden die Aspekte der Nationalstaatsbildung unterschieden?
Der Essay unterscheidet zwischen inneren Aspekten der Nationalstaatsbildung (strukturelle Integration, homogene Bewusstseinsbildung) und äußeren Aspekten (internationale Anerkennung). Er beschreibt drei Wege zur Entstehung von Nationalstaaten: revolutionäre Verselbständigung, hegemoniale Vereinigungen und evolutionäre Autonomisierung.
Wie wird der moderne Staat charakterisiert?
Der moderne Staat wird als Einheit mit abgegrenztem Gebiet, anerkannten Bürgern und eigenen Gesetzen definiert. Der Essay betont die Bedeutung von Freiheits-, Beteiligungs- und sozialen Rechten der Bürger, die rechtstaatliche Bindung der Staatsgewalt und die Legitimation durch eine anerkannte Verfassung. Die dynamische Natur des modernen Staates und die gesellschaftliche Mitverantwortung werden hervorgehoben.
Wie wird das Verhältnis von Globalisierung und Nationalstaat dargestellt?
Der Essay analysiert die komplexe Beziehung zwischen Globalisierung und Nationalstaat, die Divergenz zwischen dem globalen Fluss von Daten, Waren und Kapital und der anhaltenden Relevanz nationalstaatlicher Identitäten und Grenzen. Er stellt gegensätzliche Positionen vor: die Globalisierungsthese (Nationalstaat als ohnmächtig) und die Politisierungsthese (Aufstieg neuer transnationaler Akteure).
Welche Theorien und Perspektiven werden betrachtet?
Der Essay bezieht sich auf verschiedene Theorien und Perspektiven zum Verhältnis von Globalisierung und Staatlichkeit. Die Positionen von Held/McGrew und Czerny werden beispielsweise skizziert. Es werden verschiedene Ansätze diskutiert, wie der Staat auf die Globalisierung reagiert (Denationalisierung, Supervisionsstaat), wobei betont wird, dass Postdemokratie kein staatstheoretischer Ansatz ist.
Welche Schlussfolgerungen zieht der Essay?
Der Essay untersucht die Resilienz des Verfassungsstaates in der globalisierten Welt und diskutiert die Frage nach einem möglichen Machtverlust des Staates. Die Notwendigkeit der Anpassung an veränderte gesellschaftliche Bedingungen wird betont.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für den Essay?
Schlüsselwörter sind: Nationalstaat, Globalisierung, Souveränität, Verfassungsstaat, Nationalismus, Denationalisierung, Politische Partizipation, Globalisierungsthese, Politisierungsthese, Moderner Staat, Risikogesellschaft.
- Arbeit zitieren
- Marius Kossmann (Autor:in), 2019, Wird der Nationalstaat durch die Globalisierung obsolet?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/500609