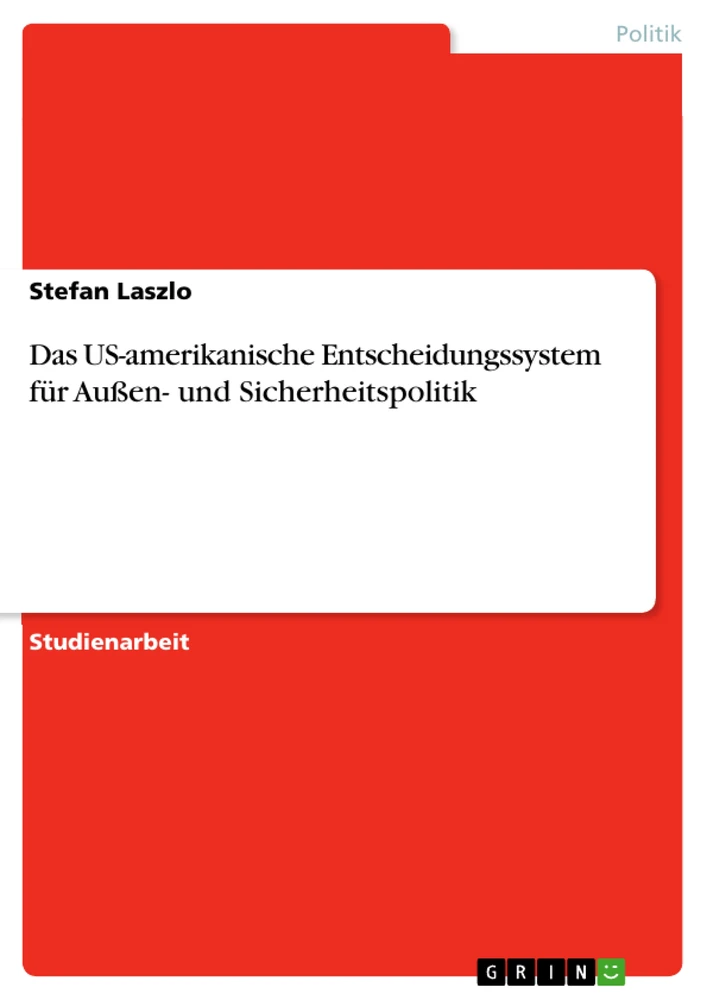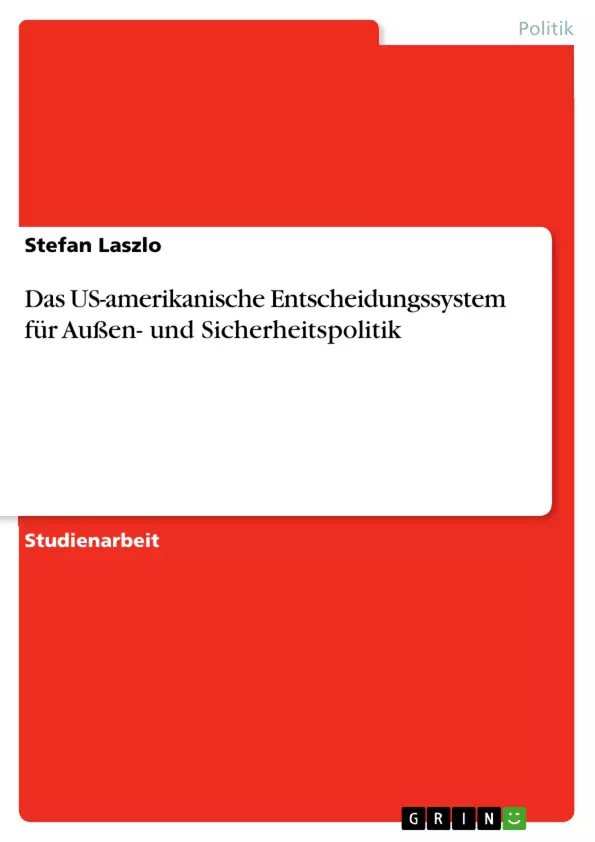Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem außenpolitischen Entscheidungssystem der Vereinigten Staaten von Amerika. Betrachtet werden die maßgeblich involvierten Akteure, und ihre qua Verfassung zugewiesene Funktionen in puncto Außen- und Sicherheitspolitik. Interessant ist dabei nicht zuletzt die Beobachtung der Art und Weise, in welcher die genannten Akteure ihre Rolle ausfüllen; ein Aspekt der in der vorliegenden Arbeit eine Schwerpunktsetzung erfährt.
Thematisch ist die nachstehende Darstellung in drei Abschnitte unterteilt. Zunächst erfolgt eine sehr kurze Einführung in Grundsätzlichkeiten der amerikanischen Verfassungsordnung. Im zweiten Teil erfolgt die Darstellung der Akteure im außenpolitischen Entscheidungsprozess, während sich der dritte Teil daran anschließt, wenn an der Illustration des war powers act exemplarisch die Grundkonfliktlinien zwischen den handlungstragenden Akteuren aufgezeigt werden sollen.
Einer besonderen Fragestellung wird bei all dem nicht nachgegangen. Vielmehr ist es Ziel des Verfassers, das von den jeweiligen Macht- und Einflussbefugnissen geprägte Wechselspiel zwischen Präsident und Kongress darzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Teil
- 1.1 Einleitung
- 1.2 Grundsätzliches zur Verfassungsordnung
- II. Teil
- 2.1 Präsident und Kongreß im außen- und sicherheitspolitischen Entscheidungsprozess
- 2.1.1 Der außenpolitische Entscheidungsprozess
- 2.1.2 Der Weg zur \"imperial presidency\"
- 2.1.3 Die sich wandelnde Rolle des Kongresses
- III. Teil
- 3.1 Der War Powers Act
- 3.1.1 Inhalt, Probleme und praktische Umsetzung des War Powers Act
- 3.2 Schlußbetrachtung
- IV. Teil
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das außenpolitische Entscheidungssystem der Vereinigten Staaten von Amerika. Im Fokus stehen die wichtigsten Akteure und ihre verfassungsmäßigen Aufgaben im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik. Besonderes Interesse gilt der Art und Weise, wie diese Akteure ihre Rollen ausfüllen. Die Darstellung gliedert sich in drei Abschnitte. Der erste Abschnitt bietet eine kurze Einführung in die grundlegenden Elemente der amerikanischen Verfassungsordnung. Der zweite Abschnitt konzentriert sich auf die Akteure im außenpolitischen Entscheidungsprozess. Der dritte Abschnitt verdeutlicht anhand des War Powers Act die zentralen Konfliktlinien zwischen den handelnden Akteuren.
- Die Verfassungsordnung und die Gewaltenteilung in den Vereinigten Staaten
- Die Rollen des Präsidenten und des Kongresses im außenpolitischen Entscheidungsprozess
- Das Zusammenspiel von Macht und Einfluss zwischen Präsident und Kongress
- Der War Powers Act und seine Auswirkungen auf das außenpolitische Entscheidungssystem
- Die Entwicklung der „imperial presidency“ und der sich verändernden Rolle des Kongresses
Zusammenfassung der Kapitel
I. Teil
1.1 Einleitung
Die Arbeit konzentriert sich auf das außenpolitische Entscheidungssystem der Vereinigten Staaten und analysiert die maßgeblich involvierten Akteure sowie ihre verfassungsmäßig zugewiesenen Rollen im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik. Der Fokus liegt dabei auf der Art und Weise, wie diese Akteure ihre Rollen ausfüllen. Die Darstellung gliedert sich in drei Abschnitte: Eine kurze Einführung in die amerikanische Verfassungsordnung, die Darstellung der Akteure im außenpolitischen Entscheidungsprozess und die Illustration der Grundkonfliktlinien zwischen den handelnden Akteuren anhand des War Powers Act.1.2 Grundsätzliches zur Verfassungsordnung
Die amerikanische Verfassung basiert auf dem Prinzip der Gewaltenteilung, das darauf abzielt, sowohl eine allmächtige Zentralregierung als auch die Willkürherrschaft der Mehrheit zu verhindern. Dies führt zu einer vertikalen Trennung von Machtbefugnissen zwischen den Einzelstaaten und der Bundesebene, wobei den Einzelstaaten weitreichendere Kompetenzen zugewiesen werden als beispielsweise im föderativen System der Bundesrepublik Deutschland. Auf Bundesebene erfolgt eine horizontale Gewaltentrennung, die Exekutive, Legislative und rechtsprechende Gewalt strikt trennt. Die Besonderheit des amerikanischen Systems liegt in der getrennten Wahl von Legislative und Exekutive, der Unvereinbarkeit von Regierungs- und Kongressmandaten sowie dem Fehlen eines Misstrauensvotums oder der Möglichkeit des Präsidenten, den Kongress aufzulösen.II. Teil
2.1 Präsident und Kongreß im außen- und sicherheitspolitischen Entscheidungsprozess
2.1.1 Der außenpolitische Entscheidungsprozess
Die amerikanische Verfassung enthält keine allgemeinen Bestimmungen über außenpolitische Fragen, sondern listet lediglich bestimmte Zuständigkeiten und Rechte auf, die für die auswärtigen Beziehungen relevant sind und entweder dem Präsidenten oder dem Kongreß zugeschrieben werden. Der Präsident besitzt das Exekutivrecht und kann als „Führer der Nation eine klare, eindeutige Außenpolitik verwirklichen“. Der Präsident hat das Recht, völkerrechtliche Verträge mit einer zustimmenden Zweidrittelmehrheit des Senats abzuschließen. Im Bereich des militärischen Sektors liegt das Recht zur Aufstellung und Regulierung von Streitkräften sowie das Recht der Kriegserklärung beim Kongreß, während der Präsident im Kriegsfalle Oberbefehlshaber der Streitkräfte ist. Der Kongreß hat weitreichende Befugnisse bezüglich der Handelspolitik und ist auch bei der Ernennung von Botschaftern oder politischen Beamten maßgeblich beteiligt.Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet das außenpolitische Entscheidungssystem der Vereinigten Staaten, die Gewaltenteilung, die Rollen von Präsident und Kongress, die „imperial presidency“, den War Powers Act, die Außen- und Sicherheitspolitik, die shared powers, die Verfassung, das Exekutivrecht, völkerrechtliche Verträge, die Streitkräfte, die Handelspolitik und die Ernennung von Botschaftern.Häufig gestellte Fragen
Wie ist die Gewaltenteilung in der US-Außenpolitik geregelt?
Die US-Verfassung teilt die Befugnisse zwischen Exekutive (Präsident) und Legislative (Kongress) auf. Während der Präsident Oberbefehlshaber ist, hat der Kongress das Recht zur Kriegserklärung und zur Budgetkontrolle.
Was versteht man unter der „Imperial Presidency“?
Der Begriff beschreibt eine historische Entwicklung, in der der US-Präsident seine Machtbefugnisse in der Außen- und Sicherheitspolitik auf Kosten des Kongresses massiv ausgeweitet hat.
Was ist der „War Powers Act“?
Der War Powers Act von 1973 ist ein Gesetz, das die Befugnisse des Präsidenten bei militärischen Einsätzen einschränken soll, indem es ihn verpflichtet, den Kongress einzubinden.
Welche Rolle spielt der Senat bei völkerrechtlichen Verträgen?
Völkerrechtliche Verträge, die der Präsident aushandelt, benötigen eine Zweidrittelmehrheit im Senat, um ratifiziert zu werden.
Wie unterscheidet sich das US-System vom deutschen Föderalismus?
Im US-System haben die Einzelstaaten weitreichendere Kompetenzen, und es gibt eine strikte horizontale Trennung zwischen Regierung und Parlament, ohne die Möglichkeit eines Misstrauensvotums.
- Quote paper
- Stefan Laszlo (Author), 2003, Das US-amerikanische Entscheidungssystem für Außen- und Sicherheitspolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/50065